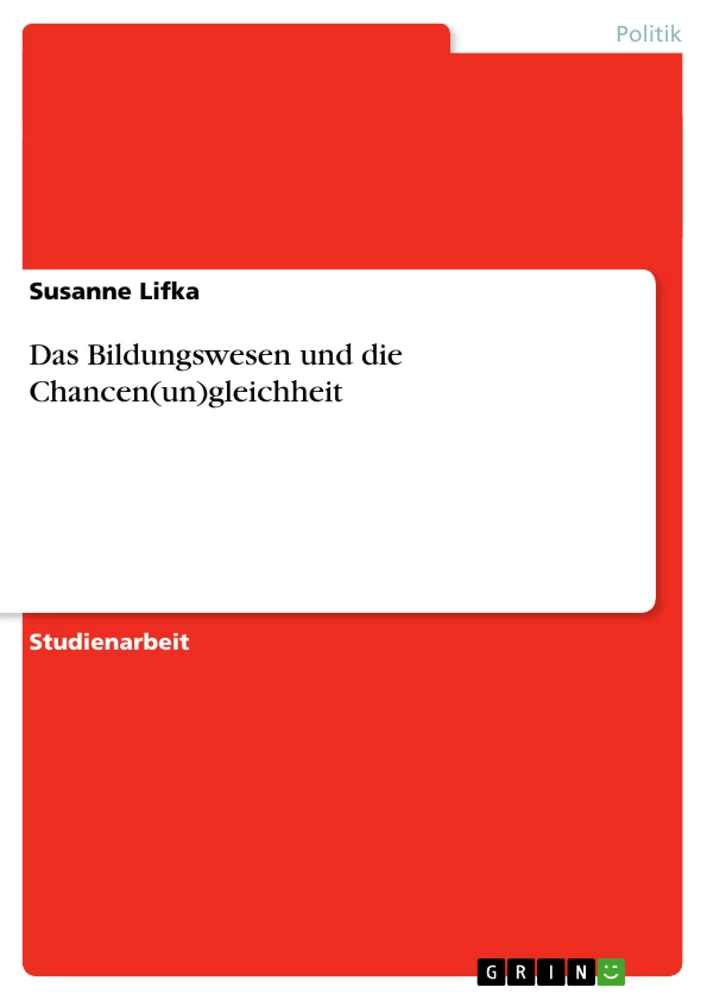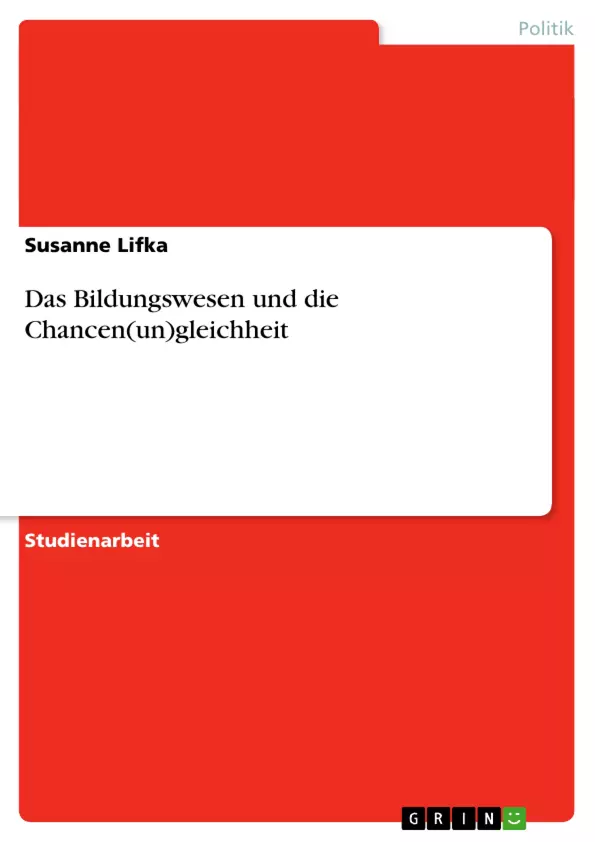Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Chancengleichheit als Staatsziel festgeschrieben, und damit ein grundlegender Bestandteil der Demokratie:
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
Die normierte Forderung nach der Gewährung gleicher Chancen für jeden Bürger eines Landes unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Herkunft, Religion oder Hautfarbe geht auf die Philosophie der Aufklärung zurück.
„Die Grundlage [...] der Aufklärung war die Überzeugung, dass alle Menschen von Natur aus gleich sind, weil sie vernunftbegabte Wesen sind.“
Aus dem Gebot der Chancengleichheit resultiert zwangsläufig und zuallererst das Gebot der Gleichheit der Bildungschancen, weil Bildung die Grundvoraussetzung der sozialen und insbesondere der beruflichen Chancengleichheit ist. Dies bedeutet im Hinblick auf die Schulausbildung, dass der Zugang zu allen Bildungswegen Kindern aus allen sozialen Schichten grundsätzlich offen stehen muss. Altbundeskanzler Willy Brandt machte mit der Forderung „mehr Demokratie zu wagen“ die Verwirklichung von Chancengleichheit sogar demonstrativ zum Thema der Politik.
Die Ergebnisse der PISA – Studie zeigen aber, dass die Verwirklichung der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem von der Institution Schule unzureichend umgesetzt wird. Da dies jedoch die Pflicht der Schule als staatliche Institution ist, besteht auf diesem Gebiet noch erhöhter Handlungsbedarf.
Im folgenden werden wir die politische Situation, in der in den 60er und 70er Jahren Forderungen wie Bildung für alle und mehr Chancengleichheit erhoben wurden, darstellen. Des Weiteren werden wir versuchen die Ursachen für die bestehende Chancenungleichheit im Bildungssystem aufzuzeigen, um abschließend auf einen möglichen Lösungsansatz einzugehen. Dabei werden wir auf empirische Untersuchungen verschiedener Autoren zurückgreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Situation der 60er und70er Jahre
- Verwirklichung des Art. 3 des GG durch Reformen?
- Chancenungleichheit:
- Reproduktion oder Reduktion durch das Schulsystem?
- Integrierte Gesamtschule als Schule der Zukunft?
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem im Kontext der Reformen der 60er und 70er Jahre. Ziel ist es, die Ursachen für bestehende Chancenungleichheit aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich auf empirische Untersuchungen verschiedener Autoren.
- Chancengleichheit im Bildungssystem
- Bildungsreformen der 60er und 70er Jahre
- Ursachen für Chancenungleichheit
- Integrierte Gesamtschule als Lösungsansatz
- Empirische Untersuchungen und Forschungsergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Grundgesetz und dessen Festlegung der Chancengleichheit als Staatsziel vor. Die Bedeutung von Bildung für die Verwirklichung der Chancengleichheit und die problematische Situation im deutschen Bildungssystem werden beleuchtet.
- Die Situation der 60er und 70er Jahre – Verwirklichung des Art. 3 des GG durch Reformen?: Dieser Abschnitt beleuchtet die Entwicklung der Bildungsreformen in den 60er und 70er Jahren vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen und der Forderung nach Chancengleichheit. Die Arbeit zeigt auf, wie Bildung zu einem wichtigen Thema der Politik wurde und welche Reformen umgesetzt wurden, um das Bildungssystem zu verbessern.
- Chancenungleichheit: Reproduktion oder Reduktion durch das Schulsystem?: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Ursachen für die bestehende Chancenungleichheit im Bildungssystem und beleuchtet die Rolle des Schulsystems in diesem Zusammenhang. Es werden verschiedene Aspekte, wie geschlechts- und schichtspezifische, regionale und konfessionelle Ungleichheiten betrachtet.
- Integrierte Gesamtschule als Schule der Zukunft?: Dieser Abschnitt behandelt die integrierte Gesamtschule (IGS) als möglicher Lösungsansatz für die bestehende Chancenungleichheit. Die Arbeit beleuchtet die Idee der IGS und deren Bedeutung für die Gleichstellung im Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Chancengleichheit, Bildungssystem, Schulreform, Bildungsexpansion, integrierte Gesamtschule, soziale Ungleichheit, empirische Forschung, PISA-Studie und Grundgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Ist Chancengleichheit in Deutschland gesetzlich verankert?
Ja, Artikel 3 des Grundgesetzes schreibt fest, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder seines Glaubens benachteiligt werden darf.
Was zeigen die PISA-Studien zur Chancenungleichheit?
Sie belegen, dass im deutschen Bildungssystem der Schulerfolg weiterhin stark von der sozialen Herkunft der Eltern abhängt.
Welche Bildungsreformen gab es in den 60er und 70er Jahren?
Unter dem Motto 'Bildung für alle' wurden Kapazitäten ausgebaut, das Abitur für breitere Schichten geöffnet und neue Schulformen wie die Gesamtschule erprobt.
Kann die Integrierte Gesamtschule die Chancenungleichheit reduzieren?
Die Arbeit diskutiert die Gesamtschule als Lösungsansatz, da sie Kinder länger gemeinsam lernen lässt und die frühe Selektion nach der 4. Klasse vermeidet.
Warum ist Bildung die Basis für berufliche Chancengleichheit?
Weil formale Bildungsabschlüsse in modernen Gesellschaften der entscheidende Faktor für den Zugang zu qualifizierten Berufen und sozialem Aufstieg sind.
- Quote paper
- Susanne Lifka (Author), 2002, Das Bildungswesen und die Chancen(un)gleichheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7545