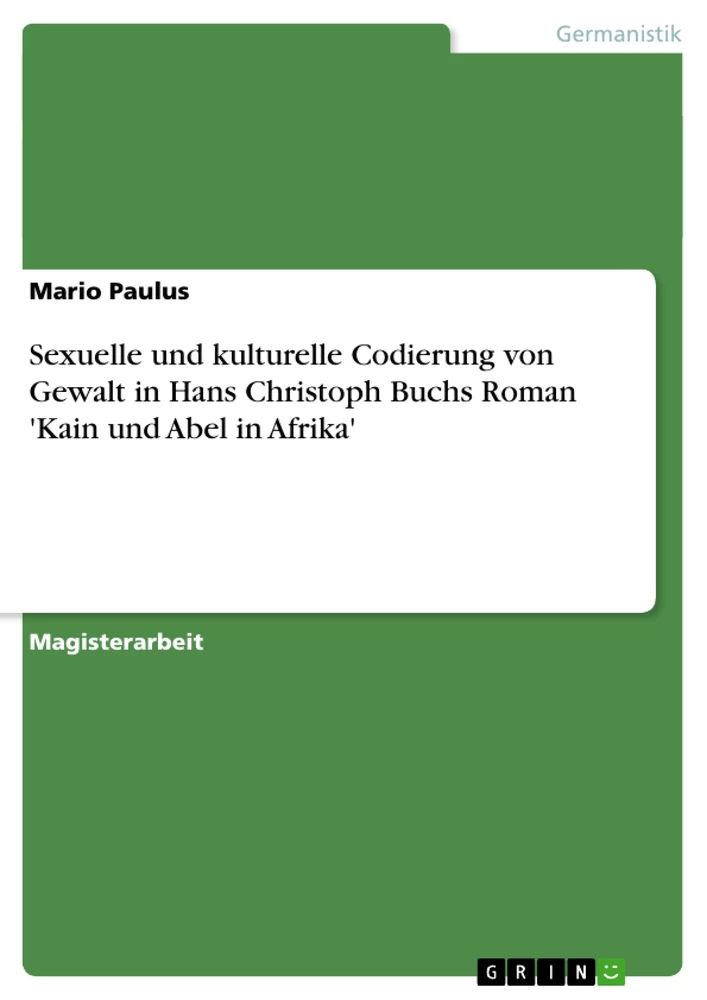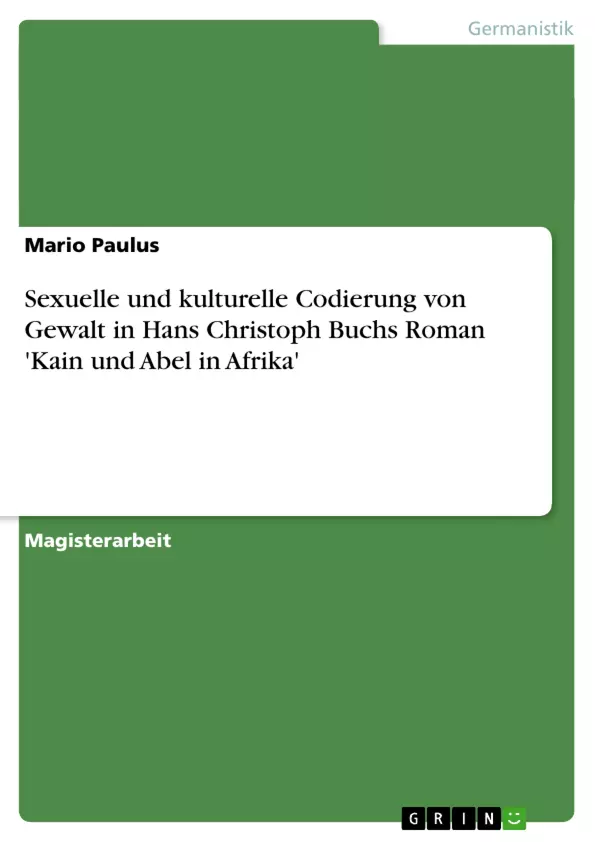In seinem Roman „Kain und Abel in Afrika“ (veröffentlicht 2001) setzt Hans Christoph Buch sich mit dem Genozid auseinander, der Mitte der 1990er Jahre in Ruanda stattgefunden hat, sowie mit der komplexen politischen Situation in Zaire, das nach einem Putsch im Jahre 1997 wieder die Bezeichnung „Demokratische Republik Kongo“ trägt. Dabei greift Buch auf Erfahrungen zurück, die er während dreier Aufenthalte in Ruanda, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo in den Jahren 1995, 1996 und 1997 gesammelt hat.
Die gegenwartsbezogene Thematik wird in komplexer Weise verknüpft mit der kolonialen Vorgeschichte, der mit der fingierten Ich-Erzählung Richard Kandts ein eigener Erzählstrang gewidmet ist, für den Kandts tatsächlicher Reisebericht „Caput Nili. Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils“ (1897-1902) die wichtigste Quelle darstellt.
Im Zentrum des Romans stehen Formen kultureller und sexueller Gewalt, die zugleich den Ausgangspunkt bilden für weiter reichende Reflexionen der beiden Erzähler. Es zeigt sich im Laufe der Romanhandlung, dass die Erfahrung von Brutalität zugleich den Hintergrund darstellt für eine Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem Tod der eigenen Eltern, sodass neben der Überschneidung der Kategorien Kultur und Geschlecht eine komplexe Verknüpfung von Öffentlichkeit und Privatsphäre vorgeführt wird.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Frage nachgegangen, inwiefern die beiden Erzähler mit kultureller und sexueller Gewalt konfrontiert werden und selbst in bestehende Gewaltstrukturen verstrickt sind. In einem zweiten Schritt wird untersucht, welche Erklärungsansätze für das Auftreten von Gewalt der Roman liefert.
Dann kreist die Untersuchung um das Problem, welche Konsequenzen sich aus den bis dahin gewonnenen Erkenntnissen – auch auf Textebene – ergeben. Hier werden Themen behandelt, die sich auf umfassendere Kontexte literatur- und kulturwissenschaftlicher Betrachtungsweisen beziehen, nämlich die Funktion der spezifischen historisierenden Blickrichtung des Textes, die Art und Weise, wie der Umgang mit „Fremdheit“ thematisiert wird sowie die Sicht auf die Stellung des Schriftstellers in der Gesellschaft.
Wird in dem Roman – so ist zu fragen – die Aussicht auf ein in Zukunft gelingendes (inter- und intrakulturelles) Miteinander angedeutet und wie wäre dies aus Sicht des Textes zu bewerkstelligen? Zugleich wird implizit die literarische Qualität des Romans gemessen an den Konzepten postkolonialen Schreibens.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwischen Fiktion und Faktizität: Kulturelle und sexuelle Gewalt in der Gegenwart
- „Wo Weiße sind, gibt es Essen“ – kulturelle Hierarchisierung
- „Aggressive Abwehrreflexe“ – Reaktion auf indirekt vermitteltes Leiden
- „Gewalt als Aphrodisiakum?“ – Reaktion auf direkt erfahrenes Leiden
- „Was bleibt, ist die unglaubliche Roheit“ – Reaktion auf das Leiden der Mutter
- „Dein Vorrat an einschlägigen Substantiven und Adjektiven ist erschöpft“ – Medien- und Sprachkritik
- „Mehr sagt er nicht“ – Polyphonie?
- Der Kolonialismus und die Verantwortung der Europäer
- „Von einem muskulösen Träger geschultert“ – Privilegierung des „weißen“ Entdeckers
- „der Erfüllung meiner geheimsten Wünsche nahe“ – Kandt und Mabruk als „koloniales Paar“
- „Und wer sind Sie, junger Mann?“ – Zu Buchs Sicht auf Kandt
- „…daß der Kampf für keine Seite militärisch zu gewinnen war“ – Europa zur Zeit des Ersten Weltkrieges
- „Ich schreibe diese Zeilen in der Zeit nach meiner Zeit“ – Zur Funktion der Multiperspektivität
- „Die Grundübel der Dritten Welt: Korruption, Brutalität und Ineffizienz“
- Korruption: „Der Name wirkt wie ein Sesam-öffne-dich“
- Brutalität: „Die Männer waren maskiert“
- Ineffizienz: „Am Ende seiner zweistündigen Rede werden der Bierpreis und der Dollarkurs per Akklamation festgelegt“
- Zum Motiv des Brudermords
- Zur Überwindung des „Dritte-Welt“-Diskurses
- Geschichte als Zyklus?
- Zum Prolog: Kunst und Geschichte – Tilgung des Konkreten
- „Angeblich ist Kabila eine Reinkarnation Mobutus“ – Wiederholung der Geschichte?
- Zur Bedeutung biblischer Stoffe und Motive
- Schreiben als „kollektives Unternehmen“ – Intertextualität
- Grenzüberschreitung und Utopie
- „Das Paradies ist OFF LIMITS“ – Grenzüberschreitung?
- Grenzüberschreitung und interkulturelle Begegnung
- „Je länger ich hierbleibe, desto weniger begreife ich“ – Grenzüberschreitung und Fremdverstehen
- „Denn hätten sie es gelernt, wären sie nicht zurückgekehrt“ – Grenzüberschreitung und Tod
- Der Schriftsteller und die Gesellschaft
- „Kulturelles“ und individuelles Gedächtnis – Vermitteln und Verarbeiten
- Schreiben gegen Totalitarismus und Fremdenhass
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit von Mario Paulus untersucht die sexuelle und kulturelle Codierung von Gewalt im Roman „Kain und Abel in Afrika“ von Hans Christoph Buch. Die Arbeit analysiert, wie Buch die Gewaltexzesse in Ostafrika, insbesondere den Genozid in Ruanda und die politische Situation im Kongo, mit der kolonialen Vergangenheit Europas und den „Grundübeln der Dritten Welt“ verknüpft. Dabei beleuchtet Paulus die Rolle des „weißen“ europäischen Beobachters und seine Beziehung zu den afrikanischen Figuren.
- Die Rolle von kultureller und sexueller Gewalt im Roman
- Die Verflechtung von Kolonialismus und gegenwärtiger Gewalt in Ostafrika
- Die Bedeutung von Korruption, Brutalität und Ineffizienz in afrikanischen Staaten
- Die Funktion von Erinnerung und Vergessen im Kontext von Gewalt und Identität
- Die Rolle des Schriftstellers als Vermittler und Verarbeiter von Erfahrungen und als Teil des kulturellen Gedächtnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht zunächst, wie kulturelle und sexuelle Gewalt im Roman dargestellt werden. Sie beleuchtet die Privilegierung des „weißen“ europäischen Beobachters und analysiert seine Reaktionen auf indirekt und direkt erlebtes Leiden. Im Anschluss werden die Beweggründe der beiden Erzähler, der deutsche Schriftsteller und Richard Kandt, beleuchtet. Dabei zeigt Paulus auf, wie Buch die koloniale Vergangenheit Europas mit der gegenwärtigen Situation in Ostafrika verknüpft. Anschließend wird die Rolle der „Grundübel der Dritten Welt“ analysiert, wobei Paulus insbesondere auf Korruption, Brutalität und Ineffizienz sowie deren Folgen eingeht. In einem weiteren Schritt werden verschiedene Ansätze zu einer Grenzüberschreitung untersucht, die als Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben der Menschen gelten. Abschließend wird die Rolle des Schriftstellers und des Schreibens als Vermittler von Erfahrung und als Teil des kulturellen Gedächtnisses betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Schlüsselbegriffe wie kulturelle Gewalt, sexuelle Gewalt, Kolonialismus, Postkolonialismus, „Dritte Welt“, Korruption, Brutalität, Ineffizienz, Erinnerung, Vergessen, kulturelles Gedächtnis, interkulturelle Begegnung und Grenzüberschreitung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Roman 'Kain und Abel in Afrika'?
Der Roman von Hans Christoph Buch setzt sich mit dem Genozid in Ruanda Mitte der 1990er Jahre und der politischen Lage im Kongo auseinander.
Welche Rolle spielt die Figur Richard Kandt?
Kandt dient als historischer Ich-Erzähler, dessen Reiseberichte aus der Kolonialzeit (um 1900) mit der gegenwärtigen Handlung verknüpft werden.
Was bedeutet die "sexuelle und kulturelle Codierung von Gewalt"?
Es beschreibt, wie Gewalt im Roman durch kulturelle Hierarchien und geschlechtsspezifische Machtverhältnisse dargestellt und interpretiert wird.
Welche "Grundübel der Dritten Welt" werden thematisiert?
Der Roman reflektiert über Korruption, Brutalität und Ineffizienz als zentrale Probleme der betroffenen afrikanischen Staaten.
Wie wird das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre verknüpft?
Die Erfahrung politischer Brutalität wird im Roman mit dem persönlichen Sterben und dem Tod der Eltern der Erzähler verwoben.
Bietet der Text eine utopische Aussicht auf Besserung?
Die Arbeit untersucht, ob der Roman Ansätze für ein gelingendes interkulturelles Miteinander andeutet oder ob Geschichte als ein ewiger Zyklus von Gewalt gesehen wird.
- Quote paper
- M.A. Mario Paulus (Author), 2004, Sexuelle und kulturelle Codierung von Gewalt in Hans Christoph Buchs Roman 'Kain und Abel in Afrika', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75463