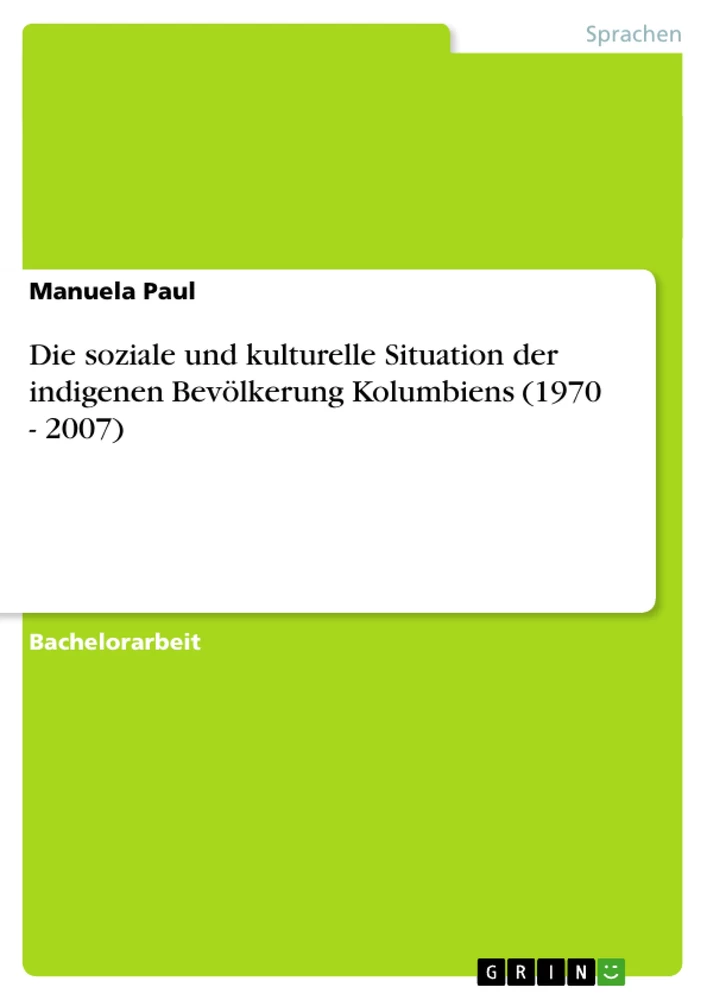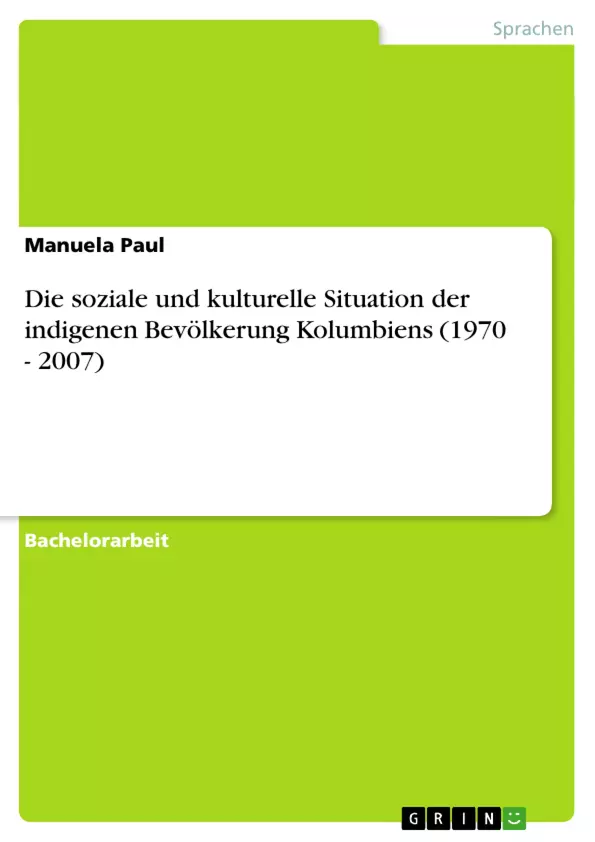Mit dem Einzug der spanischen Kolonialmacht Anfang des 16. Jahrhunderts in Kolumbien begann ein bis heute anhaltender Prozess der indigenen Bevölkerung im Kampf um Emanzipation. Infolge von Unterwerfung, Ausbeutung und der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage sank die in Kolumbien lebende indigene Bevölkerung rapide. Während der Kolonisierung trieb die spanische Krone die Eliminierung der Urbevölkerung voran, bis sie verstand, dass sie damit nützliche Arbeitskräfte verlor. Die darauffolgenden Gesetze erkannten erstmals die traditionellen, gemeinschaftlichen Territorien und Verwaltungsformen der Indigenen an.1
Im Zuge der Unabhängigkeit Kolumbiens 1819 wurde der zum Ende der Kolonisierung gemäßigtere Kurs durch eine Assimilierungs- und Integrationspolitik weitergeführt. Von der Prämisse ausgehend, dass alle Menschen gleich sind, strebte die Regierung eine Nation der Mestizen an.2 Die indigene Kultur, welche sich aus Sicht der republikanischen Regierung im Bezug auf den Fortschritt des Landes eher regressiv verhielt, behinderte den Kurs Kolumbiens zu einer Gestaltung des Landes nach europäischem Vorbild. Durch das Fehlen eines indigenen Elementes in dieser Ideologie blieben nur zwei Möglichkeiten zur Lösung der indigenen Frage: die Integration der Urbevölkerung oder ihre Eliminierung. Doch die Indigenen wehrten sich in gleichem Maße wie sie sich gegen die Unterdrückung durch die spanischen Invasoren aufgelehnt hatten nun gegen die staatlichen Integrationsversuche.3
Die Geschichte des indigenen Widerstandes in Kolumbien begann folglich vor mehr als 500 Jahren mit der aufkommenden Verteidigung gegen die spanischen Eindringlinge. Die neuere indigene Bewegung Kolumbiens hat ihren Ursprung jedoch in den 1970er Jahren, einer Zeit, in der die indigene Bevölkerung aufgrund ihrer Integration und Eliminierung in dem nationalen kolumbianischen Bewusstsein als etwas sich allmählich Auflösendes existierte. Umso überraschter registrierte die nationale Presse Anfang der 1970er Jahre, dass die Indigenen im öffentlichen Leben wieder eine rege Präsenz zeigten. Mit Märschen und Versammlungen waren sie wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.4
Bis in die 1970er Jahr wurde davon ausgegangen, dass sich die Frage nach der Stellung der indigenen Bevölkerung innerhalb der nationalen Gesellschaft mit dem Eintritt in die moderne Gesellschaft von selbst lösen würde, d.h. sich die Indigenen an die neuen Gegebenheiten anpassen würden...
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die indigene Bevölkerung Kolumbiens
- 2.1 Demografische und kulturelle Fakten
- 2.2 Indigene Organisationen
- 2.2.1 Organisationsstruktur des Consejo Regional Indígena del Cauca
- 3. Autonomiebestrebungen
- 3.1 Territoriale Autonomie
- 3.2 Indigene Lebensproduktion
- 3.3 Indigene Bildung und Bildungsarbeit
- 4. Indigene als politischer Akteur
- 4.1 Die Voraussetzungen in der Verfassung von 1991
- 4.2 Politische Partizipation
- 4.3 Hindernisse und Herausforderungen
- 5. Die Realität des Bürgerkrieges
- 5.1 Beeinträchtigungen der indigenen Organisationsprozesse
- 5.2 Die Rolle des Staates
- 5.3 Indigene Initiativen zur Friedensschaffung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der sozialen und kulturellen Situation der indigenen Bevölkerung Kolumbiens im Zeitraum von 1970 bis heute. Der Fokus liegt auf den Bestrebungen der indigenen Bewegung um eine größere Autonomie und Selbstverwaltung sowie eine stärkere politische Partizipation innerhalb der Grenzen des kolumbianischen Staates. Die Arbeit untersucht die Faktoren, die diese Bestrebungen begünstigen oder hemmen, und betrachtet insbesondere die Rolle des Staates und die Auswirkungen des seit 40 Jahren andauernden Bürgerkrieges auf die indigene Bevölkerung.
- Autonomiebestrebungen der indigenen Bevölkerung
- Territoriale Autonomie und Selbstverwaltung
- Indigene Lebensproduktion und Kultur
- Politische Partizipation und Repräsentanz
- Der Einfluss des Bürgerkrieges auf die indigene Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der indigenen Bevölkerung Kolumbiens und erläutert den Kampf um Emanzipation, der bis heute andauert. Im zweiten Kapitel werden demografische und kulturelle Fakten sowie die wichtigsten indigenen Organisationen, wie der Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) und die Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), vorgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Autonomiebestrebungen der indigenen Bevölkerung, insbesondere der territorialen Autonomie, der indigenen Lebensproduktion und der ethnospezifischen Bildung. Im vierten Kapitel wird die Integration der indigenen Bewegung in das politische Leben Kolumbiens auf lokaler und nationaler Ebene betrachtet. Die Verfassung von 1991 wird als Meilenstein in der Anerkennung indigener Rechte und der Öffnung für politische Partizipation vorgestellt. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Auswirkungen des Bürgerkrieges auf die indigenen Organisationsprozesse und ihre Autonomiebestrebungen. Hier wird auch die Rolle des Staates und die Problematik der Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzungen diskutiert. Das Kapitel stellt auch einige indigene Initiativen zur Friedensschaffung vor, wie den zivilen Widerstand und den Dialog zwischen den Konfliktparteien.
Schlüsselwörter
Indigene Bevölkerung Kolumbiens, Autonomie, Selbstverwaltung, Territoriale Autonomie, Lebensproduktion, Bildung, politische Partizipation, Bürgerkrieg, Straflosigkeit, Friedensschaffung, CRIC, ONIC, Verfassung von 1991, ILO-Konvention 169.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann kämpft die indigene Bevölkerung Kolumbiens um Autonomie?
Der Widerstand begann bereits mit der spanischen Kolonisation vor 500 Jahren, die moderne Bewegung formierte sich jedoch verstärkt in den 1970er Jahren.
Welche Rolle spielt die Verfassung von 1991?
Sie war ein Meilenstein, da sie Kolumbien als pluriethnische Nation anerkannte und den Indigenen politische Partizipation und territoriale Rechte zusprach.
Was sind CRIC und ONIC?
Es sind zentrale indigene Organisationen: Der CRIC (Regionalrat der Indigenen von Cauca) und die ONIC (Nationale Indigene Organisation Kolumbiens).
Wie beeinflusst der Bürgerkrieg die indigene Bevölkerung?
Der Konflikt führt zu Vertreibung, Gewalt und der Störung indigener Organisationsprozesse, wobei Indigene oft zwischen die Fronten geraten.
Was fordert die indigene Bewegung unter „territorialer Autonomie“?
Die Anerkennung ihrer traditionellen Territorien (Resguardos) und das Recht auf Selbstverwaltung nach eigenen Gesetzen und Bräuchen.
- Citation du texte
- Manuela Paul (Auteur), 2007, Die soziale und kulturelle Situation der indigenen Bevölkerung Kolumbiens (1970 - 2007), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75469