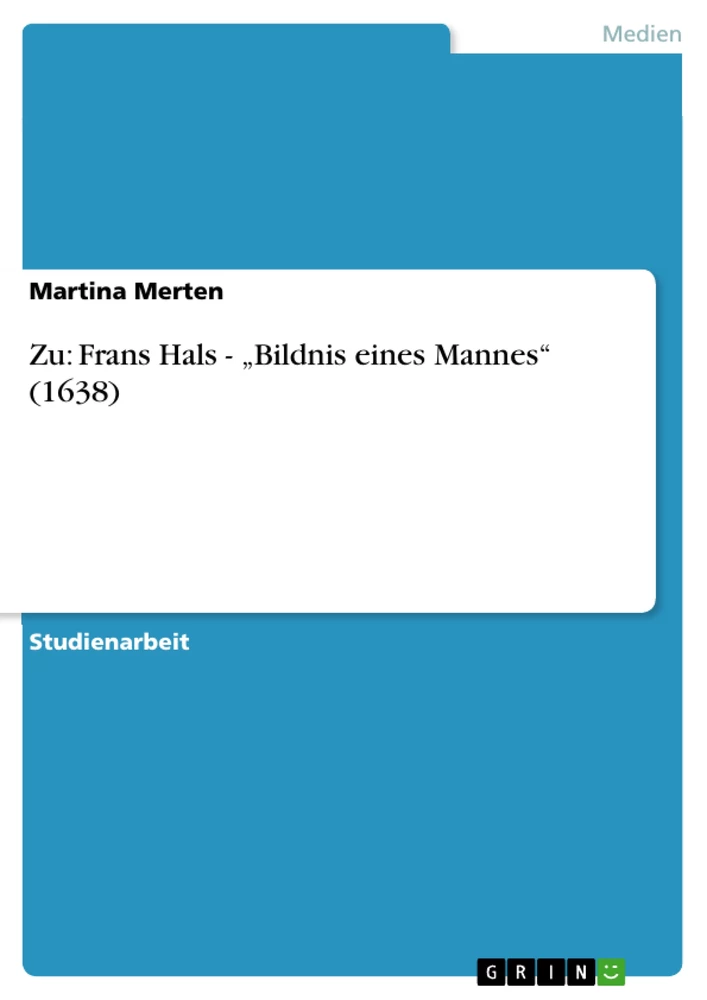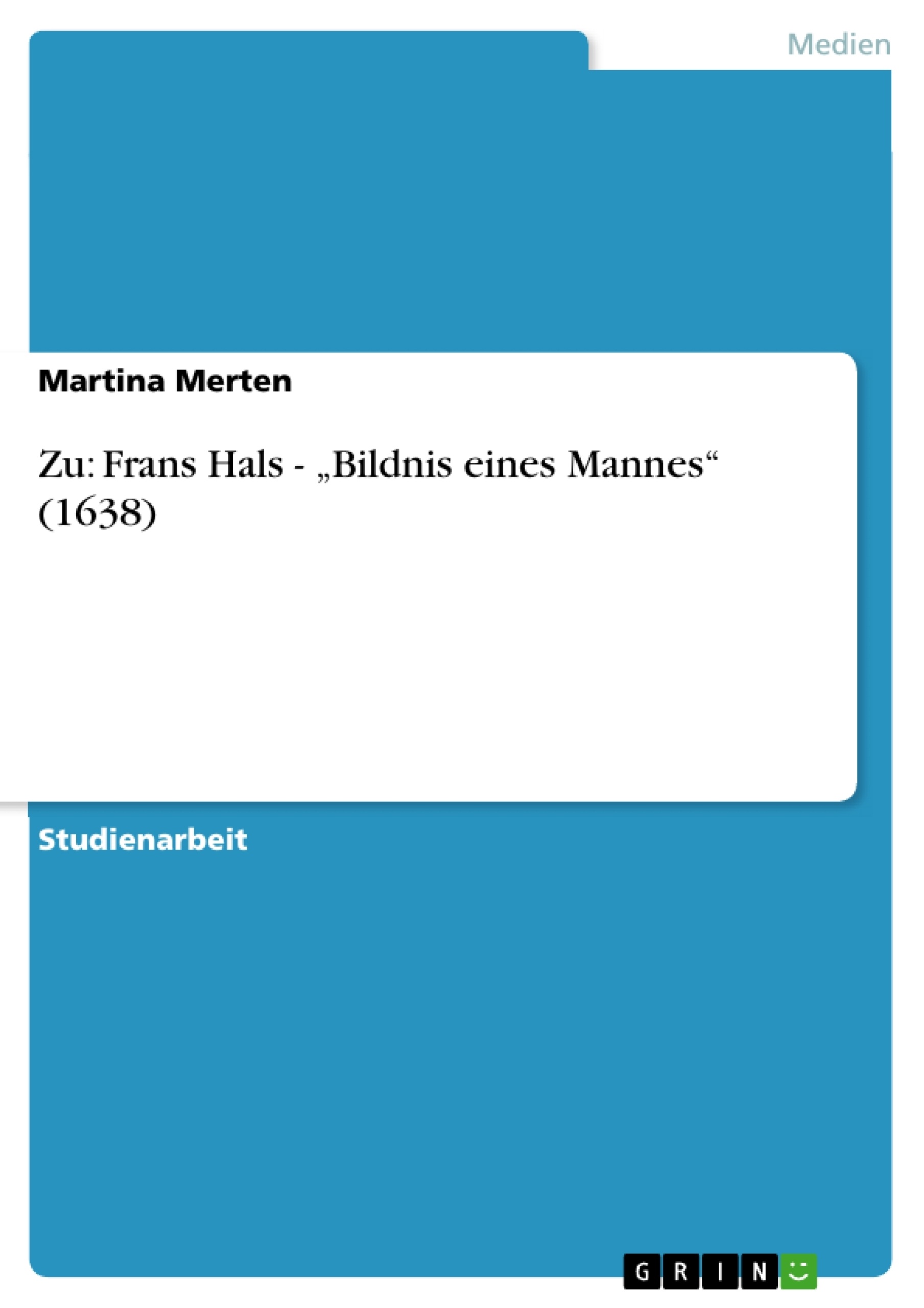Bis ins 19. Jahrhundert waren Hals Werke weitgehend unbekannt geblieben, obwohl sein Oeuvre zum Teil bis auf 500 Werke geschätzt wurde und sich in Porträts, Genredarstellungen und religiöse Darstellungen aufteilt. Dies mag damit zu begründen sein, daß seine Werke zur damaligen Zeit als fremdartige Erscheinung gelten mußten, da sie in ihrer Technik in der alten Malerei so gut wie keine Parallele haben.
Für die Wiederbelebung der Kunst der neuen holländischen Republik trat dabei insbesondere Theóphile Thoré (W. Bürger) ein, der in dieser Epoche seine eigenen republikaniischen Ideale gegründet sah und so neben Hals auch Jan Vermeer zu Weltruhm verhalf. Weitere genauere Studien, inbesondere die Dissertation Wilhelms von Bode „Frans Hals und seine Schule“ (1872) trugen zur Bekanntmachung maßgeblich bei, so daß Hals seit dieser Zeit anerkannt wurde und Einfluß auf die Strömungen von Realismus und Impressionismus, mit dem Hals in der technischen Behandlung von Form und Farbe in Beziehung steht, genommen hat.
Das Bild selbst ist in Hals Schaffensperiode von 1638/39 einzuordnen, in der mehrere Pendantbilder mit starker Zurückhaltung von formalen Mitteln und gedämpftem Duktus entstanden. Zugeordnet ist dem Bürgersmann das im selben Jahr gefertigte „Bildnis einer Frau“, welches dieselben Maße und Maltechnik aufweist. Da der Maler Peter Paul Rubens Hals bekannt war und beeindruckt hat, ist man irrtümlich bei den unbetitelten Porträts von Rubens und seiner ersten Frau ausgegangen.
Das Pendant, ein Frauenbild, welches eine rundliche, Lebensfreude ausstrahlende Bürgersfrau zeigt, stellt eine Verbindung in der Darstellungsweise, jedoch auch gleichzeitig einen interessanten charakteristischen Gegensatz dar. Dem Betrachter beziehen die Personen in ihren Kreis durch die einzig einander zugewandte Körperhaltung nicht mit ein. Nur die flüchtige Bewegung von Kopf und Augen zeugt für eine Aufmerksamkeit bezüglich des außenstehenden Betrachters.
Inhaltsverzeichnis
- I. Werkbeschreibung und Analyse
- II. Die Bedeutung des Porträts im Goldenen Zeitalter
- III. Die Porträtmalerei von Frans Hals
- IV. Die Rezeptionsgeschichte des Bildes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das Ölporträt „Bildnis eines Mannes“ von Frans Hals aus dem Jahr 1638. Ziel ist es, das Werk detailliert zu beschreiben und zu analysieren sowie dessen Bedeutung innerhalb der Porträtmalerei des Goldenen Zeitalters zu beleuchten.
- Werkbeschreibung und Analyse des Bildes
- Bedeutung des Porträts im niederländischen Goldenen Zeitalter
- Die Porträtmalerei von Frans Hals
- Die Rezeption des Bildes in der Kunstgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Werkbeschreibung und Analyse
Das Porträt zeigt einen Mann fortgeschrittenen Alters in vornehmer Bürgerstracht. Die Komposition ist durch eine überlegene Ruhe geprägt, die auf das neo-stoische Ideal der Tranquillitas verweist. Die Dreiviertelansicht betont die Individualität des Mannes. Das Bild ist in schwarz-braun-grauer Farbe gehalten, mit weißen und hautfarbenen Akzenten. Die Farbgestaltung verstärkt die individuellen Charaktermerkmale des Mannes. Die Inschrift „Aetat suae - Anno 1638“ auf der rechten Seite dokumentiert die Entstehungszeit des Werkes.
II. Die Bedeutung des Porträts im Goldenen Zeitalter
Das Porträt als Gattung war im Goldenen Zeitalter der Niederlande von großer Bedeutung. Es spiegelte den Reichtum und die gesellschaftliche Stellung der Bürger wider. Die Porträts des Goldenen Zeitalters zeichneten sich durch ihre Realitätsnähe und ihre Fokussierung auf die Individualität der Dargestellten aus.
III. Die Porträtmalerei von Frans Hals
Frans Hals war einer der bedeutendsten Porträtmaler des Goldenen Zeitalters. Seine Werke zeichnen sich durch ihre lebendige Pinselführung, die Dynamik der Komposition und die detaillierte Darstellung der Charaktermerkmale der Porträtierten aus.
Schlüsselwörter
Frans Hals, Porträtmalerei, Goldenes Zeitalter, niederländische Kunst, Werkbeschreibung, Analyse, Tranquillitas, Individualität, Komposition, Farbgestaltung, Rezeptionsgeschichte, 17. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Frans Hals und warum wurde er erst spät berühmt?
Frans Hals war ein bedeutender niederländischer Porträtmaler des 17. Jahrhunderts. Seine Technik galt lange als zu „fremdartig“, bis er im 19. Jahrhundert durch Forscher wie Thoré und Bode wiederentdeckt wurde.
Was zeichnet das „Bildnis eines Mannes“ (1638) aus?
Das Bild besticht durch eine zurückhaltende Farbgestaltung in Schwarz-Grau-Tönen und vermittelt das neo-stoische Ideal der Tranquillitas (Ruhe und Gelassenheit).
Gibt es ein Gegenstück (Pendant) zu diesem Gemälde?
Ja, das im selben Jahr entstandene „Bildnis einer Frau“. Beide Bilder sind in Maßen und Maltechnik identisch und zeigen ein bürgerliches Ehepaar.
Welchen Einfluss hatte Frans Hals auf spätere Kunstströmungen?
Seine lebendige Pinselführung und die Behandlung von Form und Farbe nahmen wesentlichen Einfluss auf den Realismus und den Impressionismus des 19. Jahrhunderts.
Was bedeutet die Inschrift „Aetat suae - Anno 1638“?
Sie gibt das Alter des Dargestellten zum Zeitpunkt der Entstehung im Jahr 1638 an und unterstreicht den dokumentarischen Charakter des Porträts.
Wie interagieren die Porträtierten mit dem Betrachter?
Die Figuren sind einander zugewandt und beziehen den Betrachter kaum ein; nur flüchtige Augenbewegungen deuten eine Aufmerksamkeit nach außen an.
- Quote paper
- M.A. Martina Merten (Author), 1999, Zu: Frans Hals - „Bildnis eines Mannes“ (1638), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75481