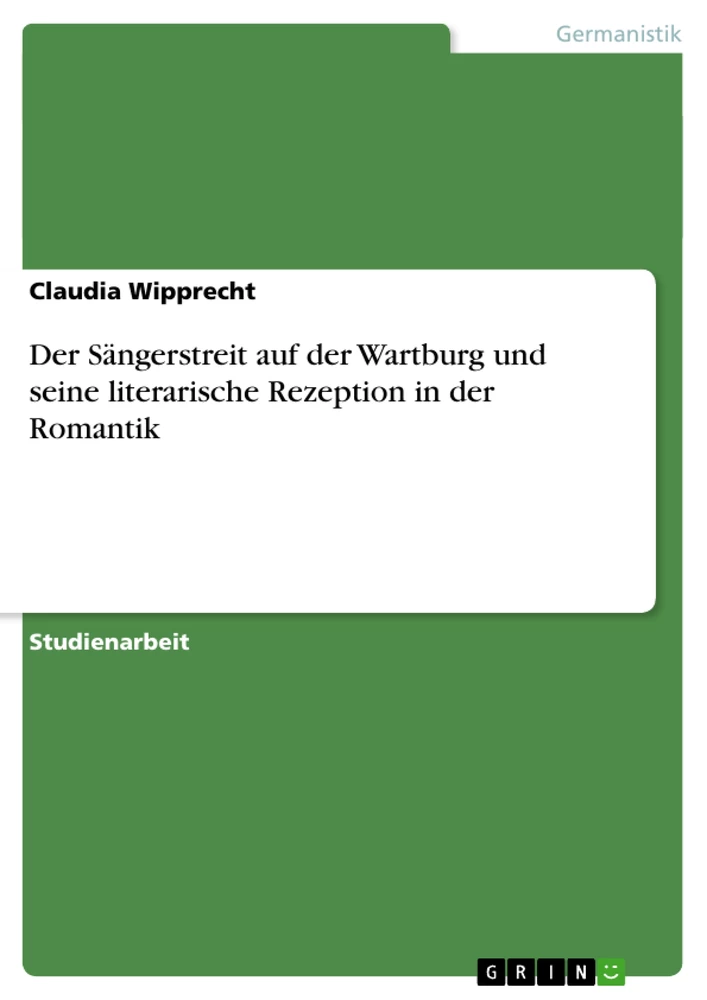Die Wartburg. Am Rande des Thüringer Waldes gelegen, war die Wartburg Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse und schwebt in einem Nimbus von Geschichtserinnerungen und Sagen. Troubadours und Minnesänger inspirierten die großen Minnehöfe Poitiers, Wiens und natürlich der Wartburg in der Zeit des Sängerkrieges. Es wurden ritterliche Standesideale besungen, wie Zucht und mâze, Treue im Lehen - und Frauendienst, als auch Schutzbereitschaft für Arme und Schwache. Auf der Wartburg wurden oft ritterliche Aventüren besungen (von Dellingshausen, 1983: 19).
Der Sängerstreit auf der Wartburg ist keine Volkssage, keine literarische Erfindung aus einem Guss, sondern weist eine äußerst komplizierte Stoffgeschichte auf. Es gibt wenige Überlieferungen über die Sänger des Wartburgkrieges, der die Wartburg so heraushob. Walther von der Vogelweide traf mutmaßlich 1206, anlässlich des Sängerstreits, erstmals auf Wolfram von Eschenbach. Beide klagten über die recht gemischte Gesellschaft, rühmten aber die Gastfreundschaft, Güte und Hilfsbereitschaft des Landgrafen, dem sie in ihren Liedern Dank sagten. Walthers politische Gesänge und Sprüche spiegeln den Kampf seiner Zeit wieder (ebd.: 20-21).
Die Sage um den Sängerstreit auf der Wartburg wurde noch Jahrzehnte später mündlich überliefert, bis zur schriftlichen Darstellung durch einen unbekannten Künstler im 13. Jahrhundert.
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeines zum Wartburgkrieg
- Die Sage um den Sängerstreit
- Die Sage um den Wartburgkrieg
- Das Fürstenlob
- Das Rätselspiel
- Romantik - Rezeption des Stoffes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem historischen Sängerstreit auf der Wartburg und seiner literarischen Rezeption in der Romantik. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung der Sage um den Sängerstreit, die historischen Hintergründe sowie die verschiedenen literarischen Bearbeitungen in der Romantik.
- Die historische Bedeutung des Wartburgkrieges
- Die Entstehung und Entwicklung der Sage um den Sängerstreit
- Die Rolle der Minnesänger und Troubadours
- Die literarische Rezeption des Sängerstreits in der Romantik
- Die Bedeutung der Sage für die deutsche Literatur und Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Allgemeines zum Wartburgkrieg
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Wartburg als Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse und Sagen. Es werden die ritterlichen Standesideale, die in der Zeit des Sängerkrieges auf der Wartburg besungen wurden, beleuchtet.
Die Sage um den Sängerstreit
Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Entwicklung der Sage um den Sängerstreit, die sich auf die historischen Fakten des 13. Jahrhunderts stützt. Es analysiert die Bedeutung von Chronikberichten, Miniaturen und Dichtungen wie dem Fürstenlob und dem Rätselspiel für die Überlieferung und Interpretation der Sage.
Das Fürstenlob
Dieses Kapitel analysiert das Fürstenlob, eine Strophengedicht aus dem 13. Jahrhundert. Es beschreibt den Streit zwischen den Sängern Ofterdingen, Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, die den besten Fürsten loben wollen. Das Kapitel befasst sich mit den Motiven des Streits, den verschiedenen Standpunkten der Sänger und dem Lobpreis des Landgrafen Hermann von Thüringen.
Das Rätselspiel
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Rätselspiel, einer weiteren Strophengedicht aus dem 13. Jahrhundert. Es beleuchtet den Streit der Sänger um die Lösung eines Rätsels und untersucht die verschiedenen Deutungen des Rätsels.
Schlüsselwörter
Wartburgkrieg, Sängerstreit, Minnesänger, Troubadours, Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Fürstenlob, Rätselspiel, Romantik, Rezeption, deutsche Literatur, deutsche Kultur.
- Quote paper
- Claudia Wipprecht (Author), 2006, Der Sängerstreit auf der Wartburg und seine literarische Rezeption in der Romantik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75520