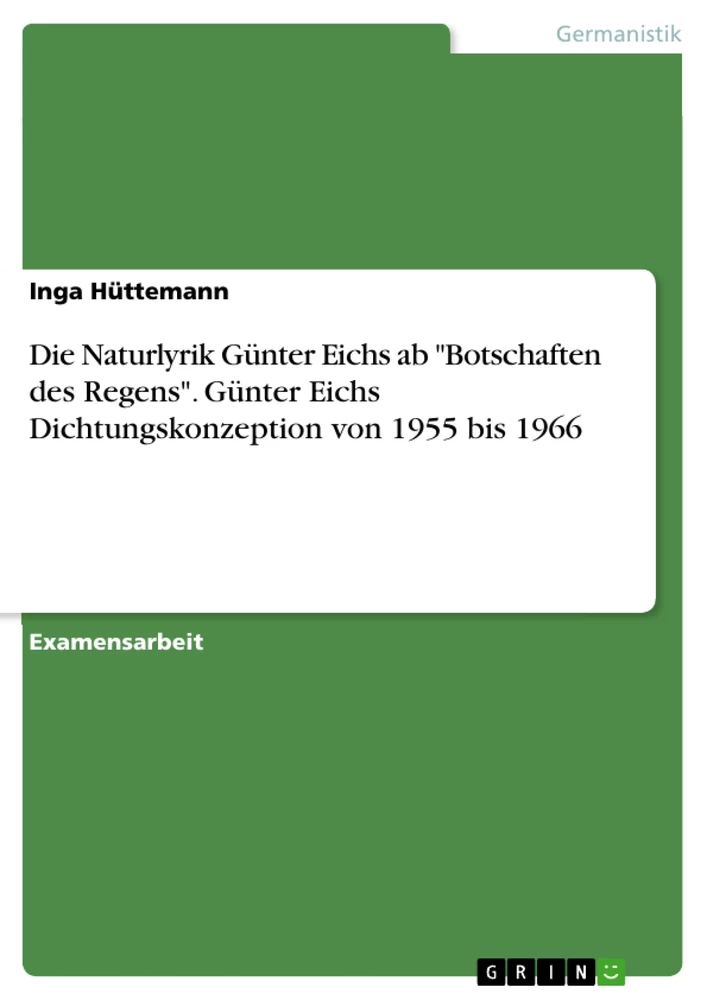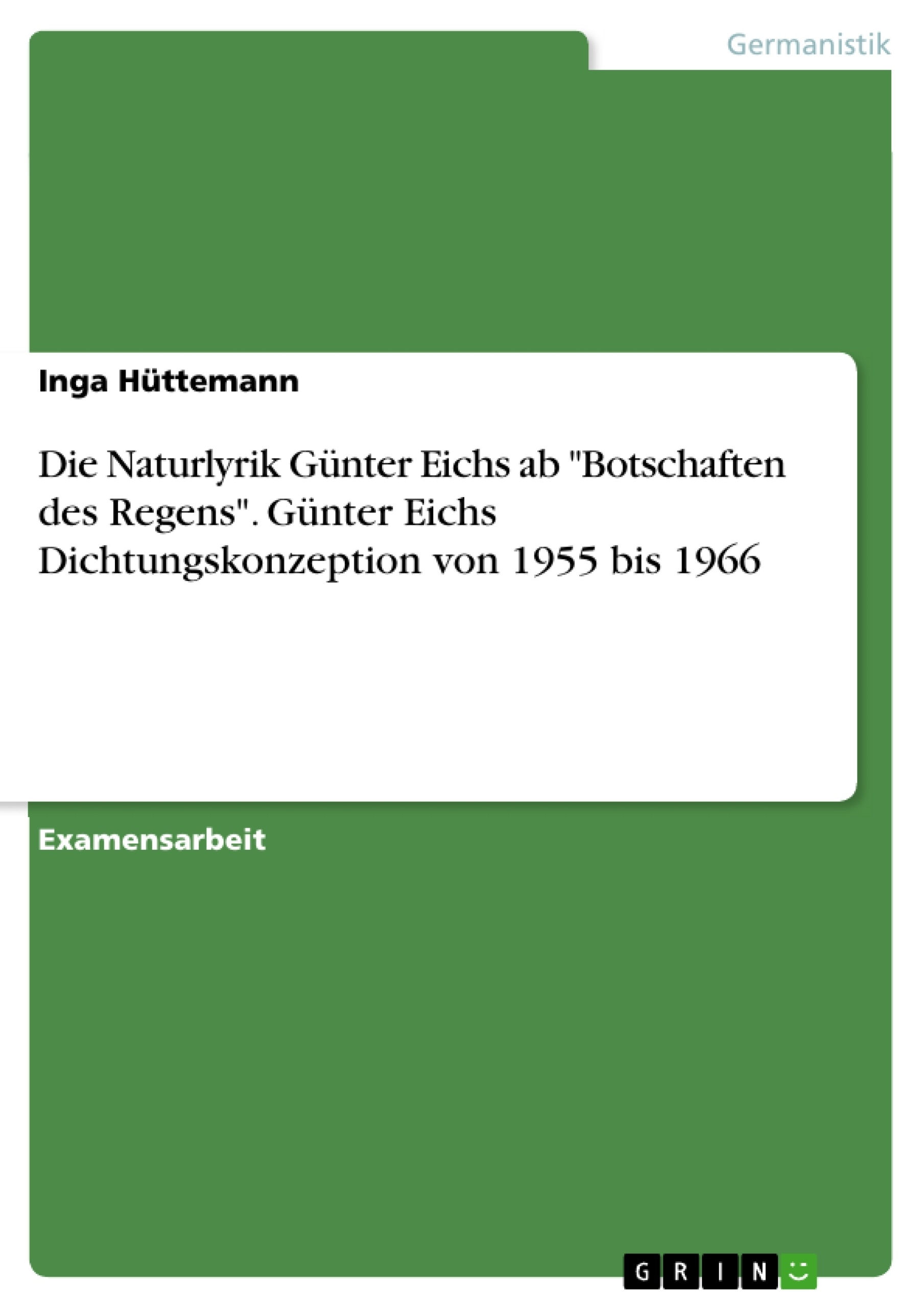Günter Eich zählt zu den weniger bekannten Dichetrn der Nachkriegszeit. Ganz selten nur taucht er mal im Deutschunterricht auf. Dort tritt er abwechselnd in einer der folgenden Rollen auf: Entweder wird er als der Vertreter der Kahlschlaglyrik dargestellt, was beispielhaft am Gedicht "Inventur" belegt wird. Oder aber er kommt als Repräsentant der modernen Naturlyrik daher.Diese Beschränkung ist einerseits verständlich, denn die Gedichte "Inventur" und "Latrine" einerseits und der Gedichtband Botschaften des Regens andererseits sind die Werke, die Eich bekannt gemacht haben (oder auch nicht), aber auch sehr bedauerlich. Denn mit dem Spätwerk wird gerade der Teil ausgeklammert, der Eich zu einem außergewöhnlichen und vor allem immer noch aktuellen Dichter macht. Die politische Brisanz seiner Georg-Büchner-Rede von 1959 könnte ohne weiteres auch auf heute übertragen werden.
Unter dem Titel "Die Naturlyrik Günter Eichs ab ‚Botschaften des Regens" liegt der Schwerpunkt der folgenden Arbeit auf der Dichtungskonzeption Eichs, wie sie sich in den poetologischen Gedichten der fünfziger und sechziger Jahre offenbart. Das Thema wird auf folgenden Untertitel eingegrenzt:
"Günter Eichs Dichtungskonzeption von 1955 bis 1966"
Diese Fragestellung wird mithilfe der Interpretation poetologischer Gedichte erarbeitet. Nähere Erläuterungen zum Vorgehen sind nachzulesen im Kapitel "Fragestellung und Methode".
Der erste Teil der Arbeit ist der Theorie und der Einordnung in den Zusammenhang gewidmet. Am Anfang stehen eine literaturgeschichtliche Einordnung der Lyrik Eichs und ein Überblick über die Dichtung Eichs bis 1949, bis zu dem Punkt, an dem die Untersuchung einsetzt. Außerdem gibt der Teil einen Überblick über den Forschungsstand und erläutert die Fragestellung dieser Arbeit und die Methode der Erarbeitung genauer. Der zweite Teil ist der eigentlichen Analyse und Interpretation gewidmet. Am Ende dieses Teils wird die chronolo-gische Entwicklung der Dichtungskonzeption aufgezeigt. Im Fazit werden die verschiedenen Teile zusammengeführt und es wird ein Ausblick gegeben auf mögliche weiterführende Untersuchungen.
Grundlage bilden die Texte in der Neuausgabe der vierbändigen Gesammelten Werke Eichs von 1991. Diese wird im laufenden Text durch die Angabe des Bandes und der Seitenzahl zitiert. Die Titel der Gedichtbände sind kursiv gesetzt, die Titel der einzelnen Gedichten stehen in Anführungszeichen.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A) Theoretischer Teil
- I. Günter Eich im Kontext der Lyrik nach 1945
- 1. Literaturgeschichtliche Einordnung: Naturlyrik nach 1945
- 2. Das lyrische Werk Eichs von den Anfängen bis 1949
- II. Forschungsstand
- III. Fragestellung und Methode
- B) Analytischer Teil
- I. Botschaften des Regens (1955)
- 1. Gesamtanalyse der Sammlung und Auswahl der Gedichte
- 2. „In anderen Sprachen“
- 3. „Botschaften des Regens“
- II. Zu den Akten (1964)
- 1. Gesamtanalyse der Sammlung und Auswahl der Gedichte
- 2. „Ohne Unterschrift“
- 3. „Zum Beispiel“
- III. Anlässe und Steingärten (1966)
- 1. Gesamtanalyse der Sammlung und Auswahl der Gedichte
- 2. „Und Wirklichkeit“
- IV. Entwicklung der Dichtung und Dichtungskonzeption von 1955 bis 1966
- 1. „Übersetzung“ – Dichtung als Mittel der Erkenntnis
- 2. Dichtung als Widerstand gegen das Einverständnis
- 3. Formale Aspekte: Entwicklung des lyrischen Sprachgebrauchs
- C) Fazit
- Entwicklung der Dichtungskonzeption Eichs von 1955 bis 1966
- Eichs Sprachskepsis und das Natursprachenkonzept der Romantik
- Eichs Dichtung als Ausdruck von politischem Engagement und Widerstand
- Formale und stilistische Aspekte der Lyrik Eichs
- Das Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit in Eichs Werk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Dichtungskonzeption Günter Eichs, wie sie sich in seinen Gedichtbänden "Botschaften des Regens", "Zu den Akten" und "Anlässe und Steingärten" von 1955 bis 1966 offenbart. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob Eichs Werk von einer Kontinuität geprägt ist oder ob sich ein Bruch in seiner Lyrik abzeichnet. Die Analyse konzentriert sich auf die poetologische Entwicklung Eichs, die sich in den Gedichten spiegelt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer literaturgeschichtlichen Einordnung der Lyrik Günter Eichs in den Kontext der deutschen Literatur nach 1945. Es wird der Einfluss der naturmagischen Schule, der Kahlschlaglyrik und des Hermetischen auf Eichs Werk beleuchtet.
Im Anschluss erfolgt eine Analyse der Gedichtbände "Botschaften des Regens", "Zu den Akten" und "Anlässe und Steingärten". Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung von Eichs Dichtungskonzeption und -sprache anhand der ausgewählten Gedichte "In anderen Sprachen", "Botschaften des Regens", "Ohne Unterschrift", "Zum Beispiel" und "Und Wirklichkeit".
Im Fazit werden die verschiedenen Teile der Arbeit zusammengeführt und die Ergebnisse zusammengefasst. Es wird ein Ausblick auf mögliche weiterführende Untersuchungen gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der deutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts, dem Werk Günter Eichs, der Naturlyrik, dem Natursprachenkonzept, der Romantik, der Dichtungskonzeption, dem politischen Engagement, dem Widerstand gegen das Einverständnis, der Sprachskepsis, der hermetischen Lyrik und der Veränderung von Form und Sprache.
- Quote paper
- Inga Hüttemann (Author), 2006, Die Naturlyrik Günter Eichs ab "Botschaften des Regens". Günter Eichs Dichtungskonzeption von 1955 bis 1966, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75528