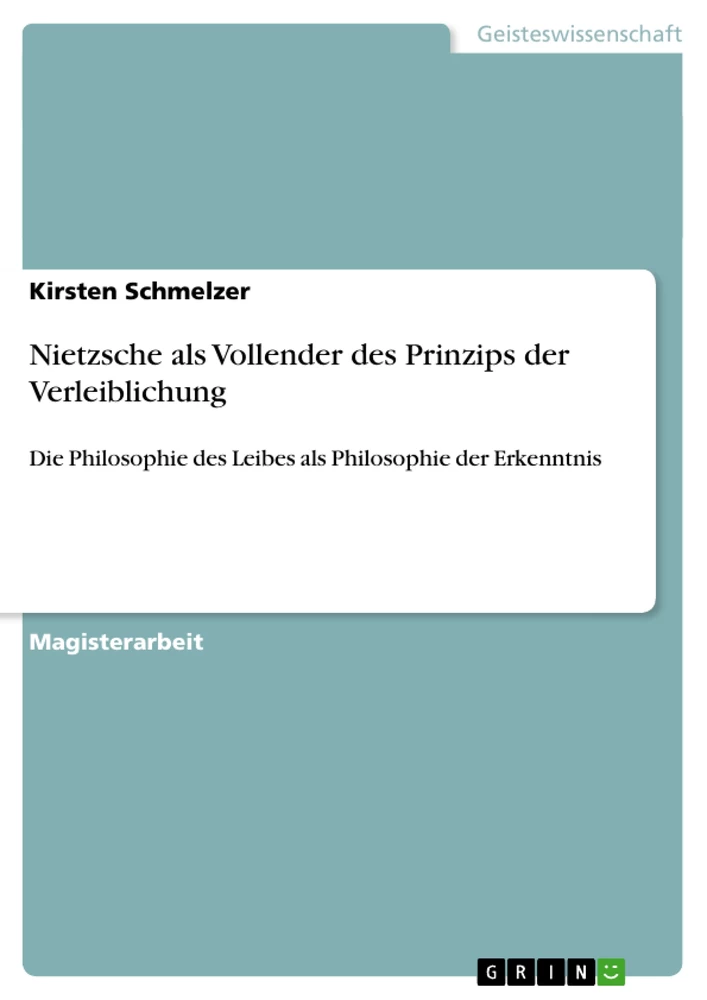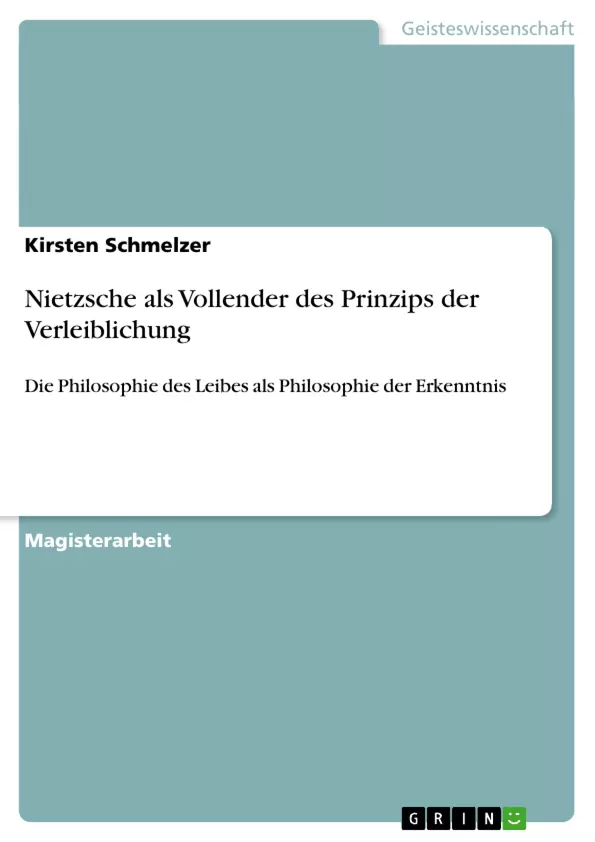Um verstehen zu können, warum im 19. Jahrhundert von einer Wende der Philosophie besonders durch Nietzsche und Schopenhauer gesprochen werden kann, muss zunächst ein Blick auf deren Vorläufer geworfen werden. So werden im ersten Teil die bestimmenden Strömungen des 18. bzw. 19. Jahrhunderts beschrieben sowie die Ansätze verschiedener Philosophen unter dem Aspekt der Veränderungen von Vergeistigung zu Verleiblichung. Diese Vorarbeit ist notwendig, um die Veränderung in der Philosophie und letztendlich die Bedeutung Nietzsches in diesem Paradigmenwechsel einschätzen zu können.
In diesem ersten Teil der Untersuchung fällt im zweiten Abschnitt ein besonderer Augenmerk auf Schopenhauer, da er zur Veränderung des seit Descartes dominierenden Leib-Geist-Verständnisses im Sinne des vergeistigten Menschen maßgeblich beigetragen hat, seine Schriften besonders vom jungen Nietzsche verehrt und rezipiert wurden und wahrscheinlich den größten Einfluss auf dessen Entwicklung philosophischer Gedanken hatte.
Nach einer Darstellung der zeitgeschichtlichen Einflüsse und besonders der bis dahin geltenden Vorherrschaft der Vernunftphilosophie sowie den bereits auftauchenden Rissen dieses zunächst anscheinend stabilen Vernunft-Fundaments, wird im zweiten Teil die Philosophie Nietzsches und dessen Stellung zum Leib betrachtet. Beginnend bei der Problematik einer solchen Untersuchung wird anschließend auf Nietzsches frühes Schaffen eingegangen, um abschließend im Spätwerk „Also sprach Zarathustra“ seine leibdominierte Philosophie mittels Stellen aus dem Nachlass zu belegen.
Um eine Bezeichnung wie „Vollender“ rechtfertigen zu können, muss auch die nach Nietzsche folgende anthropologisch-philosophische Entwicklung dargelegt werden. Im dritten Teil werden deshalb philosophische Ansätze aus dem 20. Jahrhundert aufgegriffen, um einen Eindruck der nach Nietzsche folgenden Philosophie und einer eventuellen Steigerung der Entwicklung der Verleiblichung zu bekommen.
Erst nach einer solchen Betrachtung des „Davor“ und „Danach“ wird in einer abschließenden Diskussion beantwortet, ob es gerechtfertigt ist, Nietzsche als „Vollender des Prinzips der Verleiblichung“ zu bezeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einflüsse am Beispiel von Arthur Schopenhauer
- Allgemeine beeinflussende Faktoren
- Zeitgeschichtliche Strömungen
- Die Ablehnung der Vernunftphilosophie
- Naturgefühl und positivistische Einschläge
- Spezielle Verknüpfungen zwischen Schopenhauer und Nietzsche
- Die Schopenhauersche Weltanschauung
- Nietzsche als Anhänger der Philosophie Schopenhauers
- DieAnerkennung der Leiblichkeit
- Allgemeine beeinflussende Faktoren
- Nietzsche – ein Philosoph des Leibes
- Der Problemhorizont
- Die Problematik der Begrifflichkeit
- Begrifflichkeit und Interpretation bei Nietzsche
- Das Problem der Leib-Geist-Dialektik
- Die Philosophie Nietzsches
- Das Apollinische und Dionysische
- Der umgedrehte Platonismus
- Die Illusion der Sprache
- Das Leib–Vernunft - Verhältnis
- Zarathustra und die Verächter des Leibes
- Die Rede von den Hinterweltlern
- Von den Verächtern des Leibes
- Piepersche Interpretation
- Gerhardtsche Interpretation
- Die Physiologie des Leibes anhand des Nachlasses
- Fazit der Betrachtung der Philosophie Nietzsches
- Der Problemhorizont
- Nietzsche als Vollender des Prinzips der Verleiblichung
- Rückblick aus dem 20. Jahrhundert
- Abschlussdiskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Vernunftphilosophie des 19. Jahrhunderts hin zu einer Philosophie des Leibes, wobei der Fokus auf Friedrich Nietzsches Schriften liegt. Dabei wird die Frage gestellt, ob Nietzsche als Vollender des Prinzips der Verleiblichung betrachtet werden kann.
- Die philosophische Wende von der Vergeistigung zur Verleiblichung im 19. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Arthur Schopenhauer als Wegbereiter der Leibphilosophie
- Die Interpretation von Nietzsches Philosophie als einer Philosophie des Leibes
- Die Rolle von Instinkten und Trieben in Nietzsches Anthropologie
- Die Rezeption und Weiterentwicklung der Leibphilosophie im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der einflussreichen Strömungen des 18. und 19. Jahrhunderts, die den Wandel von der Vernunftphilosophie hin zu einer Philosophie des Leibes vorbereiteten. Der Einfluss von Arthur Schopenhauer auf Nietzsche wird ausführlich beleuchtet, wobei die Schopenhauersche Welt als Wille und Vorstellung und Nietzsches Auseinandersetzung mit dem schopenhauerschen Pessimismus im Mittelpunkt stehen. Anschließend werden die zentralen Elemente von Nietzsches Philosophie des Leibes beleuchtet, insbesondere seine Kritik an der Vernunft, sein Verhältnis zum Dionysischen und seine Wertschätzung der Sinne. Abschließend wird die Frage, ob Nietzsche als Vollender des Prinzips der Verleiblichung betrachtet werden kann, anhand der philosophischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts und der Rezeption von Nietzsches Werk diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Vernunftphilosophie, Leibphilosophie, Verleiblichung, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Dionysisches, Wille zur Macht, Naturphilosophie, Triebe, Instinkte, philosophische Anthropologie, 20. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das „Prinzip der Verleiblichung“ bei Nietzsche?
Es beschreibt die philosophische Wende weg von der reinen Vernunft und Vergeistigung hin zur Anerkennung des Leibes, der Triebe und Instinkte als Basis des Menschseins.
Welchen Einfluss hatte Arthur Schopenhauer auf Nietzsche?
Schopenhauer war ein wichtiger Wegbereiter, da er mit seiner Metaphysik des Willens das Primat der Vernunft (Descartes) infrage stellte und die Leiblichkeit anerkannte.
Was sind das Apollinische und das Dionysische?
Zwei Grundprinzipien in Nietzsches Werk: Das Apollinische steht für Ordnung und Schein, das Dionysische für Rausch, Triebhaftigkeit und die schöpferische Urkraft des Lebens.
Wie wird der Leib in „Also sprach Zarathustra“ thematisiert?
Zarathustra spricht von den „Verächtern des Leibes“ und betont, dass der Geist nur ein Werkzeug des Leibes (der „großen Vernunft“) ist.
Warum wird Nietzsche als „Vollender“ bezeichnet?
Die Arbeit diskutiert, ob Nietzsche den Paradigmenwechsel zur Leibphilosophie so radikal vollzog, dass nachfolgende Strömungen des 20. Jahrhunderts darauf aufbauen mussten.
Was ist der „umgedrehte Platonismus“?
Dies beschreibt Nietzsches Umkehrung der platonischen Ideenlehre: Nicht die geistige Welt ist die wahre Realität, sondern die sinnlich erfahrbare, körperliche Welt.
- Quote paper
- Kirsten Schmelzer (Author), 2002, Nietzsche als Vollender des Prinzips der Verleiblichung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75554