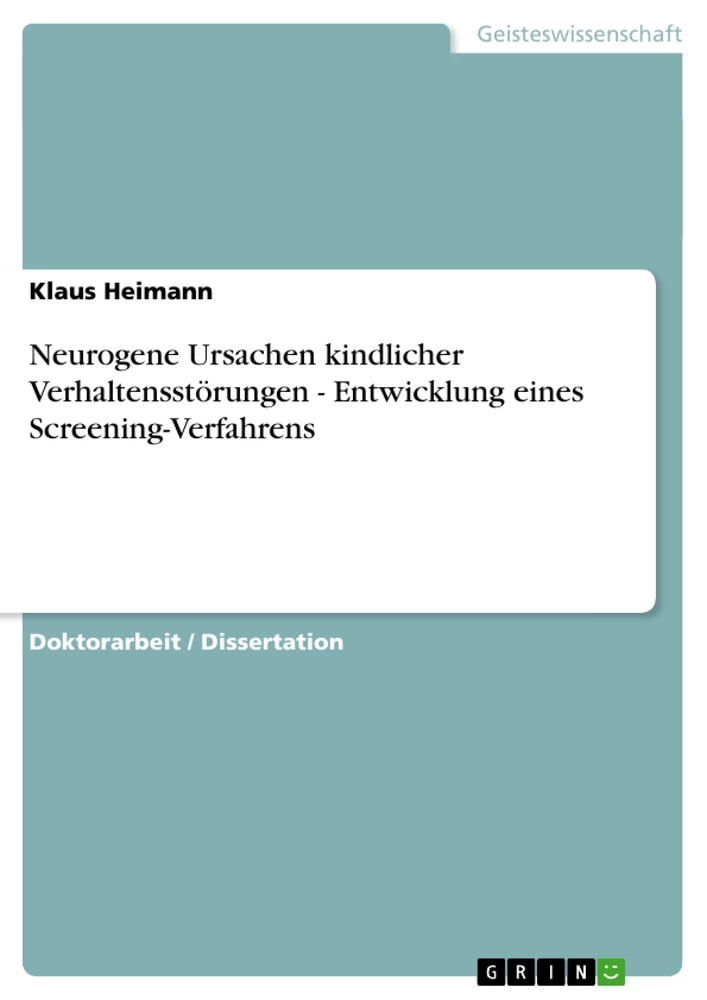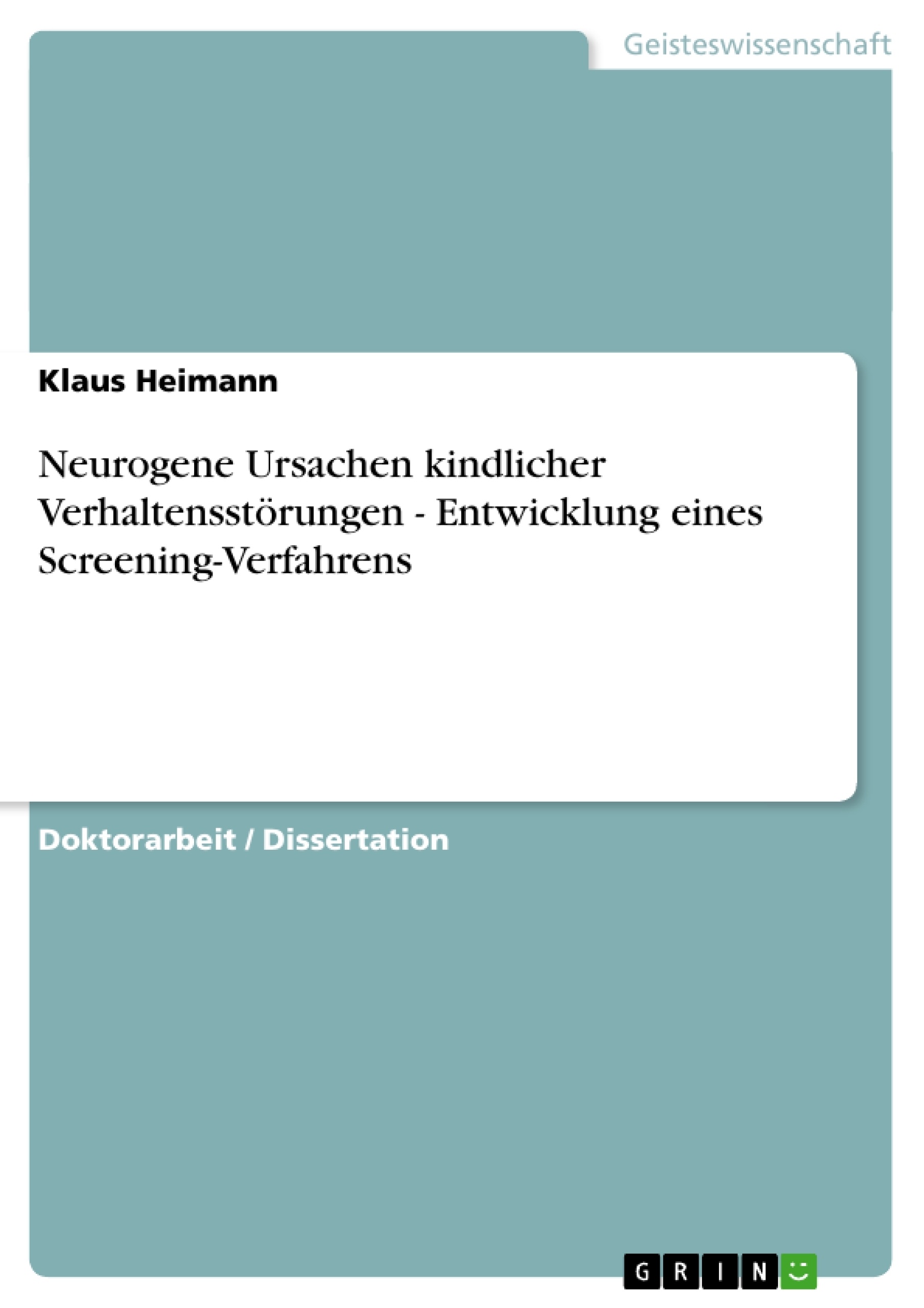Verhaltensstörungen werden bislang in der Regel als (ungünstiges) Erziehungsverhalten der primären Bezugspersonen, meist der Eltern, angesehen und nur selten mit hirnfunktionellen Störungen in Verbindung gebracht. Die vorliegende Arbeit versucht in drei empirischen Studien prä-, peri- und postnatale Risikofaktoren dahingehend zu überprüfen, inwieweit sie mit später in der Entwicklung auftretenden Verhaltensstörungen in einem Zusammenhang zu sehen sind.
In zwei Studien wird zum einen das Ausmaß der von Erzieherinnen eingeschätzten Verhaltensauffälligkeiten bei 458 Braunschweiger Kindergartenkindern erhoben und differenziert analysiert und zum anderen werden bei 423 Kindern einer Inanspruchnahmepopulation des Sozialpädiatrischen Zentrums Wolfsburg vorhandene Risikofaktoren auf mögliche Zusammenhänge mit Verhaltensstörungen überprüft.
Es konnte gezeigt werden, daß Erzieherinnen Verhaltensstörungen überwiegend nach einem psychosozialen Konzept beurteilen. Weiter konnte gezeigt werden, daß Risikofaktoren wie EPH-Gestose, Infektionen der Mutter, Medikamenteneinnahme während der Schwangerschaft, Geburtsart (insbesondere Sectio), Seh-, Hör- und Sprachstörungen die Wahrscheinlichkeit für spätere Verhaltensstörungen stark erhöhen. Für andere Risikofaktoren wie zum Beispiel Schädel-Hirn-Traumen, vorzeitige Wehen oder Schwangerschaftsblutungen, Alkohol, Nikotin, motorische Störungen war der Einfluß mittelstark bis schwach, während beispielsweise die Zahl der Schwangerschaften und das Alter der Mutter keinen Einfluß zu haben scheinen.
Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit wird ein Screening-Verfahren in Form eines Fragebogens vorgestellt, der die Wechselwirkungen zwischen Hirnfunktions- und Verhaltensstörungen im Kindergartenalter erfassen kann und der dazu beiträgt, frühzeitig eine entsprechende weitergehende Diagnostik zu veranlassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Deterministisch-hierarchisches Entwicklungskonzept
- Adaptives, holistisches Entwicklungskonzept
- Konzept der Entwicklungsbahnen
- Verhaltensstörungen
- Klassifikationssysteme
- Epidemiologie und Prävalenz von Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter
- Komorbidität
- Biologische Grundlagen
- Hirnfunktionsstörungen
- Neuropsychologische Grundlagen
- Motorische Störungen: Infantile Cerebralparese (ICP)
- Wahrnehmungsstörungen
- Störungen der visuellen Wahrnehmung
- Störungen der auditiven Wahrnehmung
- Sprachstörungen
- Risikofaktoren
- Pränatale Risikofaktoren
- Perinatale Risikofaktoren
- Postnatale Risikofaktoren
- Empirische Untersuchung
- Methode
- Empirische Untersuchung: Teil 1
- Empirische Untersuchung: Teil 2
- Empirische Untersuchung: Teil 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht neurogene Ursachen kindlicher Verhaltensstörungen und entwickelt ein Screening-Verfahren. Ziel ist es, Risikofaktoren zu identifizieren und ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zwischen neurologischen Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten zu schaffen.
- Neurogene Ursachen kindlicher Verhaltensstörungen
- Entwicklung eines Screening-Verfahrens
- Identifizierung pränataler, perinataler und postnataler Risikofaktoren
- Analyse von Hirnfunktionsstörungen und deren Auswirkungen auf das Verhalten
- Empirische Untersuchung zur Validierung des Screening-Verfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es verschiedene Entwicklungskonzepte – das deterministisch-hierarchische und das adaptive, holistische Konzept – vergleicht und das Konzept der Entwicklungsbahnen erläutert. Es dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung neurogener Ursachen kindlicher Verhaltensstörungen und bildet den Rahmen für die nachfolgenden Kapitel.
Verhaltensstörungen: Hier werden Klassifikationssysteme für Verhaltensstörungen vorgestellt, die Epidemiologie und Prävalenz dieser Störungen im Kindes- und Jugendalter beleuchtet und das Thema Komorbidität (das gleichzeitige Auftreten mehrerer Störungen) diskutiert. Der Abschnitt zu den biologischen Grundlagen legt den Fokus auf die neurobiologischen Prozesse, die Verhaltensstörungen zugrunde liegen können, und bereitet den Boden für die detaillierte Betrachtung der Hirnfunktionsstörungen in den folgenden Kapiteln.
Hirnfunktionsstörungen: In diesem Kapitel werden die neuropsychologischen Grundlagen von Hirnfunktionsstörungen erklärt. Es werden motorische Störungen wie die infantile Cerebralparese (ICP) und verschiedene Wahrnehmungsstörungen (visuell und auditiv) sowie Sprachstörungen im Detail beschrieben. Der Zusammenhang zwischen diesen Störungen und dem Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten wird herausgestellt.
Risikofaktoren: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Risikofaktoren für die Entstehung von Verhaltensstörungen, unterteilt in pränatale (vor der Geburt), perinatale (während der Geburt) und postnatale (nach der Geburt) Faktoren. Es werden diverse Beispiele wie Blutungen, Infektionen, Alkohol- und Nikotinkonsum, Geburtskomplikationen, Hirnblutungen, Schädel-Hirn-Traumata und weitere Faktoren detailliert beschrieben, um das komplexe Zusammenspiel von Risikofaktoren zu veranschaulichen und deren Einfluss auf die Entwicklung des Kindes zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Neurogene Ursachen, kindliche Verhaltensstörungen, Screening-Verfahren, Risikofaktoren, Hirnfunktionsstörungen, Entwicklungsdiagnostik, Prävalenz, Komorbidität, Infantile Cerebralparese (ICP), Wahrnehmungsstörungen, Sprachstörungen, pränatal, perinatal, postnatal.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Neurogene Ursachen kindlicher Verhaltensstörungen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die neurogenen Ursachen kindlicher Verhaltensstörungen und entwickelt ein Screening-Verfahren zur Identifizierung von Risikofaktoren. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen neurologischen Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten.
Welche Entwicklungskonzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das deterministisch-hierarchische und das adaptive, holistische Entwicklungskonzept und erläutert das Konzept der Entwicklungsbahnen. Diese Konzepte bilden die theoretische Grundlage der Untersuchung.
Welche Arten von Verhaltensstörungen werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Klassifikationssysteme für Verhaltensstörungen, beleuchtet deren Epidemiologie und Prävalenz im Kindes- und Jugendalter und diskutiert das Thema Komorbidität (gleichzeitiges Auftreten mehrerer Störungen).
Welche biologischen und neurologischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die neurobiologischen Prozesse, die Verhaltensstörungen zugrunde liegen können, und analysiert detailliert Hirnfunktionsstörungen, einschließlich motorischer Störungen (wie infantile Cerebralparese), Wahrnehmungsstörungen (visuell und auditiv) und Sprachstörungen.
Welche Risikofaktoren werden untersucht?
Die Arbeit differenziert Risikofaktoren in pränatale, perinatale und postnatale Faktoren. Es werden diverse Beispiele wie Blutungen, Infektionen, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum, Geburtskomplikationen, Hirnblutungen und Schädel-Hirn-Traumata detailliert beschrieben.
Wie sieht die empirische Untersuchung aus?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung in drei Teilen zur Validierung des entwickelten Screening-Verfahrens. Die genaue Methodik wird im entsprechenden Kapitel beschrieben.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Entwicklung eines Screening-Verfahrens zur frühzeitigen Erkennung von Risikofaktoren für Verhaltensstörungen bei Kindern, um frühzeitig Interventionen einzuleiten und das Verständnis der Zusammenhänge zwischen neurologischen Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neurogene Ursachen, kindliche Verhaltensstörungen, Screening-Verfahren, Risikofaktoren, Hirnfunktionsstörungen, Entwicklungsdiagnostik, Prävalenz, Komorbidität, Infantile Cerebralparese (ICP), Wahrnehmungsstörungen, Sprachstörungen, pränatal, perinatal, postnatal.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einführung (mit verschiedenen Entwicklungskonzepten), Verhaltensstörungen (inkl. Klassifikation, Epidemiologie und biologischen Grundlagen), Hirnfunktionsstörungen (mit Fokus auf motorische, Wahrnehmungs- und Sprachstörungen), Risikofaktoren (pränatal, perinatal, postnatal) und einer empirischen Untersuchung (in drei Teilen).
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels ist im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" enthalten.
- Quote paper
- Dr.phil. Klaus Heimann (Author), 2001, Neurogene Ursachen kindlicher Verhaltensstörungen - Entwicklung eines Screening-Verfahrens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75585