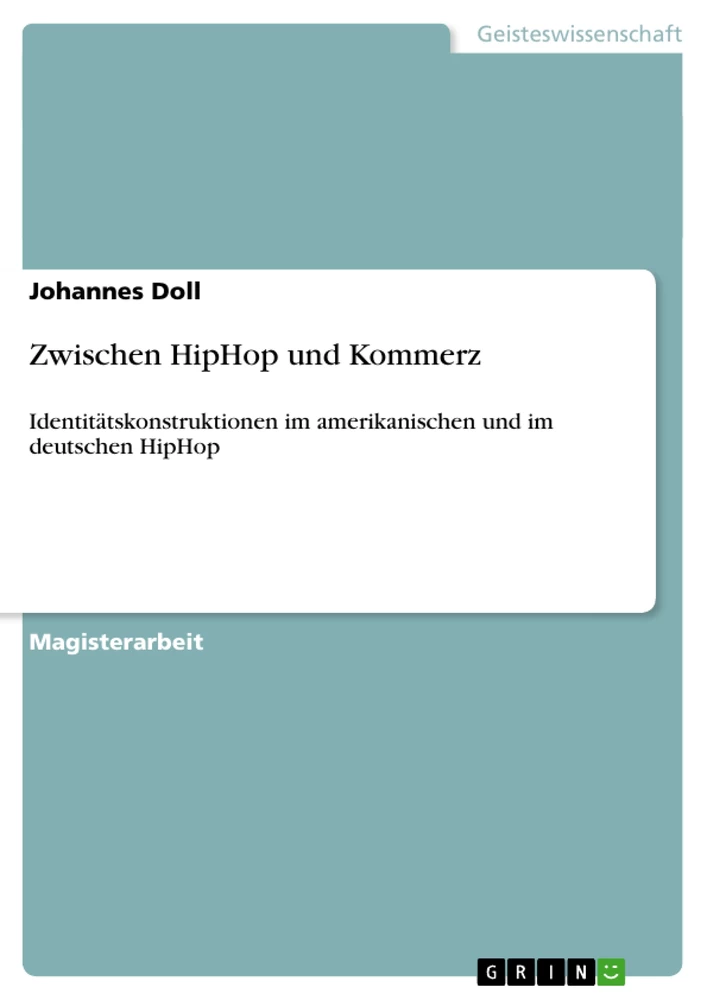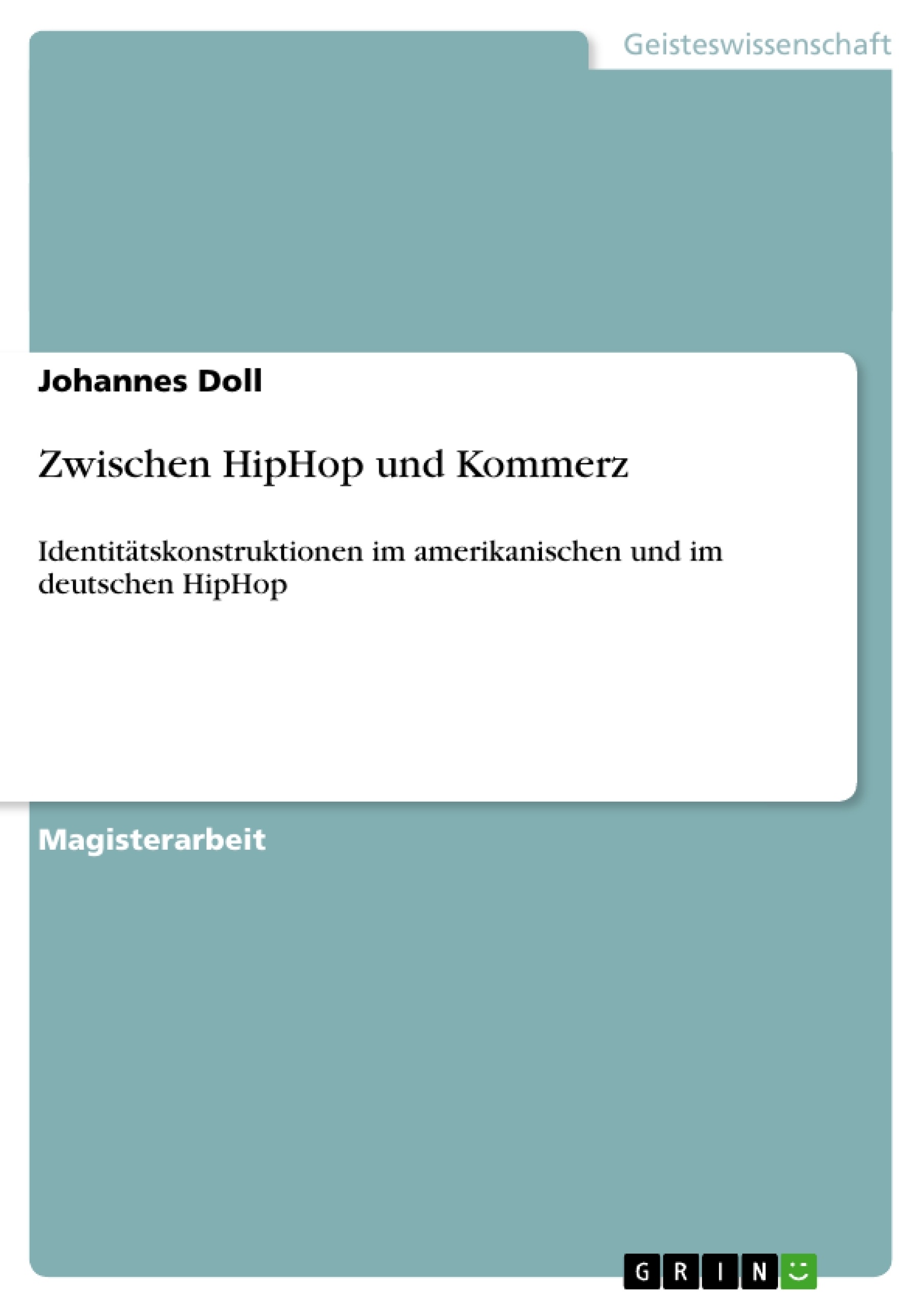Seit der Entstehung des HipHop in den 70er Jahren in der South Bronx, einem Stadtteil New Yorks, findet man diese Kultur nach über dreißigjähriger Geschichte nahezu global verbreitet wieder. Kaum ein anderes musikalisches Genre hat eine solche Persistenz auf dem Musikmarkt bewiesen wie Rap, die Musikform der HipHop-Kultur. Oft wurde sie für tot erklärt, doch Rap-Musik zeigte sich immer wieder fähig, neue Stile und Themen zu finden und auf diese Weise dem Puls der Zeit nahe zu bleiben. Nicht nur auf dem Musikmarkt ist die HipHop-Kultur allgegenwärtig, sondern auch als weitverzweigte Jugendkultur mit eigenen Ritualen, Normen und Praktiken: mittlerweile finden sich weltweit verschieden ausgeprägte HipHop-Kulturen, die ihre landesspezifischen Eigenheiten ausgebildet haben, aber auch immer noch aus dem gleichen Fundus schöpfen, und zwar aus der Herkunft und Geschichte dieser Musik und Kultur aus New York. Seitdem Rap-Musik in der Populärkultur eine wichtige Strömung darstellt, bewegt sich die HipHop-Kultur in dem Spannungsfeld zwischen dem Mainstream, dessen Teil sie mittlerweile ist, und dem Untergrund, aus welchem sie stammt. Anders ausgedrückt: HipHop bewegt sich zwischen Widerstand und Kommerz.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Aspekt der Identitätskonstruktion im musikalischen Medium der HipHop-Kultur, der Rap-Musik. Sie untersucht, wie sich verschiedene Gruppen und Einzelkünstler inszenieren, auf welches kulturelle Material sie zurückgreifen und welche Inhalte und Themen behandelt werden. Ich möchte hierzu auf verschiedene Vertreter verschiedener Zeitspannen und Örtlichkeiten innerhalb der Geschichte des HipHop zurückgreifen, sie in ihren Aussagen, Meinungen und ihren Selbstbildern vergleichen und Gemeinsamkeiten und Differenzen herausarbeiten. Ich werde mich auf einige Vertreter der amerikanischen und der deutschen HipHop-Szene beschränken, sie - mit Hilfe der Theorie von Manuel Castells - in ihren Texten untersuchen und herausstellen, wie sie sich selbst in ihren Liedern darstellen, gegen wen sie sich wenden und wofür sie einstehen bzw. welche Forderungen, Kritiken oder Anregungen sie ihren Zuhörern geben wollen - kurz gesagt: wie und woraus wird in diesen Liedern Identität konstruiert?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: „HipHop - And it don't stop...“
- 2. Über Castells' Theorie der drei Identitätsformen
- 2.1 Soziale Bewegungen
- 2.2 Die Konstruktion von Identität
- 2.3 Die drei Typen der Identitätsbildung
- 2.4 Identität in der Netzwerkgesellschaft
- 2.5 Einordnung in die zeitgenössische Identitätsforschung
- 2.6 Anmerkungen zum methodischen Vorgehen
- 2.7 Anmerkungen zur Auswahl und zur Notation der Texte
- 3. HipHop als Konstruktion von Identität – Definition, Paradigmen und Themen
- 3.1 HipHop als Form der Konstruktion von Identität
- 3.2 „Keep it real“ – Authentizität und Wettbewerb in der HipHop-Kultur
- 3.3 Themen der Rap-Musik
- 3.4 Definition von HipHop und Rap
- 4. US-amerikanischer HipHop
- 4.1 „Ich weiß noch genau, wie das alles begann...“ – Die Geburt der HipHop-Kultur
- 4.1.1 Die Bürgerrechtsbewegung und ihre Folgen
- 4.1.2 Das Ghetto
- 4.2 Kurze Geschichte des amerikanischen HipHop
- 4.2.1 Die Old School
- 4.2.1.1 Die erste Phase der Old School
- 4.2.1.2 Die Zulu Nation
- 4.2.1.3 Die zweite Phase der Old School
- 4.2.1.4 Von Old School zu New School
- 4.2.2 Die New School
- 4.2.2.1 Eastcoast
- 4.2.2.2 Westcoast
- 4.2.3 Die neunziger Jahre
- 4.2.4 Das neue Jahrtausend
- 4.3 Analysen amerikanischer Rap-Lieder
- 4.3.1 Grandmaster Flash and The Furious Five - „The Message“ (1982)
- 4.3.2 Public Enemy – „Fight the power“ (1989)
- 4.3.3 Tupac „Changes“ (1996)
- 4.3.4 Immortal Technique – „Harlem Streets“ (2003)
- 4.4 Vergleich der Identitätskonstruktionen im amerikanischen Rap
- 5. HipHop in Deutschland
- 5.1 Kulturimport aus den USA
- 5.2 Kurze Geschichte des deutschen HipHop
- 5.2.1 Die Alte Schule der deutschen HipHop-Kultur
- 5.2.2 Deutscher HipHop wird kommerziell erfolgreich
- 5.3 Analysen deutscher Rap-Lieder
- 5.3.1 Advanced Chemistry – „,Fremd im eigenen Land“ (1992)
- 5.3.2 Cora E. – „Schlüsselkind“ (1996)
- 5.3.3 Freundeskreis - „Esperanto“ (1999)
- 5.3.4 Brothers Keepers – „Adriano (Letzte Warnung)“ (2001)
- 5.3.5 Sido„Mein Block“ (2004)
- 5.4 Vergleich der Identitätskonstruktionen im deutschen Rap
- 6. Schlussbetrachtung: kollektive Identitätskonstruktionen im amerikanischen und im deutschen HipHop
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Erforschung von Identitätskonstruktionen im Kontext der HipHop-Kultur, insbesondere der Rap-Musik. Sie befasst sich mit der Frage, wie verschiedene Künstler und Gruppen in ihren musikalischen Darbietungen eigene Identitäten inszenieren und welche kulturellen Ressourcen sie dafür heranziehen. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Darstellung von Identität in amerikanischen und deutschen Rap-Texten.
- Die Rolle von HipHop als Medium der Identitätsbildung
- Die Bedeutung von Authentizität und Wettbewerb in der HipHop-Kultur
- Die Themen und Inhalte, die in Rap-Texten behandelt werden
- Der Einfluss von sozialem und politischem Kontext auf die Identitätskonstruktionen im HipHop
- Vergleichende Analyse der Identitätskonstruktionen im amerikanischen und deutschen Rap
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt die Relevanz von HipHop als kulturelle und musikalische Bewegung. Kapitel zwei widmet sich der Theorie der drei Identitätsformen von Manuel Castells und stellt sie als theoretischen Rahmen für die Analyse von Identitätskonstruktionen im HipHop vor. Kapitel drei beleuchtet die verschiedenen Aspekte von HipHop als Medium der Identitätsbildung, einschließlich der Themen, die in der Rap-Musik behandelt werden. Die Kapitel vier und fünf bieten detaillierte Analysen amerikanischer und deutscher Rap-Lieder und untersuchen die Identitätskonstruktionen, die in diesen Texten zum Ausdruck kommen.
Schlüsselwörter
HipHop, Rap-Musik, Identitätskonstruktion, Kultur, Soziale Bewegungen, Manuel Castells, Authentizität, Wettbewerb, amerikanischer HipHop, deutscher HipHop, Vergleichende Analyse, Musiktexte, Sozialer und politischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Identität im HipHop konstruiert?
Identität wird durch Texte, Inszenierung, Bezugnahme auf soziale Herkunft (z.B. das Ghetto) und den Wettbewerb um Authentizität geformt.
Was bedeutet "Keep it real"?
Es ist der zentrale Imperativ für Authentizität im HipHop: Künstler sollen ehrlich über ihr Leben berichten und ihre Wurzeln nicht verleugnen.
Welche Theorie von Manuel Castells wird angewendet?
Die Arbeit nutzt Castells' Theorie der drei Identitätsformen (legitimierende, Widerstands- und Projektidentität) zur Analyse der Rap-Texte.
Was unterscheidet US-Rap von deutschem Rap?
Während US-Rap stark in der Bürgerrechtsbewegung und der Ghetto-Erfahrung wurzelt, entwickelte der deutsche Rap eigene Themen wie Migrationserfahrungen ("Fremd im eigenen Land").
Warum ist HipHop ein Spannungsfeld zwischen Widerstand und Kommerz?
HipHop entstand als Subkultur des Widerstands, ist aber heute ein globaler Milliardenmarkt, was oft zu Konflikten um die Glaubwürdigkeit der Künstler führt.
- Quote paper
- Johannes Doll (Author), 2006, Zwischen HipHop und Kommerz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75629