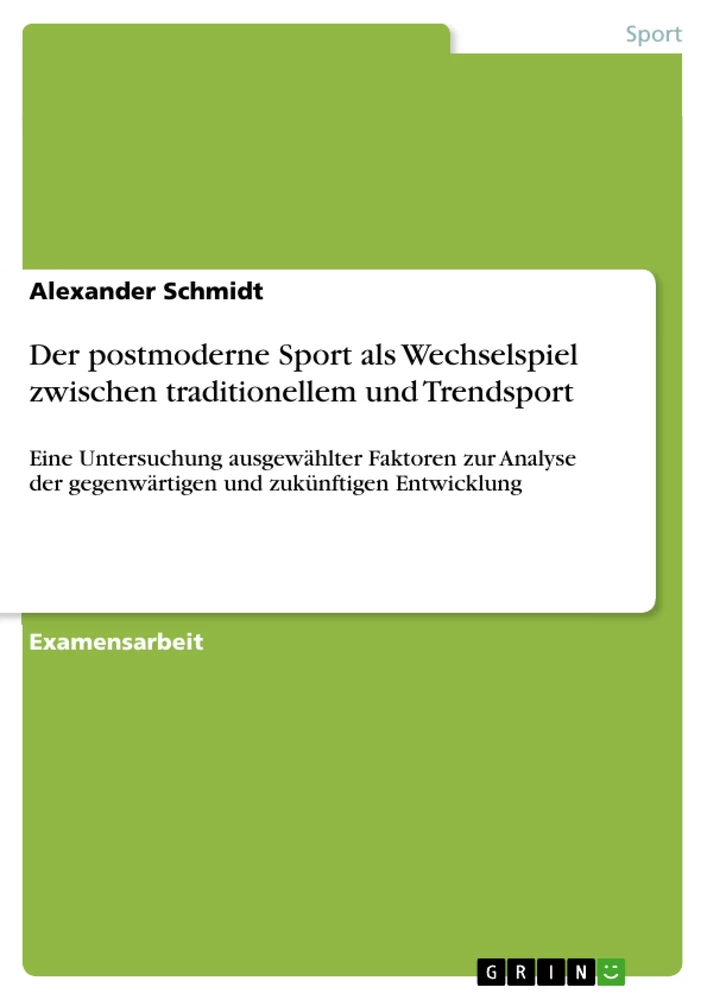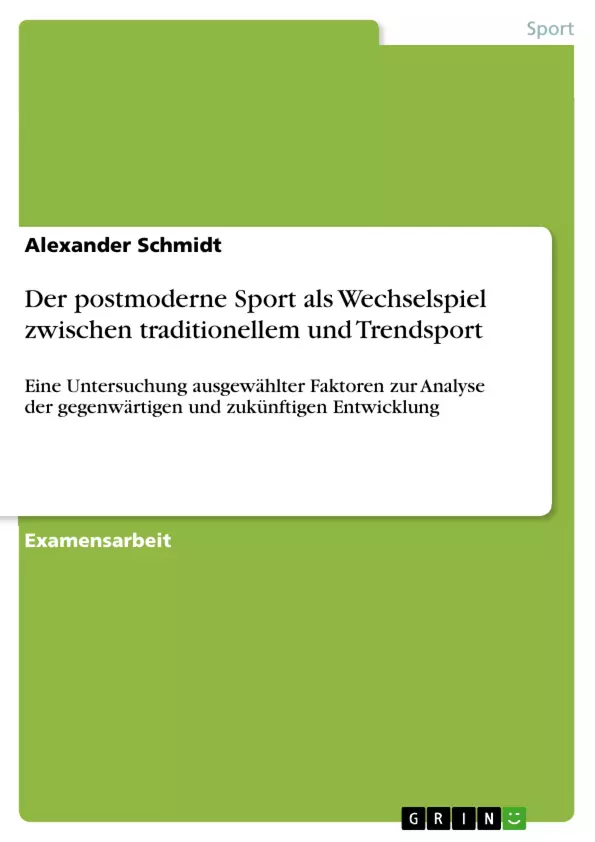„Gottlieb Daimler sagte voraus, dass die weltweite Nachfrage an Kraftfahrzeugen eine Million nicht überschreiten werde, weil es einen Mangel an verfügbaren Chauffeuren geben würde. Albert Einstein schrieb 1932, dass es nicht das geringste Anzeichen dafür gebe, dass jemals Atomenergie entwickelt werden könnte. Und Wilbur Wright bezweifelte 1901, dass es die Menschen in den nächsten 50 Jahren schaffen könnten, sich mit einem Metallflugzeug in die Luft zu erheben. Nur zwei Jahre später gelang ihm selbst der erste Motorflug“ (Wopp, 2006, S.9).
Die Frage nach dem „Was werden wir morgen tun?“ beschäftigt viele Köpfe und breitet sich auf alle Bereiche des Lebens, der Wissenschaft etc. und auch auf den Sport aus. Die Antwort auf diese Frage fällt relativ leicht, weil es um Planungen für den nächsten Tag geht. Je größer jedoch der Zeithorizont wird, umso ungenauer werden die Prognosen. Bezogen auf den Sport bedeutet dies, dass das Individuum zwar weiß, was es in absehbarer Zeit tun und lassen wird, doch niemand kann Prognosen über weit vorausliegende Handlungsmuster im Sport geben. Fakt ist jedoch, dass sich der Sport seit seiner Ausübung im ständigen Wandel befindet. Der Stellenwert des Sports im Leben der Menschen ist – im Vergleich zur stetig gestiegenen Freizeit – bereits bis heute überproportional angewachsen. Stand Mitte des 20. Jahrhunderts noch die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit im Zentrum der Freizeitgestaltung, haben sich heute die Akzeptanzwerte des Freizeitsports deutlich erhöht. Der oft propagierte Wertewandel, der in der Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges spürbar war, hatte auch Auswirkungen auf den Sport, der in seinem Verständnis und seiner Bedeutung ebenfalls einem Wandel unterlag. Sport im heutigen Sinne existierte zur damaligen Zeit (Ende der 40er und Mitte der 50er Jahre) nicht. Die Dominanz der Arbeit rückte den Sport ins Abseits und machte ihn bedeutungslos. Im Zuge des „Wirtschaftswunders“ der 50er Jahre waren erste Veränderungen im Hinblick auf das Konsum- und Freizeitverhalten zu erkennen. Jedoch diente der aufkommende „Bewegungsdrang“ eher der Wiederherstellung der Arbeitskraft und -moral.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 2. DER BEGRIFF DER POSTMODERNE
- 2.1. Entstehung und Entwicklungsgeschichte der Postmoderne
- 2.1.1 Der Begriff der Ambivalenz
- 2.2 Welschs Postmoderneauffassung
- 2.1. Entstehung und Entwicklungsgeschichte der Postmoderne
- 3. DER POSTMODERNE SPORT
- 3.1. Allgemeine Merkmale von Trendsport nach Schwier
- 3.1.1 Modell der Genese von Trendsportarten
- 3.1.2 Moderner Sport – Postmodern oder nur Tendenzen?
- 3.1.3 Trendsportarten
- 3.1.4 Trendsportarten – Eine Annäherung aus etymologischer Sicht
- 3.1.5 Trendsportarten und Trendsportforschung in der Sportwissenschaft
- 3.1.6 Trendsportarten – Annäherung über Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren
- 3.2. Traditioneller Sport
- 3.2.1 Begriffsbestimmung
- 3.2.2 Die Entwicklung des Sports
- 3.2.3 (Traditioneller) Sport in Deutschland – Von der Aufklärung bis zur Gegenwart
- 3.2.4 Der DOSB und seine Vereine
- 3.2.5 Der Sportverein - Strukturbesonderheiten
- 3.2.6 Der Sportverein – Bedeutung und Funktion
- 3.1. Allgemeine Merkmale von Trendsport nach Schwier
- 4. DAS WECHSELSPIEL VON TRADITIONELLEM UND TRENDSPORT
- 4.1 Sportökonomie und Organisationsstruktur
- 4.2 Großveranstaltungen/Events
- 4.3 Handlungen, Sportformen und Sportarten
- 4.4 Leistungsprinzip
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des Sports im Kontext der Postmoderne. Ziel ist es, das Wechselspiel zwischen traditionellem und Trendsport zu untersuchen und anhand ausgewählter Faktoren die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung des Sports zu analysieren.
- Die Merkmale der Postmoderne und ihre Auswirkungen auf den Sport
- Die Charakteristika von Trendsportarten und ihre Abgrenzung vom traditionellen Sport
- Die Rolle von Sportökonomie und Organisationsstruktur im Wandel
- Der Einfluss von Großveranstaltungen/Events auf die Entwicklung des Sports
- Das Verhältnis von Leistungsprinzip und Sportkultur im postmodernen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und erläutert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff der Postmoderne, ihrer Entstehung und Entwicklungsgeschichte sowie mit Welschs Postmoderneauffassung. Kapitel 3 untersucht den postmodernen Sport, indem es allgemeine Merkmale von Trendsportarten nach Schwier sowie den traditionellen Sport in Deutschland beleuchtet. Kapitel 4 analysiert das Wechselspiel von traditionellem und Trendsport in den Bereichen Sportökonomie, Großveranstaltungen/Events, Handlungen/Sportformen/Sportarten sowie dem Leistungsprinzip.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Postmoderne, Trendsport, traditioneller Sport, Sportökonomie, Organisationsstruktur, Großveranstaltungen/Events, Leistungsprinzip, Sportkultur. Weitere wichtige Begriffe sind Ambivalenz, Genese von Trendsportarten, Sportverein, DOSB, Sportwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schmidt (Autor:in), 2007, Der postmoderne Sport als Wechselspiel zwischen traditionellem und Trendsport , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75670