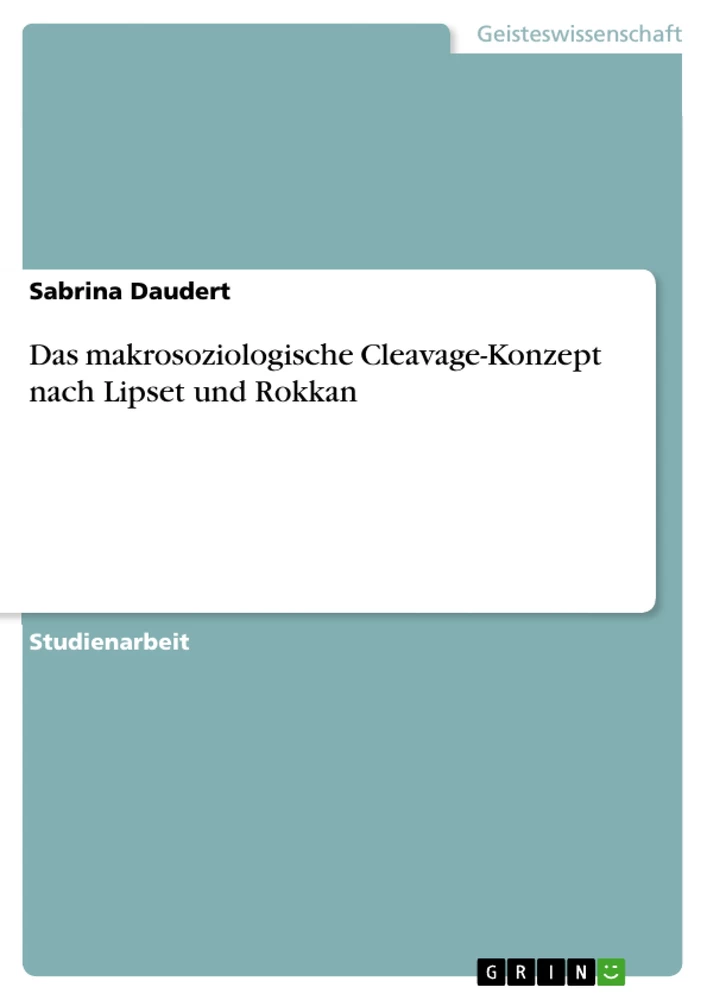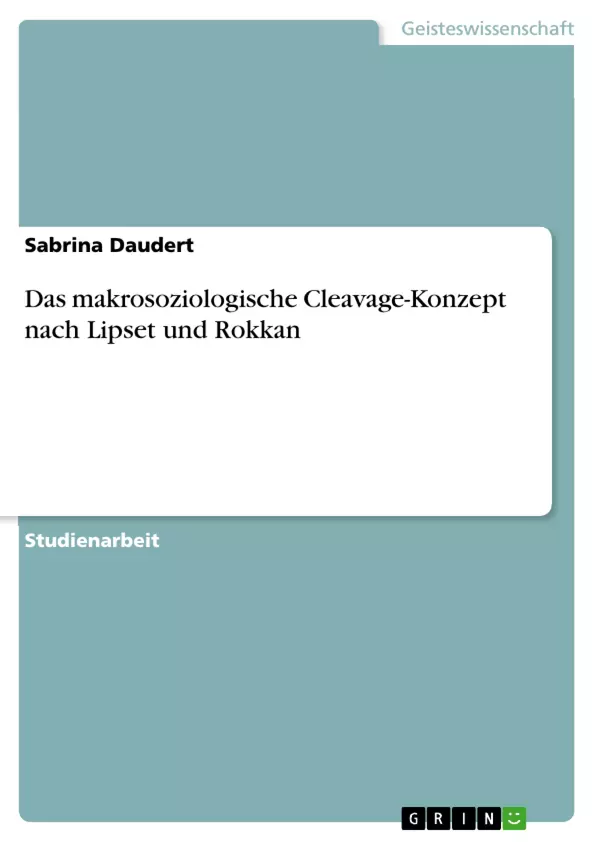Die empirische Wahlforschung beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, warum Parteien und Parteiensysteme entstehen. Mit einem Fokus auf die Auswirkungen von Entscheidungsprozessen auf die Makroebene sind diesbezüglich zunächst zwei Ansätze zu nennen. Der stratifikationstheoretische Ansatz konzentriert sich auf sozio-strukturelle Faktoren und der institutionelle Ansatz auf parteipolitische. Aus der Einseitigkeit dieser beiden Konzepte resultierte der Cleavage-Ansatz von Lipset und Rokkan. Dieser wurde im Rahmen einer „historisch-genetische[n] Rekonstruktion der Entstehung von Parteiensystemen in westeuropäischen Demokratien“ entwickelt. Cleavages werden hier interpretiert als soziale Konflikt- oder Spannungslinien, die zwischen Individuen, sozialen Gruppen oder gesellschaftlichen Organisationen verlaufen.
Die nachstehende Arbeit setzt sich mit der ursprünglichen Cleavage-Theorie, aber auch mit Weiterentwicklungen wie dem Entstehen neuer Konflikte auseinander. Es soll geklärt werden, was die historischen Ursprünge stabiler gesellschaftlicher Spannungslinien sind und welche Bedingungen für die Bildung von Parteien anhand gesellschaftlicher Spannungslinien existieren. Des Weiteren soll die mögliche Entwicklung der Parteisysteme seit ihrer Konsolidierung betrachtet werden. Abschließend erfolgt eine Einordnung Deutschlands in das Cleavage-Konzept.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundannahmen bei Lipset & Rokkan
- Das Cleavage-Konzept
- Wichtige historische Entwicklungen in Europa und deren Bedeutung für gesellschaftliche Konflikte
- Freezing, Dealignment und Realignment
- Cleavages im deutschen Parteiensystem
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Cleavage-Konzept von Lipset und Rokkan, das die Entstehung von Parteiensystemen in westeuropäischen Demokratien aus historisch bedingten gesellschaftlichen Konfliktlinien erklärt. Die Arbeit untersucht die historischen Ursprünge dieser Spannungslinien und die Bedingungen für die Bildung von Parteien anhand dieser Konfliktlinien. Zudem beleuchtet sie die mögliche Entwicklung der Parteisysteme seit ihrer Konsolidierung und ordnet das deutsche Parteiensystem im Rahmen des Cleavage-Konzepts ein.
- Die historischen Ursprünge stabiler gesellschaftlicher Spannungslinien
- Die Bildung von Parteien anhand gesellschaftlicher Spannungslinien
- Die Entwicklung der Parteisysteme seit ihrer Konsolidierung
- Das deutsche Parteiensystem im Rahmen des Cleavage-Konzepts
- Weiterentwicklungen des Cleavage-Konzepts und das Entstehen neuer Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der empirischen Wahlforschung und die Entstehung von Parteiensystemen ein. Sie stellt den Cleavage-Ansatz als eine Antwort auf die einseitigen stratifikationstheoretischen und institutionellen Ansätze vor und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit.
- Das Kapitel "Grundannahmen bei Lipset & Rokkan" erläutert die Grundannahmen des Cleavage-Konzepts, insbesondere die Funktionen von Parteien als „alliances in conflicts over policies and value commitments“.
- Das Kapitel "Das Cleavage-Konzept" erklärt die strukturellen und institutionellen Aspekte des Cleavage-Konzepts, die das Zusammenspiel von sozialer Stratifikation, Politik und gesellschaftlichen Institutionen berücksichtigen. Es beschreibt die wichtigsten Merkmale von Cleavages und unterscheidet zwischen sozialen und politischen Cleavages.
- Das Kapitel "Wichtige historische Entwicklungen in Europa und deren Bedeutung für gesellschaftliche Konflikte" befasst sich mit den historischen Entwicklungen in Europa, die zu den wichtigsten Cleavages führten, wie z.B. die Industrialisierung, die Urbanisierung und die Entwicklung des Nationalstaates.
- Das Kapitel "Freezing, Dealignment und Realignment" analysiert die Veränderungen der Parteisysteme im Laufe der Zeit, die durch Prozesse des „Freezing“, „Dealignment“ und „Realignment“ geprägt sind. Es geht dabei um die Stabilität der Cleavages, die Erosion der traditionellen Konfliktlinien und das Aufkommen neuer Konfliktfelder.
Schlüsselwörter
Das Cleavage-Konzept, Parteiensysteme, Wahlforschung, gesellschaftliche Konfliktlinien, historische Entwicklungen, Industrialisierung, Urbanisierung, Nationalstaat, Freezing, Dealignment, Realignment, Deutschland.
- Quote paper
- Sabrina Daudert (Author), 2006, Das makrosoziologische Cleavage-Konzept nach Lipset und Rokkan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75712