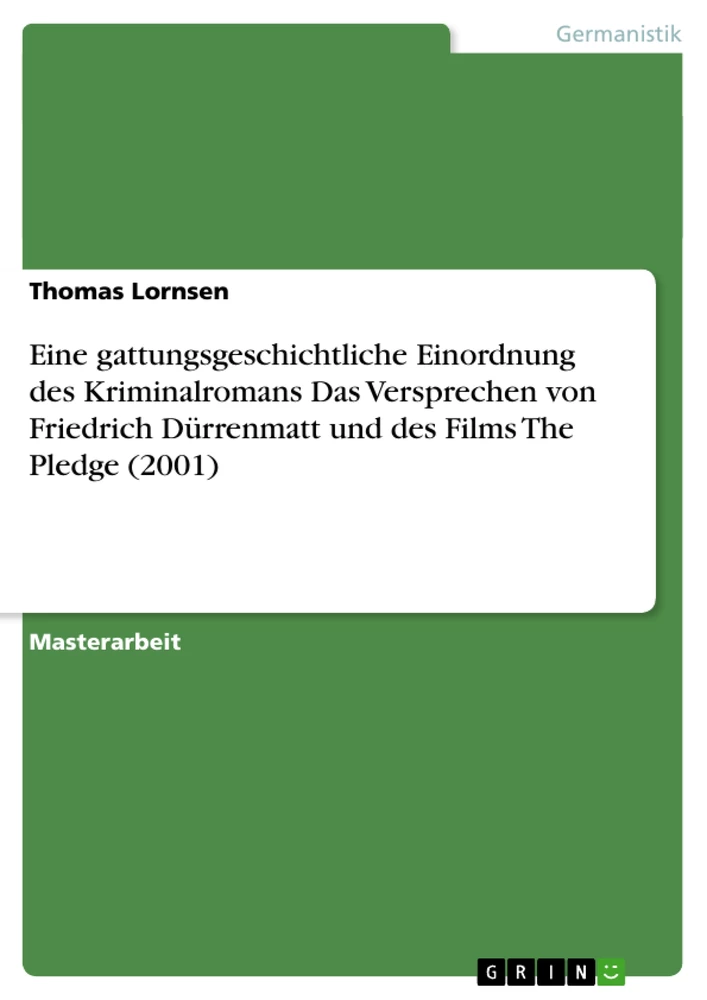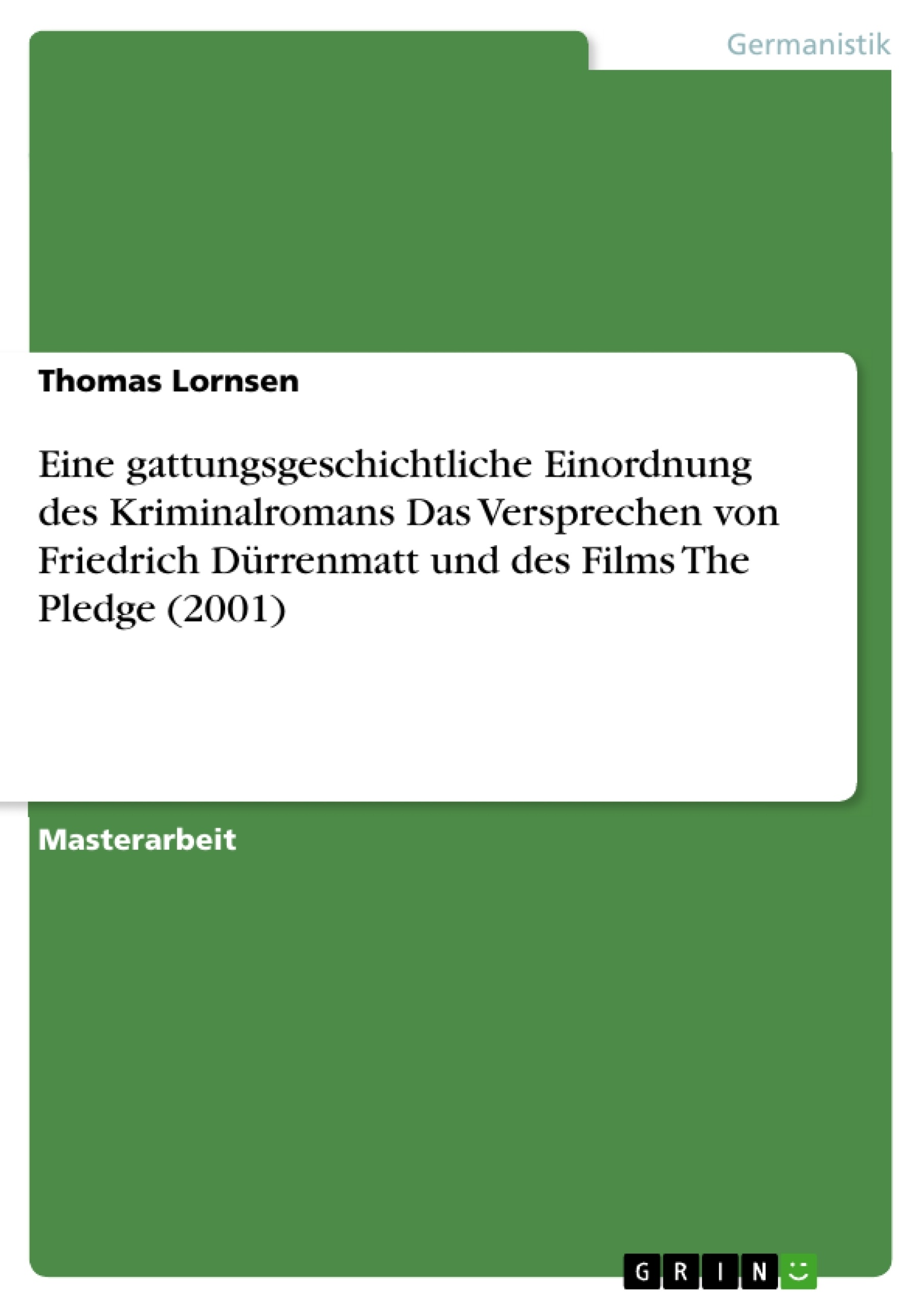1 Einleitung
Wenn sich die Literaturwissenschafler in einem über Friedrich Dürrenmatt einig sind, dann wohl darin, dass er sich nicht fassen lässt. "Die Urteile über ihn spiegeln im allgemeinen Unbehagen, Ratlosigkeit, Mißverständnisse wider" (Oberle 10). Nur allzu oft glaubte man ihn schon als Zyniker, Nihilist, Kommunist, Moralist oder Humorist enttarnt zu haben, und Dürrenmatt tut in seinen theoretischen Schriften, Reden und Interviews ein Übriges, die allgemeine Verwirrung mit immer neuen widersprüchlichen Behauptungen zu schüren. Dabei behandelt er in allen seinen Werken dieselben Motive, so unter anderem das Groteske, Absurde und Paradoxe, die Gerechtigkeit, die Moral und die menschliche Hybris. Es mag gut sein, dass die Ratlosigkeit der Fachwelt darauf zurückzuführen ist, dass Dürrenmatt selbst keine feste Position bezieht, sondern vielmehr mit diesen Motiven spielt, sie in verschiedenen Konstellationen gegeneinander antreten lässt und vom Resultat bisweilen selber überrascht sein mag. Auf der anderen Seite herrscht in der Dürrenmatt-Forschung bereits Uneinigkeit, wenn es um die Definition von in diesem Kontext so wichtigen Begriffen wie "absurd", "paradox" und "grotesk" geht.
Wenn sich Dürrenmatt entscheidet, Kriminalromane zu schreiben, dann wählt er damit ein Genre, das nicht minder komplex und verwirrungstiftend ist und mindestens ebensoviele widersprüchliche, ratlose und voreilige Meinungen provoziert hat wie er selbst. Bis heute liegt keine umfassende Gattungstheoretie vor und auch hier herrscht eine terminologische Unordnung: Begriffe wie Kriminalroman, Kriminalerzählung, Detektivroman, Verbrechensdichtung und Thriller werden mal als völlig verschiedene Gattungen, mal als verwandte Subgenres und mal als synonyme Bezeichnungen gebraucht. Wenn Dürrenmatt seinem dritten Kriminalroman, dem Versprechen, dann auch noch den Untertitel "Requiem auf den Kriminalroman" verpasst, drängt sich der Eindruck auf, er tue dies nur, um die germanistische Fachwelt zu verhöhnen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Vorgehensweise und Intention
- 1.2 Methodologie
- 1.3 Entstehungsgeschichte des Versprechens
- 2 Hintergrund
- 2.1 Zur Geschichte und Theorie des Kriminalromans
- 2.1.1 Die Anfänge
- 2.1.1.1 Prodesse et delectare: Die Pitavalerzählung
- 2.1.1.2 Der pointierte Kriminalroman
- 2.1.1.3 Der Kriminalroman in der literaturwissenschaftlichen Betrachtung
- 2.1.2 Der moderne Kriminalroman
- 2.1.2.1 Die Komplexität der Typologie
- 2.1.2.2 Die amerikanische „hard-boiled school“
- 2.1.2.3 Der moderne deutschsprachige Kriminalroman
- 2.1.3 Verfilmungen von Kriminalromanen
- 2.1.3 Das Versprechen
- 3 Das Versprechen
- 3.1 Der Zufall
- 3.2 Mittel der Verfremdung
- 3.2.1 Die Rahmenhandlung
- 3.2.2 Der „unreliable narrator“
- 3.3 Das Weltbild
- 3.4 Der Protagonist
- 3.4.1 Moral
- 3.5 Moral
- 3.6 Rezeption
- 3.7 Zusammenfassung
- 4 The Pledge
- 4.1 Die Motivation
- 4.2 Der Protagonist
- 4.2.1 Die Motivation
- 4.3 Moral
- 4.4 Der Zufall
- 4.5 Das Weltbild
- 4.6 Rezeption im deutschsprachigen Raum und den USA
- 4.7 Zusammenfassung
- 5 Fazit und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kriminalromane „Das Versprechen“ von Friedrich Dürrenmatt und dessen Verfilmung „The Pledge“. Ziel ist der Vergleich beider Werke hinsichtlich ihrer weltanschaulichen und sozialen Problematik und der Art und Weise, wie diese Problematik innerhalb des Kriminalroman-Genres transportiert wird. Der Fokus liegt dabei auf den Protagonisten und ihrem Weltbild, da die Problematik aus deren Interaktion mit ihrer Umwelt hervorgeht. Die gattungsgeschichtliche Einordnung beider Werke unter Berücksichtigung des Wandels im Kriminalroman, insbesondere seit der „hard-boiled school“, bildet einen weiteren Schwerpunkt.
- Vergleich der weltanschaulichen und sozialen Problematik in „Das Versprechen“ und „The Pledge“
- Analyse der Darstellung dieser Problematik im Kriminalroman-Genre
- Untersuchung der Rolle der Protagonisten und ihres Weltbildes
- Gattungsgeschichtliche Einordnung beider Werke im Kontext der Entwicklung des Kriminalromans
- Einfluss amerikanischer Kriminalliteratur auf Dürrenmatts Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung diskutiert die widersprüchliche Rezeption von Friedrich Dürrenmatts Werk und die Komplexität des Kriminalroman-Genres. Sie begründet die Notwendigkeit einer eingehenden Analyse von „Das Versprechen“ und seiner Verfilmung „The Pledge“, indem sie die Intention der Arbeit erläutert und die Fragestellungen umreißt. Es wird auf den Kontext der amerikanischen „hard-boiled school“ eingegangen und die Bedeutung der Genrekritik für die beiden Werke hervorgehoben. Der Abschnitt endet mit der Hervorhebung der besonderen Entstehungsgeschichte der Verfilmung.
2 Hintergrund: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Geschichte und Theorie des Kriminalromans. Es beginnt mit den Anfängen des Genres, beleuchtet die Entwicklung verschiedener Stile und Subgenres, inklusive der amerikanischen „hard-boiled school“, und analysiert die literaturwissenschaftliche Betrachtung des Kriminalromans. Der Schwerpunkt liegt auf den komplexen und oft widersprüchlichen Deutungen des Genres. Das Kapitel bereitet den Leser auf die anschließende Detailanalyse von Dürrenmatts Werk vor.
3 Das Versprechen: Diese Kapitel analysiert Dürrenmatts Roman „Das Versprechen“, konzentriert sich auf zentrale Aspekte wie den Zufall, die Mittel der Verfremdung (insbesondere die Rahmenhandlung und den „unreliable narrator“), das Weltbild, den Protagonisten und seine Motivation, und die moralischen Implikationen der Handlung. Die Kapitel-Zusammenfassung synthetisiert die komplexen Beziehungen zwischen diesen Elementen und erörtert ihre Bedeutung im Kontext der gesamten Erzählung. Es wird die Rezeption des Romans und dessen Stellung im Gesamtwerk des Autors beleuchtet.
4 The Pledge: Dieses Kapitel analysiert Sean Penns Verfilmung „The Pledge“, indem es die Adaption von Dürrenmatts Roman untersucht. Der Fokus liegt auf einem Vergleich mit dem Roman, wobei Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Motivation des Protagonisten, das dargestellte Weltbild und die moralischen Implikationen der Handlung analysiert werden. Zusätzlich wird die Rezeption der Verfilmung im deutschsprachigen Raum und in den USA betrachtet und der amerikanische Einfluss auf die Genrekritik der Verfilmung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Friedrich Dürrenmatt, Das Versprechen, The Pledge, Kriminalroman, Genrekritik, „hard-boiled school“, Weltbild, Protagonist, Moral, Zufall, Verfilmung, Genregeschichte, Amerikanisierung, soziale Problematik.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Versprechen" und "The Pledge"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht Friedrich Dürrenmatts Roman "Das Versprechen" und dessen Verfilmung "The Pledge" von Sean Penn. Im Fokus steht der Vergleich der weltanschaulichen und sozialen Problematik beider Werke und deren Darstellung innerhalb des Kriminalroman-Genres. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Protagonisten und ihrem Weltbild gewidmet, sowie der gattungsgeschichtlichen Einordnung beider Werke im Kontext der Entwicklung des Kriminalromans, insbesondere im Hinblick auf die amerikanische "hard-boiled school".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die folgenden Themen: Vergleich der weltanschaulichen und sozialen Problematik in beiden Werken; Analyse der Darstellung dieser Problematik im Kriminalroman-Genre; Untersuchung der Rolle der Protagonisten und ihres Weltbildes; gattungsgeschichtliche Einordnung beider Werke im Kontext der Entwicklung des Kriminalromans; und den Einfluss amerikanischer Kriminalliteratur auf Dürrenmatts Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) behandelt die widersprüchliche Rezeption von Dürrenmatts Werk und die Komplexität des Kriminalroman-Genres. Kapitel 2 (Hintergrund) bietet eine umfassende Einführung in die Geschichte und Theorie des Kriminalromans. Kapitel 3 analysiert Dürrenmatts Roman "Das Versprechen", Kapitel 4 analysiert Sean Penns Verfilmung "The Pledge" im Vergleich zum Roman. Kapitel 5 (Fazit und Schluss) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte von "Das Versprechen" werden analysiert?
Die Analyse von "Das Versprechen" konzentriert sich auf den Zufall, die Mittel der Verfremdung (Rahmenhandlung und "unreliable narrator"), das Weltbild, den Protagonisten und seine Motivation, sowie die moralischen Implikationen der Handlung. Die Rezeption des Romans und seine Stellung im Gesamtwerk Dürrenmatts werden ebenfalls beleuchtet.
Wie wird "The Pledge" im Vergleich zu "Das Versprechen" betrachtet?
Die Analyse von "The Pledge" untersucht die Adaption von Dürrenmatts Roman und vergleicht sie mit dem Original. Im Fokus stehen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Motivation des Protagonisten, das dargestellte Weltbild, die moralischen Implikationen der Handlung und die Rezeption der Verfilmung im deutschsprachigen Raum und in den USA. Der amerikanische Einfluss auf die Genrekritik der Verfilmung wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Dürrenmatt, Das Versprechen, The Pledge, Kriminalroman, Genrekritik, „hard-boiled school“, Weltbild, Protagonist, Moral, Zufall, Verfilmung, Genregeschichte, Amerikanisierung, soziale Problematik.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse von "Das Versprechen" und "The Pledge", um die weltanschauliche und soziale Problematik beider Werke zu untersuchen und die Darstellung dieser Problematik im Kriminalroman-Genre zu analysieren. Die methodische Vorgehensweise wird im ersten Kapitel detailliert erläutert.
- Citar trabajo
- Thomas Lornsen (Autor), 2002, Eine gattungsgeschichtliche Einordnung des Kriminalromans Das Versprechen von Friedrich Dürrenmatt und des Films The Pledge (2001), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7581