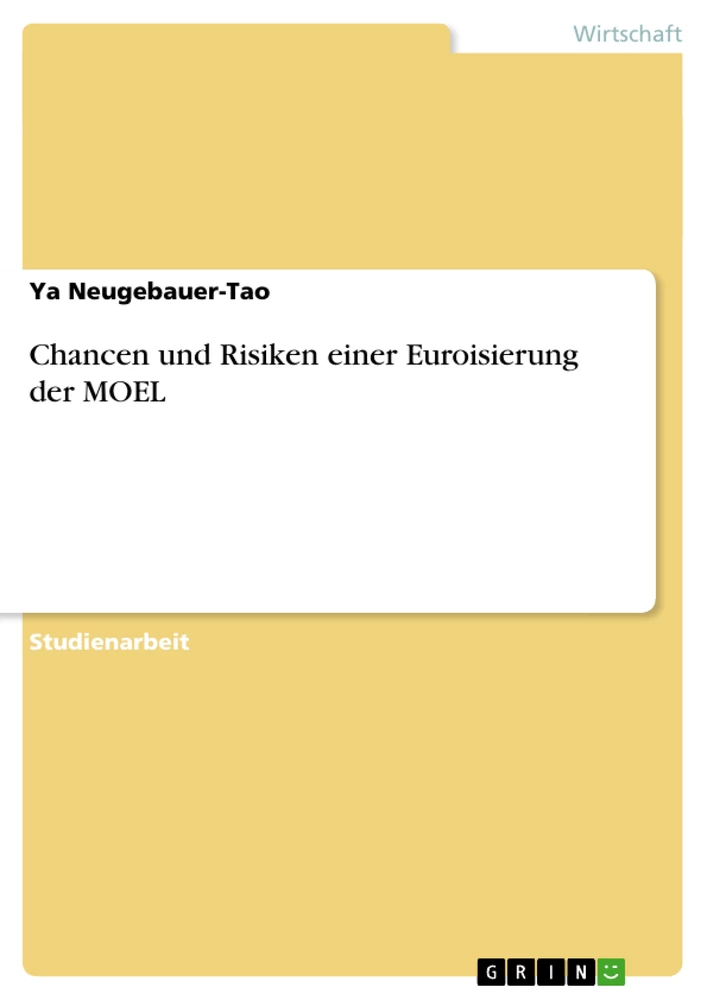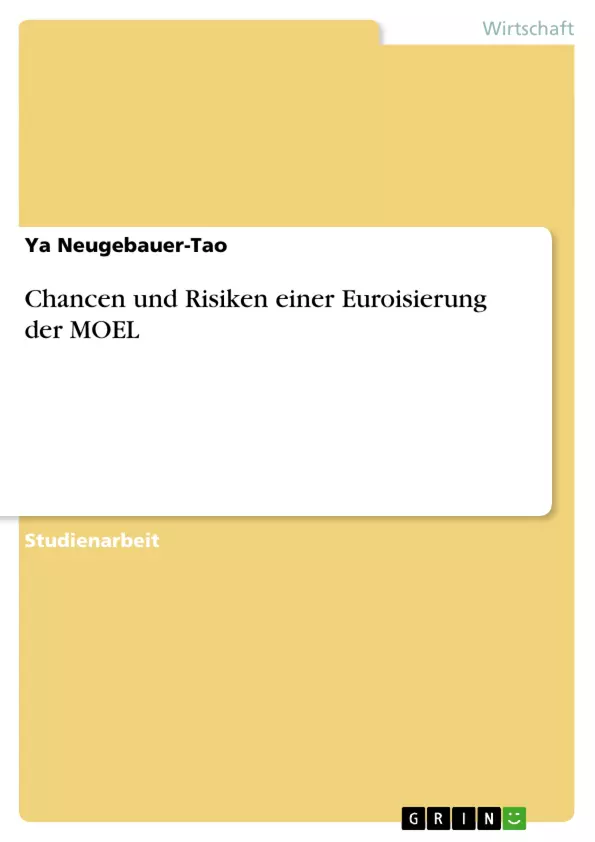Seit dem 1. Mai 2004 sind acht mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) beigetreten. Mit dem Beitritt sind die Länder - von gewissen Übergangsvorschriften abgesehen - voll in die Gemeinschaftsregelungen einbezogen. Das bedeutet insbesondere die Teilnahme am Binnenmarkt sowie an den Gemeinschaftspolitiken, aber auch am Finanzierungssystem der Gemeinschaft. Eine vollständige währungspolitische Integration der Beitrittsländer ist nach Auffassung der EU erst nach einer zweijährigen Mitgliedschaft im WKM II ohne Spannung und Abwertungen vorgesehen. Die offizielle Einführung des Euro in den mittel- und osteuropäischen Ländern setzt voraus, dass die jeweiligen Länder die Maastrichter Konvergenzkriterien erfüllen. Dies bedeutet, dass die Beitrittsstaaten bis dahin ihre nationalen Währungen und, in beschränktem Umfang, ihre eigenständige Geldpolitik beibehalten.
Bereits im Vorfeld der Osterweiterung setzte sich eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten mit den währungspolitischen Optionen der beitrittswilligen MOEL auseinander. Die Vorschläge reichen von frei schwankenden Wechselkursen als ein Sprungbrett zum Eintritt in den WKM II bis zu einer sofortigen unilateralen Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel durch die jeweiligen Länder (Euroisierung). Der Begriff „Euroisierung“ ist hier als eine einseitige Entscheidung des Beitrittsstaats über die vollständige Substitution der heimischen Währung durch den Euro mit allen Geldfunktionen gemeint. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch der EU-Ministerrat widersprechen vehement der Sinnhaftigkeit einer definitionsgemäß unilateralen Euroisierung. Nach dem Beitritt hat die Frage nach dem geeigneten Wechselkursregime für diese Länder an Aktualität nicht verloren. Eine einseitige Euroisierung ist zwar mit dem EU-Beitrittsvertrag nicht vereinbar, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit strenger Maßnahmen seitens der EU gegen MOEL, die sich dieses Arrangements bedienen, relativ gering. Denn die Euroisierungsstrategie kann als ein deutlicher Integrationswille interpretiert werden, und die Einbindung dieser Länder in die EU schon immer das erklärte Ziel der bilateralen Beziehungen ist. Angesichts der geplanten Aufnahme weiterer Kandidatenländer wie Bulgarien sowie Rumänien und im Hinblick auf die fortgeschrittenen Transformationsergebnisse der neuen Beitrittsstaaten ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema der Euroisierung weiterhin angebracht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklungsstand der Wirtschafts- und Währungssysteme der MOEL
- 2.1 Die nominale Konvergenz
- 2.2 Reale Konvergenz und Optimaler Währungsraum
- 3. Die Wahl des Wechselkursregimes
- 4. Vorteile einer Euroisierung der MOEL
- 4.1 Eliminierung der Transaktionskosten
- 4.2 Minimierung des Wechselkursrisikos
- 4.3 Glaubwürdigeres Regime
- 5. Risiken und Kosten einer Euro-Übernahme
- 5.1 Spezifische Kosten einer Euroisierung
- 5.2 Deflationsgefahren durch asymmetrische Schocks
- 5.3 Verlust an Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Inflation
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Chancen und Risiken einer Euroisierung der mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) im Kontext der Osterweiterung und der Europäischen Integration. Sie untersucht den Entwicklungsstand der Wirtschafts- und Währungssysteme der MOEL, die verschiedenen Wechselkursarrangements und die theoretischen Erklärungsansätze für die möglichen Vor- und Nachteile einer Euroisierung.
- Konvergenzfortschritte der MOEL
- Alternativen der Wechselkursarrangements
- Theoretische Erklärungsansätze der Vor- und Nachteile einer Euroisierung
- Bewertung der Euroisierungsstrategie
- Aktuelle Diskussion um die Integration der MOEL in die Europäische Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den Entwicklungsstand der Wirtschafts- und Währungssysteme der MOEL und analysiert die Fortschritte in Bezug auf die nominale Konvergenz. Kapitel 3 befasst sich mit den verschiedenen Wechselkursarrangements, die für die MOEL zur Verfügung stehen. In Kapitel 4 werden die Vorteile einer Euroisierung diskutiert, einschließlich der Eliminierung von Transaktionskosten, der Minimierung des Wechselkursrisikos und der Steigerung der Glaubwürdigkeit. Kapitel 5 geht auf die Risiken und Kosten einer Euroisierung ein, darunter spezifische Kosten, Deflationsgefahren und der potenzielle Verlust an Wettbewerbsfähigkeit.
Schlüsselwörter
Euroisierung, MOEL, Osterweiterung, Europäische Integration, Konvergenzkriterien, Wechselkursregime, Transaktionskosten, Wechselkursrisiko, Deflation, Inflation, Wettbewerbsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Euroisierung“?
Euroisierung ist die einseitige Entscheidung eines Staates, die eigene Landeswährung vollständig durch den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel zu ersetzen.
Welche Länder werden als MOEL bezeichnet?
MOEL steht für die mittel- und osteuropäischen Länder, die im Zuge der Osterweiterung der EU beigetreten sind oder beitreten wollen.
Was sind die Vorteile einer Euroisierung für diese Länder?
Zu den Vorteilen zählen die Eliminierung von Transaktionskosten, die Minimierung des Wechselkursrisikos und eine höhere Glaubwürdigkeit der Geldpolitik.
Welche Risiken birgt die Übernahme des Euro?
Es besteht das Risiko von Deflationsgefahren durch asymmetrische Schocks und der Verlust der eigenständigen Geldpolitik zur Steuerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Wie steht die Europäische Zentralbank zur einseitigen Euroisierung?
Die EZB und der EU-Ministerrat lehnen eine unilaterale Euroisierung ab, da der vorgesehene Weg über den WKM II und die Erfüllung der Konvergenzkriterien eingehalten werden soll.
- Quote paper
- Dipl.-Volkswirtin Ya Neugebauer-Tao (Author), 2005, Chancen und Risiken einer Euroisierung der MOEL, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75875