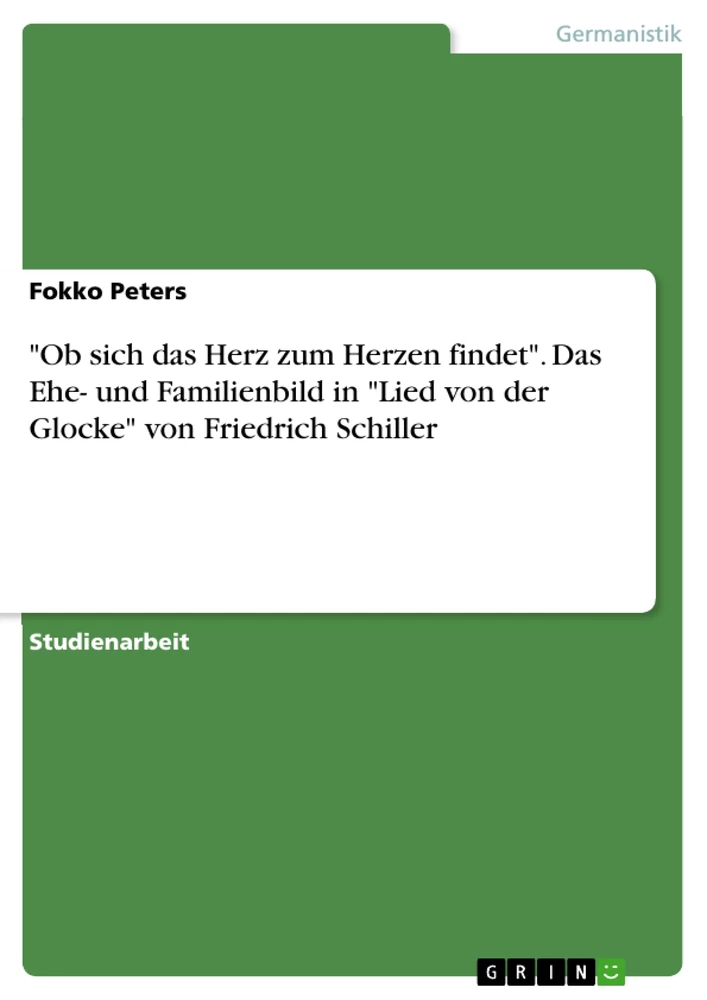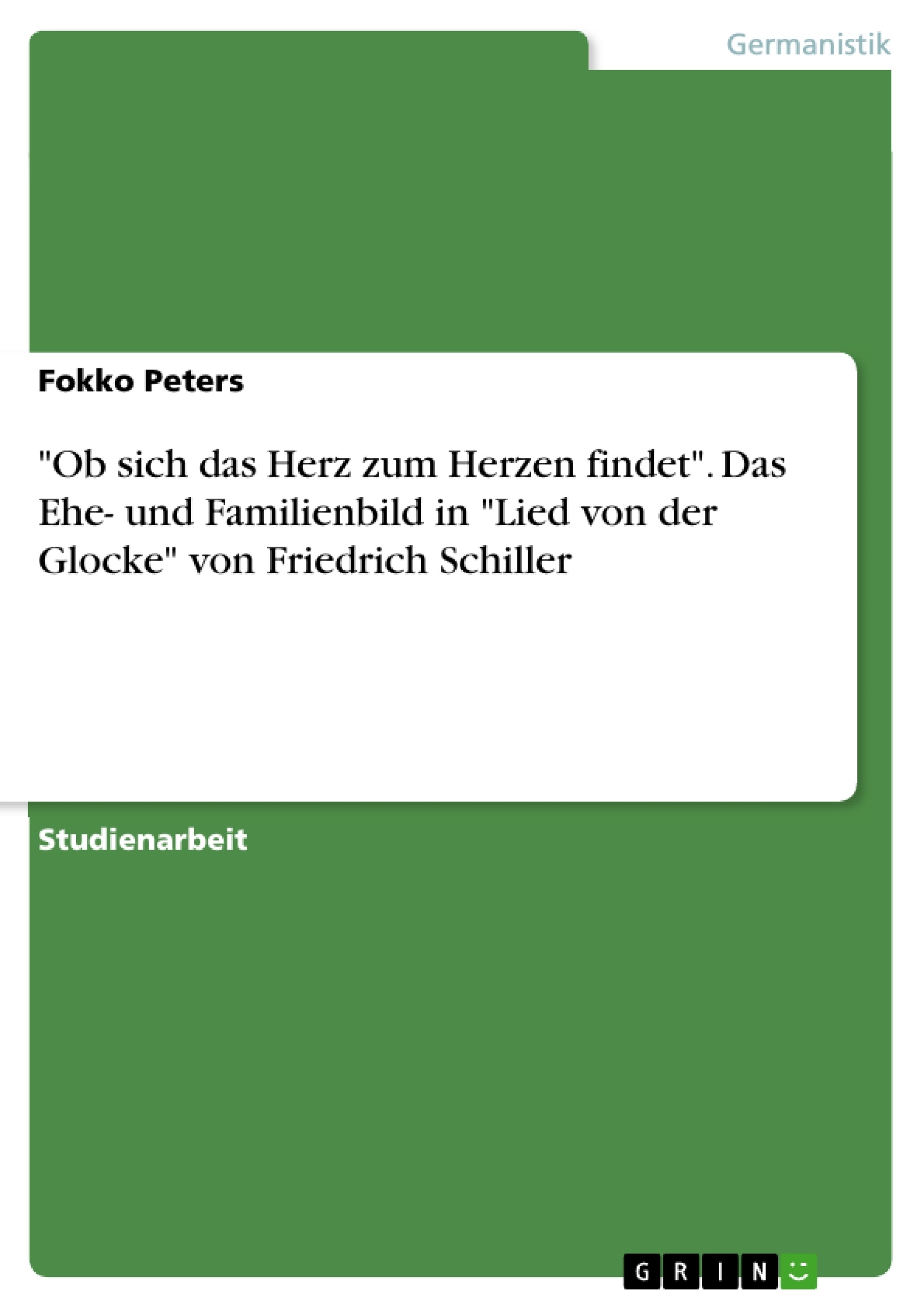Die folgende Interpretation hebt sich von den geschilderten bisherigen Forschungsergebnissen ab, als sie weder eine Verherrlichung des bürgerlich-nationalen Inhalts der „Glocke“ noch eine allzu kritische Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Gestaltung des Gedichts sein möchte.
Sie möchte vielmehr aufzeigen, dass „Das Lied von der Glocke“ auch noch im 21. Jahrhundert eine nicht zu verachtende Botschaft für jeden einzelnen Rezipienten enthalten kann, falls dieser gewillt ist, die Botschaft anzunehmen. Denn die „gute[n] Reden“ (11) begleiten die Arbeit an der Glocke ja nicht umsonst. Schon Schiller selbst schrieb am 22.9.1797 an Goethe, dass dieses Gedicht „wirklich keine kleine Aufgabe“ sei und seine „wahre Reife“ erst durch das längere Herumtragen des Gegenstandes erhalte3 Dadurch wird deutlich, dass Schiller seine dichterische Aufgabe in Bezug auf die „Glocke“ nicht nur in der bloßen Produktion eines guten „Zunftliedes“, sondern auch in der ausführlichen Ausgestaltung der begleitenden Reden sah. Durch diese Reden erhielt das „Lied von der Glocke“ jenen Zeit- und Gesellschaftsbezug, der es zu einem „Preislied auf bürgerliche Tugenden“ machte.
Der Schwerpunkt der Interpretation soll – dem Thema der Arbeit entsprechend – auf der Passage liegen, die von der Eheschließung und dem darauf folgenden Familienleben handelt (58-143). Es soll untersucht werden, wie dieser Abschnitt, der ja zu den oftmals kritisierten Kommentierungen, die der „Volkserzieher Schiller“ in sein ursprüngliches „Glockengießerlied“ einbaute, inhaltlich und strukturell aufgebaut ist. Schließlich schreibt auch Norbert Oellers, dass die Auseinandersetzung mit der Form des Gedichts „Das Lied von der Glocke“ oftmals zu kurz komme.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interpretation der „Familienpassage“ (V. 58-143)
- Das Mannes- bzw. Frauenbild in dem Gedicht „Würde der Frauen“ im Vergleich zu demjenigen im „Lied von der Glocke“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Interpretation des Gedichts „Das Lied von der Glocke“ von Friedrich Schiller, insbesondere den Abschnitt über Ehe und Familie (Verse 58-143). Ziel ist es, die Botschaft des Gedichts für heutige Leser aufzuzeigen und den Aufbau und die inhaltliche Gestaltung der „Familienpassage“ zu analysieren. Der Einfluss von Schillers pietistischer Erziehung auf die moralischen Wertvorstellungen im Gedicht wird ebenfalls betrachtet.
- Interpretation der „Familienpassage“ im „Lied von der Glocke“
- Analyse des Männer- und Frauenbildes in Schillers Werk
- Der Einfluss der pietistischen Erziehung auf Schillers Werk
- Vergleich mit dem Gedicht „Würde der Frauen“
- Rezeption des „Lied von der Glocke“ im Laufe der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die bisherige Forschungslandschaft zum „Lied von der Glocke“ dar, die zwischen Verklärung und Verwerfung des Gedichts schwankt. Sie hebt die Notwendigkeit einer neuen Interpretation hervor, die weder eine Verherrlichung des bürgerlich-nationalen Inhalts noch eine übermäßige Kritik beinhaltet, sondern die zeitlose Botschaft des Gedichts für den heutigen Leser herausarbeitet. Die Arbeit konzentriert sich auf die „Familienpassage“ (Verse 58-143) und zieht das Gedicht „Würde der Frauen“ zum Vergleich heran.
Interpretation der „Familienpassage“ (V. 58-143): Diese Interpretation analysiert den Abschnitt über die Eheschließung und das Familienleben im „Lied von der Glocke“. Sie untersucht die Struktur und den Inhalt dieses Abschnitts, der oft als konservativ kritisiert wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, inwieweit Schillers pietistische Kindheitsprägung die moralischen Wertvorstellungen in diesem Teil des Gedichts beeinflusst hat. Die Analyse befasst sich mit den dargestellten bürgerlichen Tugenden und deren Bedeutung im Kontext des Gesamtwerks.
Das Mannes- bzw. Frauenbild in dem Gedicht „Würde der Frauen“ im Vergleich zu demjenigen im „Lied von der Glocke“: Dieser Abschnitt vergleicht das Männer- und Frauenbild im „Lied von der Glocke“ mit demjenigen in Schillers frühem Gedicht „Würde der Frauen“. Durch diesen Vergleich wird die Entwicklung von Schillers Ansichten zu den Geschlechterrollen verdeutlicht und in Beziehung zu den moralischen Wertvorstellungen im „Lied von der Glocke“ gesetzt. Die Analyse beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gedichte im Hinblick auf die Darstellung der Geschlechterrollen.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Lied von der Glocke, Familienpassage, Ehe, Familie, Männerbild, Frauenbild, Pietismus, Würde der Frauen, bürgerliche Tugenden, Interpretation, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zum "Lied von der Glocke" - Analyse
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers "Lied von der Glocke", insbesondere die "Familienpassage" (Verse 58-143). Der Fokus liegt auf der Interpretation der Botschaft des Gedichts für heutige Leser, der Analyse des Aufbaus und der inhaltlichen Gestaltung dieser Passage, sowie dem Einfluss von Schillers pietistischer Erziehung auf die moralischen Wertvorstellungen im Gedicht. Ein Vergleich mit dem Gedicht "Würde der Frauen" wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Interpretation der "Familienpassage", Analyse des Männer- und Frauenbildes in Schillers Werk, der Einfluss der pietistischen Erziehung auf Schillers Werk, ein Vergleich mit dem Gedicht "Würde der Frauen", und die Rezeption des "Lied von der Glocke" im Laufe der Geschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Interpretation der "Familienpassage" (Verse 58-143), und einen Vergleich des Männer- und Frauenbildes im "Lied von der Glocke" mit demjenigen in "Würde der Frauen". Die Einleitung präsentiert den aktuellen Forschungsstand und die Zielsetzung der Arbeit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die jeweiligen Analysen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, eine neue Interpretation des "Lied von der Glocke" zu liefern, die weder eine Verherrlichung noch eine übermäßige Kritik des Gedichts beinhaltet, sondern die zeitlose Botschaft für den heutigen Leser herausarbeitet. Die Arbeit analysiert den oft als konservativ kritisierten Abschnitt über Ehe und Familie und setzt ihn in den Kontext von Schillers Leben und Werk.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet interpretative und vergleichende Methoden. Die "Familienpassage" wird detailliert analysiert, um den Aufbau, den Inhalt und die moralischen Wertvorstellungen zu verstehen. Der Vergleich mit "Würde der Frauen" dient dazu, die Entwicklung von Schillers Ansichten zu den Geschlechterrollen zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Lied von der Glocke, Familienpassage, Ehe, Familie, Männerbild, Frauenbild, Pietismus, Würde der Frauen, bürgerliche Tugenden, Interpretation, Rezeption.
Welche Rolle spielt der Pietismus in der Analyse?
Der Pietismus, Schillers religiöse Erziehung, wird als wichtiger Einflussfaktor auf die moralischen Wertvorstellungen im "Lied von der Glocke", insbesondere in der "Familienpassage", betrachtet. Die Analyse untersucht, wie sich diese Prägung auf die dargestellten bürgerlichen Tugenden und die Geschlechterrollen auswirkt.
Wie wird das Männer- und Frauenbild analysiert?
Das Männer- und Frauenbild wird sowohl im "Lied von der Glocke" als auch in "Würde der Frauen" analysiert und verglichen. Die Analyse beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Geschlechterrollen und deren Entwicklung in Schillers Werk.
- Quote paper
- Fokko Peters (Author), 2006, "Ob sich das Herz zum Herzen findet". Das Ehe- und Familienbild in "Lied von der Glocke" von Friedrich Schiller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75945