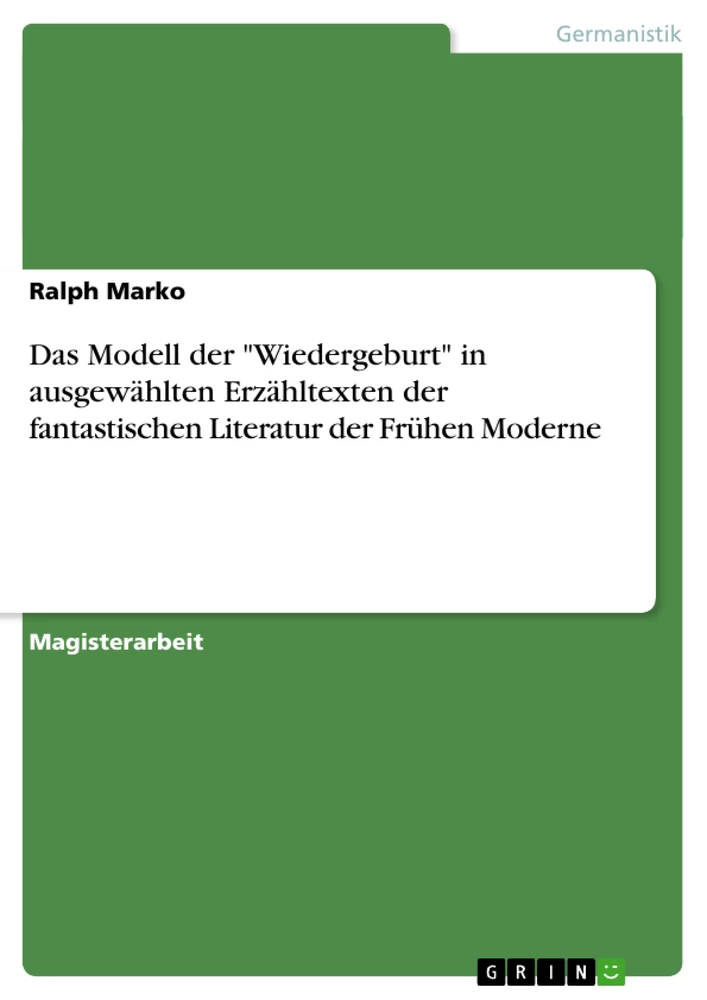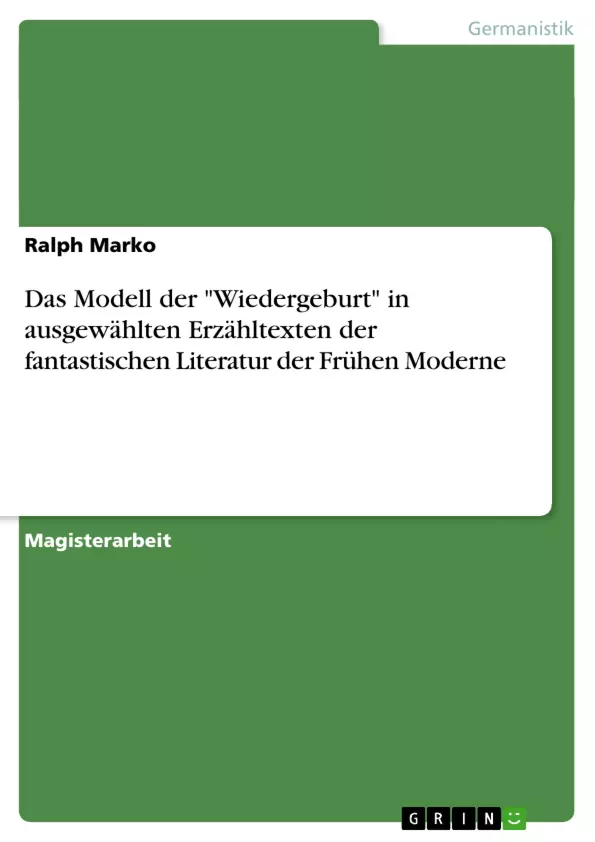Die Seelenwanderung, auch als Reinkarnation oder Metempsychose bezeichnet, ist die religiöse Vorstellung vom Übergang der Seele beim Tod in eine andere Daseinsform. Der vor allem in östlichen Religionen wie dem Buddhismus und dem Hinduismus beheimatete Reinkarnationsglaube beinhaltet in der Regel eine lange Abfolge von Metempsychosen, also Kreisläufe von Geburt, Tod und Wiedergeburt, während derer sich die Seele in unterschiedlichsten menschlichen, göttlichen, tierischen oder sogar pflanzlichen Körpern wieder finden kann. Auch fantastische Erzähltexte der Frühen Moderne (1890 – 1930) haben die biologische Reinkarnation thematisiert. Diese Literatur entwirft eine Welt, die im Grundsatz mit dem jeweiligen kulturellen Realitätsbegriff kompatibel ist. Jedoch tauchen hier Phänomene auf, die mit dieser festgelegten Wirklichkeit nicht vereinbar sind, weil sie zumindest eine seiner – logischen, physikalischen, biologischen oder theologischen – Basisannahmen verletzen, die fixieren, was das jeweilige System für mögliche oder unmögliche Welten hält. Zu diesen Erscheinungen zählt ebenfalls die Metempsychose. Aus diesen fantastischen Romanen geht ein epochenadäquates Modell hervor, in welchem die Selbstfindungsgeschichte, eine für die Epoche sehr typische Erscheinung, eng mit dem Komplex der Reinkarnation kombiniert wird. In diesem Modell der "Wiedergeburt" zu "neuem Leben" wird der Terminus "Leben" – im Gegensatz zur Goethezeit (1770 – 1830) – andersartig semantisiert. Die Idee einer Seelenwanderung, also die einer wörtlichen, physischen Wiedergeburt, war zwar in der Goethezeit vorhanden, hier stand jedoch primär der Gedanke an verschiedene Zustände innerhalb eines biologischen Lebens, Goethes so genanntes "neues Leben", im Vordergrund. Erst in der Frühen Moderne taucht das Konzept der biologischen Metempsychose häufiger und expliziter auf. Wie sich dieses epochenspezifische Modell in der fantastischen Literatur der Frühen Moderne manifestiert, wird in dieser Magisterarbeit anhand ausgewählter Erzähltexte veranschaulicht und nachgewiesen. Anhand der Interpretationen sind Graphiken entstanden, welche im Anhang der Arbeit einzusehen sind. Diese sollen der Veranschaulichung dienen. Folgende Romane liegen der Analyse zugrunde: Paul Bussons "Die Wiedergeburt des Melchior Dronte" (1921), Franz Spundas "Das Ägyptische Totenbuch" (1924) und Hermann Wiedmers "Die Verwandlungen des Walter von Tillo" (1930).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell der „Wiedergeburt“ zu „neuem Leben“ in erzählender Literatur 1890 – 1930: Ein Überblick.
- Paul Bussons Die Wiedergeburt des Melchior Dronte (1921) als Prototyp für das Modell der „Wiedergeburt“ zu „neuem Leben“
- Die,,Wiedergeburt\" als Element der Gesamtserie.
- Das Leben des Titelhelden auf metaphorischer Ebene
- Der Eingang in das jenseitige Leben … .
- Die Lokalisierung zentraler fantastischer Merkmale des Modells.
- Die „Läuterung“ der Seele als zentraler Gedanke.
- Das Modell der „Wiedergeburt“ zu „neuem Leben“ in Hermann Wiedmers Die Verwandlungen des Walter von Tillo (1930) ..
- „Leben 1\": Der Komplex der „Wiedergeburt“ im biologischen Sinne.
- Der lange Weg einer Seelenwanderung.
- Die zwei Typen von biologischen „Nicht-Leben“
- Die variantenreiche Manifestation als Folge der „Wiedergeburt“
- Die unterschiedliche Darstellung der Größe „Tod“.
- ,,Leben 2\": Die diesseitige metaphorische Variante von „,Leben“ innerhalb des Komplexes der Seelenwanderung.
- Die „neutralen“ Ausgangszustände .
- Die verschiedenen „gesteigerten“ Leben mit ihren Varianten und Verknüpfungen.
- Typ A: Die erotisch-partnerbezogenen Varianten . .
- Typ B: Die asketisch-altruistischen Varianten
- Typ C: Die mystisch-narzisstischen Varianten.
- Die Abstufungen in „Nicht-Leben“.
- „Leben 2“: Die diesseitige metaphorische Variante von „Leben“ in der absolut letzten Existenz als „Dita“.
- Der besondere Typus eines „gesteigerten“ Lebens.
- Die totale Autarkie als anzustrebender Wert.
- Die erlangte Rolle des „Lehrers“
- ,,Leben 2\": Helfer - und Gegnerfiguren auf dem Weg zum Ziel.
- Der Weg zum Ziel durch Helferfiguren.
- Das Abkommen vom Ziel durch Gegnerfiguren
- „Leben 3“: Die jenseitige metaphorische Variante von „Leben“.
- Die Erringung des „höchsten eigentlichen Lebens“
- Die Lokalisierung einer potentiellen Helferrolle .
- Der Zustand des „Nicht-Erotikers“
- Die Reinkarnation als Rechtfertigung für das „Leid in der Welt“
- Die Lokalisierung zentraler fantastischer Merkmale des Modells.
- Die metaphysische Instanz als hierarchisch höchste Entität .
- Die Konservierung und die Wiederbelebung.
- Die Reinkarnation und der Lebenswechsel.
- Die Bewusstseinsspaltung und der Doppelgänger.
- ZWISCHENFAZIT I .
- „Leben 1\": Der Komplex der „Wiedergeburt“ im biologischen Sinne.
- Das Modell der „Wiedergeburt“ zu „neuem Leben“ in Franz Spundas Das Ägyptische Totenbuch (1924) .
- „Leben 1\": Die Bedeutung des „Lebens“ im biologischen Sinne ..
- Eine Teilserie mit okkultistischer Erfahrung von Realität.
- Die „Wiedergeburt“ im Kontext der Erzählung . .
- Die Rekonstruierung einer potentiellen ägyptischen Seelenwanderung.
- Der Zustand eines biologischen „Nicht-Lebens“
- „Leben 2\": Die diesseitige metaphorische Variante von „,Leben“
- Der „neutrale“ Ausgangszustand.
- Die verschiedenen „gesteigerten“ Leben mit ihren Varianten und Verknüpfungen.
- Typ A: Die erotisch-partnerbezogenen Varianten
- Typ B: Die asketisch-altruistischen Varianten.
- Typ C: Die mystisch-narzisstische Variante.
- Die Abstufungen in „Nicht-Leben“
- „Leben 2\": Helfer - und Gegnerfiguren auf dem Weg zum Ziel.
- Der Weg zum Ziel durch Helferfiguren.
- Das Abkommen vom Ziel durch Gegnerfiguren.
- Die Nicht-Existenz eines jenseitigen „Lebens 3“
- Der Zustand des „Erotikers“ im Diesseits.
- Der Roman als Rechtfertigung für das „Leid in der Welt“
- Die Lokalisierung zentraler fantastischer Merkmale des Modells..
- Der Komplex der okkulten Wesenheiten
- Die Mumie als zentrale Größe.
- Der externe okkulte Zugriff .
- ZWISCHENFAZIT II
- „Leben 1\": Die Bedeutung des „Lebens“ im biologischen Sinne ..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Motiv der „Wiedergeburt“ in ausgewählten Erzähltexten der fantastischen Literatur der Frühen Moderne. Ziel ist es, die verschiedenen Manifestationsformen des Motivs in den Werken von Paul Busson, Hermann Wiedmer und Franz Spunda zu analysieren und dabei die spezifischen Merkmale des „neuen Lebens“ zu erforschen, das durch die Wiedergeburt erlangt wird.
- Die Bedeutung des „Lebens“ im biologischen und metaphorischen Sinne.
- Die verschiedenen „gesteigerten“ Lebensformen und ihre Varianten.
- Die Rolle von Helfer- und Gegnerfiguren auf dem Weg zum „neuen Leben“.
- Die Lokalisierung zentraler fantastischer Merkmale des Modells der „Wiedergeburt“.
- Die Reinkarnation als Erklärung für das „Leid in der Welt“.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die Forschungsfrage.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Modell der „Wiedergeburt“ in der erzählenden Literatur der Zeit von 1890 bis 1930.
Kapitel 3 analysiert die Rolle der „Wiedergeburt“ in Paul Bussons „Die Wiedergeburt des Melchior Dronte“. Das Kapitel untersucht die „Wiedergeburt“ als Element der Gesamtserie, das Leben des Titelhelden auf metaphorischer Ebene und die Lokalisierung zentraler fantastischer Merkmale des Modells.
Kapitel 4 untersucht die „Wiedergeburt“ in Hermann Wiedmers „Die Verwandlungen des Walter von Tillo“. Das Kapitel analysiert den Komplex der „Wiedergeburt“ im biologischen Sinne, die verschiedenen „gesteigerten“ Lebensformen und die Rolle von Helfer- und Gegnerfiguren.
Kapitel 5 analysiert die „Wiedergeburt“ in Franz Spundas „Das Ägyptische Totenbuch“. Das Kapitel untersucht die Bedeutung des „Lebens“ im biologischen Sinne, die verschiedenen „gesteigerten“ Lebensformen und die Lokalisierung zentraler fantastischer Merkmale des Modells.
Schlüsselwörter
Wiedergeburt, neues Leben, Seelenwanderung, fantastische Literatur, Frühe Moderne, Paul Busson, Hermann Wiedmer, Franz Spunda, biologisches Leben, metaphorisches Leben, Helferfiguren, Gegnerfiguren, okkulte Wesenheiten, Reinkarnation, Leid in der Welt.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Thema „Wiedergeburt“ in der fantastischen Literatur behandelt?
In der Frühen Moderne (1890–1930) wird die biologische Reinkarnation oft mit einer psychologischen Selbstfindungsgeschichte verknüpft.
Welche Romane dienen als Grundlage der Analyse?
Die Analyse stützt sich auf Paul Bussons „Die Wiedergeburt des Melchior Dronte“, Franz Spundas „Das Ägyptische Totenbuch“ und Hermann Wiedmers „Die Verwandlungen des Walter von Tillo“.
Was unterscheidet das Modell der Frühen Moderne von der Goethezeit?
In der Goethezeit stand das „neue Leben“ als metaphorische Wandlung innerhalb eines Lebens im Fokus; in der Frühen Moderne wird die physische Seelenwanderung expliziter thematisiert.
Welche Rolle spielt die „Läuterung“ der Seele?
Die Seelenwanderung wird oft als ein Weg der Läuterung dargestellt, um vergangene Schuld abzutragen oder eine höhere Existenzform zu erreichen.
Was sind typische fantastische Merkmale dieser Texte?
Dazu gehören Bewusstseinsspaltungen, Doppelgänger-Motive, okkulte Wesenheiten und die Aufhebung der linearen Zeit durch Reinkarnationserfahrungen.
- Quote paper
- Ralph Marko (Author), 2006, Das Modell der "Wiedergeburt" in ausgewählten Erzähltexten der fantastischen Literatur der Frühen Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75957