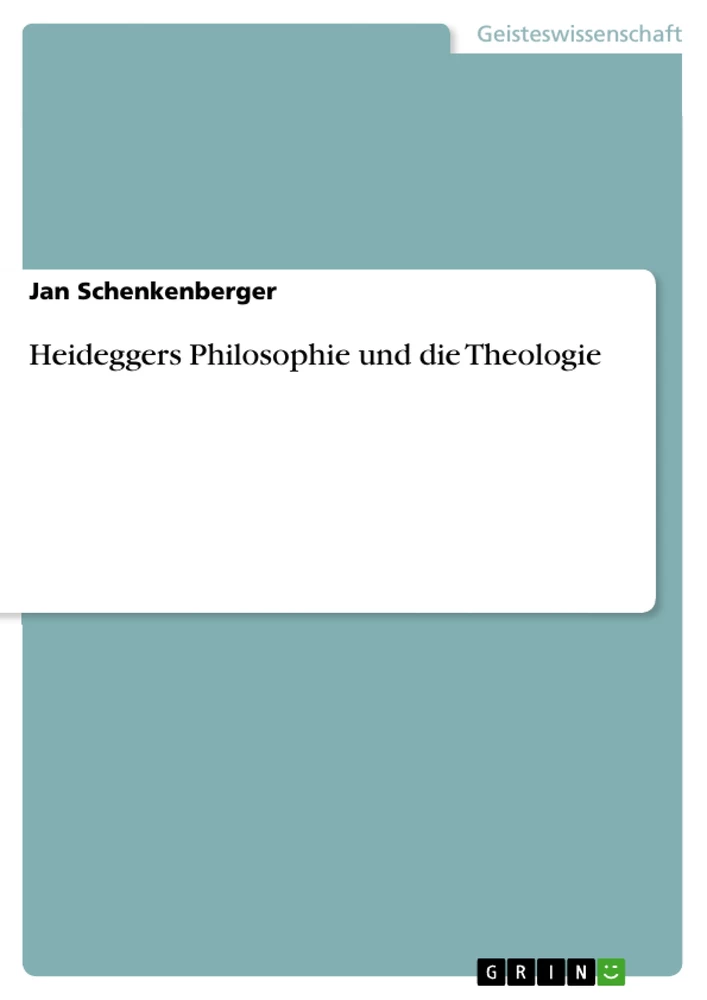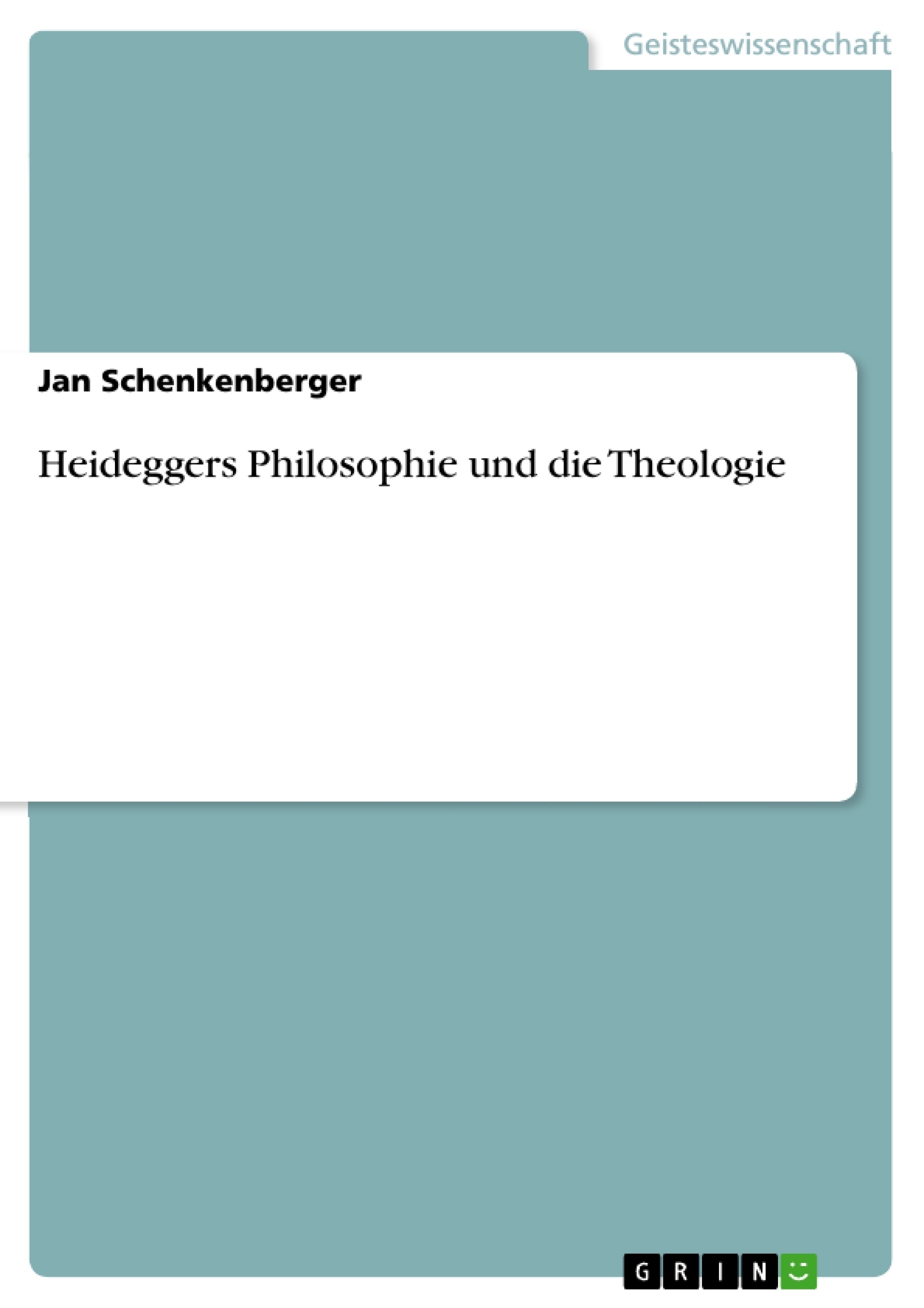Heidegger ist ein Philosoph, der aus dem Zerfall heraus geboren wurde. Seine Philosophie findet ihren Spiegel in der Kunst jener Jahre, dem Expressionismus. Das es sich hier um etwas radikal neues handelte, kündigte sich schon in den Namen seiner Zeitschriften
an: „Die Aktion“, „Der Sturm“ oder „Die Revolution“. Die Welt schien, mit dem ersten Weltkrieg und der damit erreichten umfassenden Technisierung endgültig aus den Fugen geraten zu sein. Auch in Heideggers Biographie spiegelt sich dieser Umbruch, der gleichzeitig ein Ausbruch war, wieder. Er, der zu Beginn noch katholische Theologie studiert hatte, wendet sich im Laufe der Zeit mehr und mehr vom Katholizismus ab der Philosophie, dem „freien Denken“ zu.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Heideggers Philosophie und die Theologie darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Heideggers Philosophie und die Theologie
- Die alten Systeme des Christentums
- Die Wirklichkeit
- Gott
- Die Theologie
- Die Sprache
- Die Aufgabe des Menschen
- Heideggers Antwort auf die Frage nach der Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Verbindung zwischen Heideggers Philosophie und der Theologie. Er analysiert Heideggers Abkehr vom traditionellen Christentum und seine Hinwendung zur „faktischen Wirklichkeit“. Zudem beleuchtet er die Bedeutung der Sprache in Heideggers Denken und die Auswirkungen seiner philosophischen Positionen auf die Theologie.
- Heideggers Abkehr vom Katholizismus und seine Hinwendung zur Philosophie
- Die Rolle der „faktischen Wirklichkeit“ in Heideggers Philosophie
- Die Beziehung zwischen Sprache und Sein
- Die Auswirkungen von Heideggers Denken auf die Theologie
- Die Bedeutung von Sprache und Verstehen in der Religion
Zusammenfassung der Kapitel
Heideggers Philosophie und die Theologie
Dieser Abschnitt stellt Heidegger als einen Philosophen vor, der aus dem Zerfall der alten Ordnung heraus geboren wurde. Seine Philosophie spiegelt den Expressionismus wider, der sich durch radikale Neuerungen und eine Welt aus den Fugen geraten auszeichnet. Der Abschnitt beleuchtet Heideggers Abkehr vom Katholizismus und seine Hinwendung zur Philosophie, die er als „freies Denken“ bezeichnet.
Die alten Systeme des Christentums
Dieser Abschnitt befasst sich mit Heideggers Kritik an den traditionellen Systemen des Christentums. Er argumentiert, dass diese Systeme für die moderne Zeit nicht mehr relevant sind, da sie die „faktische Wirklichkeit“ nicht angemessen erfassen können. Die Diskussion greift auf Ludwig Feuerbach und dessen Kritik am Christentum zurück.
Die Wirklichkeit
Dieser Abschnitt befasst sich mit Heideggers Konzept der „faktischen Wirklichkeit“. Heidegger sieht die menschliche Existenz als geprägt von der Zeitlichkeit und der „historischen Faktizität“. Er strebt eine Rückführung der Philosophie auf ihre Wurzeln bei den Vorsokratikern an.
Gott
Dieser Abschnitt untersucht Heideggers Sicht auf Gott. Er argumentiert, dass Gott in der „faktischen Wirklichkeit“ nicht mehr vorhanden ist und dass der Mensch die „metaphysischen Weltfluchten“ aufgeben muss. Der Abschnitt greift auf Rilkes Brief an L.H. zurück, der den Tod als endlichen Bezugspunkt und den Sturz ins faktische Leben als Ende aller metaphysischen Fluchten beschreibt.
Die Theologie
Dieser Abschnitt behandelt Heideggers Auseinandersetzung mit der Theologie. Er argumentiert, dass die Theologie die Aufgabe hat, das Wort zu suchen, das zum Glauben ruft und im Glauben bewahrt. Die Theologie muss ihre Begriffe an das Seiende anpassen, das sie auszulegen versucht. Der Abschnitt diskutiert die positive Aufgabe der Theologie, innerhalb des christlichen Glaubens aus dessen eigenem Wesen heraus zu erörtern, was sie zu denken und wie sie zu sprechen hat.
Die Sprache
Dieser Abschnitt setzt sich mit der Sprache als Reaktion auf die Umwelt auseinander. Heidegger verknüpft Denken und Sagen und bezieht sich dabei auf das griechische Paar λoyos und hɛyɛɩv. Er argumentiert, dass Denken letztlich Gespräch ist, Gespräch mit der Welt und dem eigenen Ich. Der Abschnitt stellt das aɛyɛɩv als Paradebeispiel für objektivierendes Sprechen im Heideggerschen Sinne dar.
Die Aufgabe des Menschen
Dieser Abschnitt beleuchtet die Aufgabe des Menschen aus der Sicht der Theologie. Er argumentiert, dass die eigentliche Aufgabe des Menschen nicht im Sprechen, sondern im Verstehen der Sprache Gottes liegt. Der Abschnitt greift auf die Schöpfungsgeschichte und die Schriften von Milton zurück, um die Bedeutung des Verstandes als Gottesgabe für den Menschen zu betonen. Die Aufgabe des Menschen ist die Tat, die sich in Form von Liebe, Verantwortung, Erbarmen, aber auch Zorn, Unwillen und Hass zeigen kann.
Heideggers Antwort auf die Frage nach der Sprache
Dieser Abschnitt behandelt Heideggers Sicht auf die Sprache. Er argumentiert, dass die Sprache gleichsam Stimme des Seins ist und ein eigenes Wesen besitzt. Die Sprache hat einen „ontischen Gehalt“, der unabhängig von Raum und Zeit existiert. Heidegger versucht dies anhand der Entstehung des Begriffes der „Sünde“ aus dem Begriff der „Schuld“ zu belegen.
Schlüsselwörter
Der Text behandelt die Philosophie von Martin Heidegger, seine Abkehr vom Katholizismus, seine Auseinandersetzung mit der „faktischen Wirklichkeit“, die Bedeutung der Sprache in seiner Philosophie und die Verbindung zwischen Heidegger und der Theologie. Zentrale Begriffe sind „faktische Wirklichkeit“, „historische Faktizität“, „Seinsverständnis“, „Sprache“, „Sünde“, „Schuld“, „Gott“, „Christentum“, „Theologie“ und „objektivierendes Sprechen“.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist Martin Heideggers Verhältnis zur Theologie?
Heidegger studierte ursprünglich katholische Theologie, wandte sich jedoch im Laufe der Zeit vom Katholizismus ab und dem „freien Denken“ der Philosophie zu, wobei er die traditionellen christlichen Systeme kritisierte.
Was versteht Heidegger unter der „faktischen Wirklichkeit“?
Heidegger sieht die menschliche Existenz als geprägt von Zeitlichkeit und historischer Faktizität. Er fordert eine Rückbesinnung der Philosophie auf diese Wurzeln, statt in metaphysische Weltfluchten zu entgleiten.
Welche Rolle spielt die Sprache in Heideggers Philosophie?
Sprache wird als „Stimme des Seins“ betrachtet. Denken und Sagen sind eng verknüpft; Denken ist letztlich ein Gespräch mit der Welt und dem eigenen Ich.
Was ist laut dem Text die Aufgabe der Theologie?
Die Theologie soll das Wort suchen, das zum Glauben ruft. Sie muss ihre Begriffe an das Seiende anpassen, das sie auszulegen versucht, und innerhalb des Glaubens klären, wie sie zu sprechen hat.
Wie ordnet der Text Heideggers Denken historisch ein?
Heidegger wird als Philosoph des „Zerfalls“ beschrieben, dessen Denken den Expressionismus der Nachkriegszeit widerspiegelt, in der die Welt durch Technisierung aus den Fugen geraten schien.
Was bedeutet der Begriff „objektivierendes Sprechen“?
Der Text nutzt das griechische Wort „legein“ als Paradebeispiel für ein Sprechen, das die Umwelt und die Weltgegenstände gedanklich fixiert und analysiert.
- Arbeit zitieren
- Jan Schenkenberger (Autor:in), 2004, Heideggers Philosophie und die Theologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76130