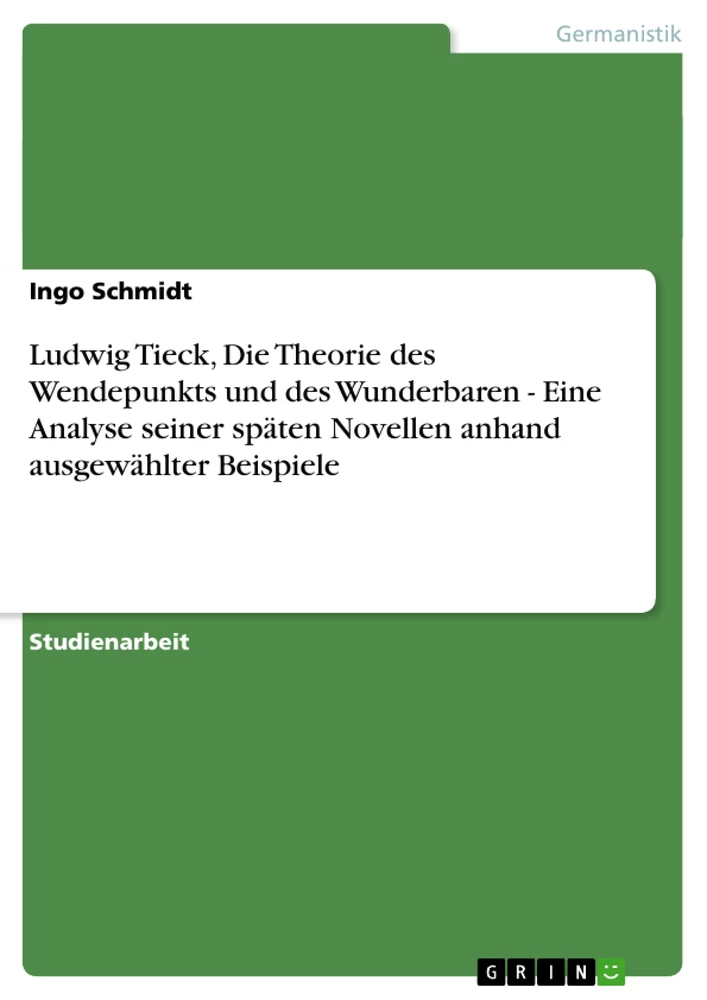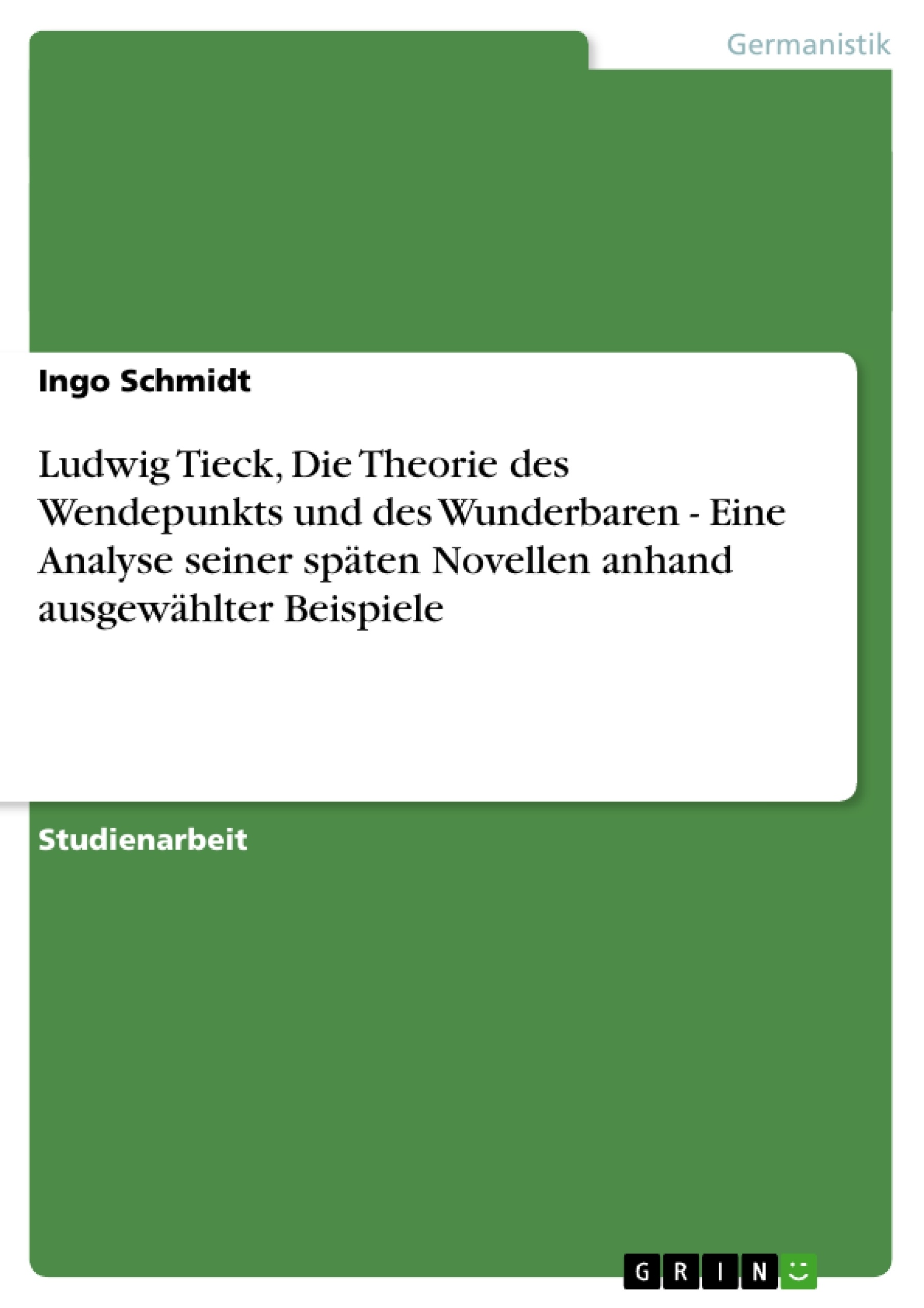Ludwig Tieck, Romantiker und einer der wichtigsten Vertreter des poetischen Realismus im 19. Jahrhundert, ist Mitbegründer der literarischen Gattung „Novelle“, deren Bezeichnung erstmals in Verbindung mit Boccaccios „Decamerone“ (1348/53) verwendet wurde. Im Jahre 1829 formulierte Tieck eine Novellentheorie, in der er auch die für ihn wichtigste Kostituente dieses Genres, den Wendepunkt, charakterisierte. Hierzu äußerte er sich wie folgt:
„Eine Begebenheit sollte anders vorgetragen werden, als eine Erzählung; diese sich von Geschichte unterscheiden, und die Novelle nach jenen Mustern sich dadurch aus allen anderen Aufgaben hervorheben, daß sie einen großen oder kleinern Vorfall ins hellste Licht stelle, der, so leicht er sich ereignen kann, doch wunderbar, vielleicht einzig ist. Diese Wendung der Geschichte, dieser Punkt, von welchem aus sie sich unerwartet völlig umkehrt, und doch natürlich, dem Charakter und den Umständen angemessen, die Folge entwickelt, wird sich der Phantasie des Lesers um so fester einprägen, als die Sache, selbst im Wunderbaren, unter andern Umständen wieder alltäglich seyn könnte. So erfahren wir es im Leben selbst, so sind die Begebenheiten, die, uns von Bekannten aus ihrer Erfahrung mitgetheilt, den tiefsten und bleibendsten Eindruck machen.[...]“
Diese Ausführungen zeigen, dass der Wendepunkt nach Tieck ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu erfüllen hat, die mit dem Motiv des Wunderbaren eng verknüpft sind. Das Ziel dieser Arbeit wird es sein, die Beziehung zwischen dem von Tieck formulierten Wendepunkt und seinem Kolorit des Wunderbaren zu verdeutlichen. Hierbei wird zunächst ein kurzer Überblick über die literatur- und gesellschaftsgeschichtlichen Hintergründe der Novellen Tiecks gegeben. Es folgt eine grobe Zusammenfassung verschiedener Rezeptionspositionen von Tieck-Forschern, in der deren Divergenzen und Konformitäten bezüglich der Wendepunkttheorie und der Theorie des Wunderbaren aufgezeigt werden sollen, bevor diese Punkte anhand konkreter Novellenbeispiele diskutiert werden. Am Ende stellt sich heraus, in wiefern die von Ludwig Tieck aufgestellte Wendepunkttheorie repräsentativ ist für seine eigenen Novellen und in welcher Konsequenz er die grundlegenden Reglementierungen selbst eingehalten hat.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Tieck und die Zeit des poetischen Realismus
- 2. Zur Rezeption der Wendepunkttheorie und des Wunderbaren im Werke Ludwig Tiecks
- 3. Die Gemälde
- 3.1. Kritik zum Wendepunkt in der Novelle „Die Gemälde“
- 4. Das Fest zu Kenelworth
- 5. Die wilde Engländerin/ Das Zauberschloss
- 6. Abschlußanalyse: Hält Ludwig Tieck seine eigenen Regeln ein?
- 6.1. Revision: Die Gemälde
- 6.2. Revision: Das Fest zu Kenelworth
- 6.3. Revision: Die wilde Engländerin/ Das Zauberschloss
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die späten Novellen Ludwig Tiecks im Kontext seiner Wendepunkttheorie und des Motivs des Wunderbaren. Sie untersucht, wie Tieck die von ihm selbst definierte Wendepunkt-Struktur in seinen Novellen einsetzt und wie diese mit dem Wunderbaren zusammenhängt. Die Arbeit beleuchtet auch die literatur- und gesellschaftsgeschichtlichen Hintergründe von Tiecks Werk und die Rezeption seiner Wendepunkttheorie.
- Die Entwicklung der Wendepunkttheorie bei Ludwig Tieck
- Die Rezeption der Wendepunkttheorie in der Forschung
- Das Motiv des Wunderbaren in Tiecks späten Novellen
- Die Verbindung von Wendepunkt und Wunderbarem in ausgewählten Beispielen
- Die Einhaltung der von Tieck selbst aufgestellten Regeln in seinen Novellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Ludwig Tieck als einen der wichtigsten Vertreter des poetischen Realismus vor und führt in seine Wendepunkttheorie ein. Das erste Kapitel befasst sich mit dem historischen und literarischen Kontext von Tiecks Werk und beleuchtet die Entwicklung des poetischen Realismus im 19. Jahrhundert. Das zweite Kapitel analysiert die Rezeption der Wendepunkttheorie bei verschiedenen Tieck-Forschern und zeigt divergierende und konvergierende Ansichten auf.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit einzelnen Novellen, die exemplarisch für Tiecks Wendepunkttheorie und die Verbindung von Wendepunkt und Wunderbarem stehen. Die Kapitel „Die Gemälde“, „Das Fest zu Kenelworth“ und „Die wilde Engländerin/ Das Zauberschloss“ untersuchen jeweils die Konstruktion des Wendepunkts in der jeweiligen Novelle und die Rolle des Wunderbaren.
Das Kapitel „Abschlußanalyse“ analysiert, inwiefern Tieck seine eigenen Regeln für die Wendepunkttheorie in seinen Novellen einhält. Die Kapitel untersuchen jeweils, ob die Novellen die Merkmale des Wendepunkts erfüllen und wie das Wunderbare in den Geschichten eingesetzt wird.
Schlüsselwörter
Ludwig Tieck, Wendepunkt, Wunderbares, poetischer Realismus, Novelle, Romantik, Literaturgeschichte, Rezeption, Analyse, Kunstgeschichte, Erzähltechnik, Struktur, Motiv, Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ludwig Tieck unter dem „Wendepunkt“ in einer Novelle?
Der Wendepunkt ist eine Stelle in der Erzählung, an der sich die Geschichte unerwartet völlig umkehrt, dabei aber natürlich und dem Charakter angemessen bleibt.
Welche Rolle spielt das „Wunderbare“ in Tiecks Novellentheorie?
Das Wunderbare hebt den Vorfall aus dem Alltäglichen hervor und macht ihn einzigartig, obwohl er unter anderen Umständen alltäglich sein könnte.
Welche Werke Tiecks werden in der Analyse untersucht?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Novellen „Die Gemälde“, „Das Fest zu Kenelworth“ und „Die wilde Engländerin / Das Zauberschloss“.
Wird Tiecks Theorie in seinen eigenen Werken konsequent umgesetzt?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwiefern Tieck die von ihm selbst 1829 formulierten Regeln zur Novellenstruktur in seinen späten Werken tatsächlich eingehalten hat.
In welche literarische Epoche lässt sich Ludwig Tieck einordnen?
Tieck gilt als bedeutender Romantiker und Mitbegründer der Gattung Novelle sowie als wichtiger Vertreter des poetischen Realismus im 19. Jahrhundert.
- Quote paper
- B.A. Ingo Schmidt (Author), 2005, Ludwig Tieck, Die Theorie des Wendepunkts und des Wunderbaren - Eine Analyse seiner späten Novellen anhand ausgewählter Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76207