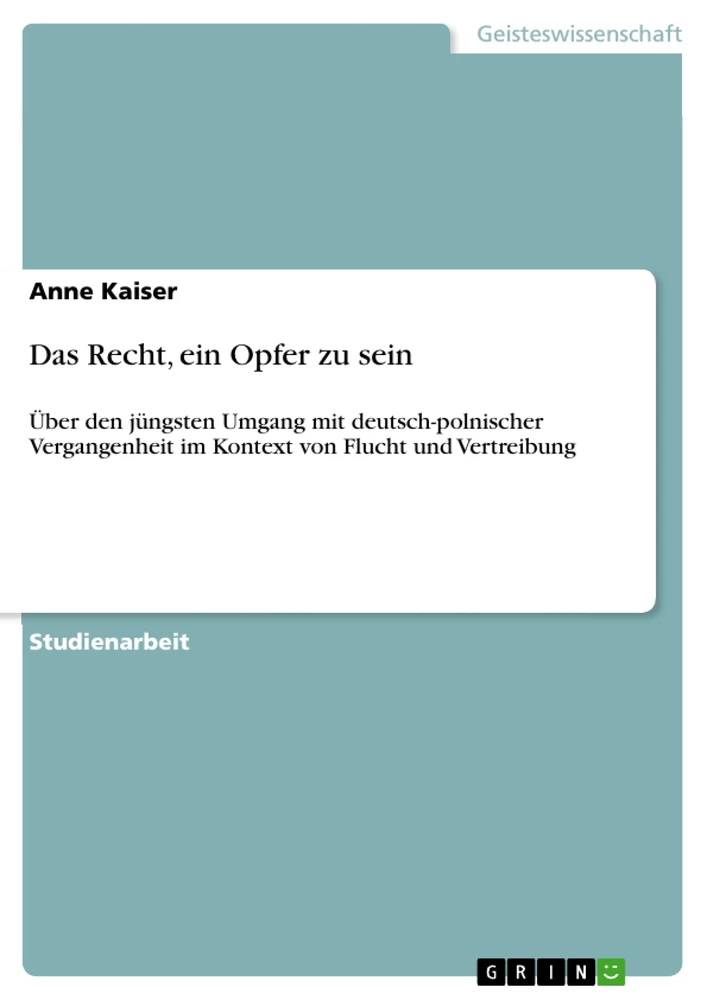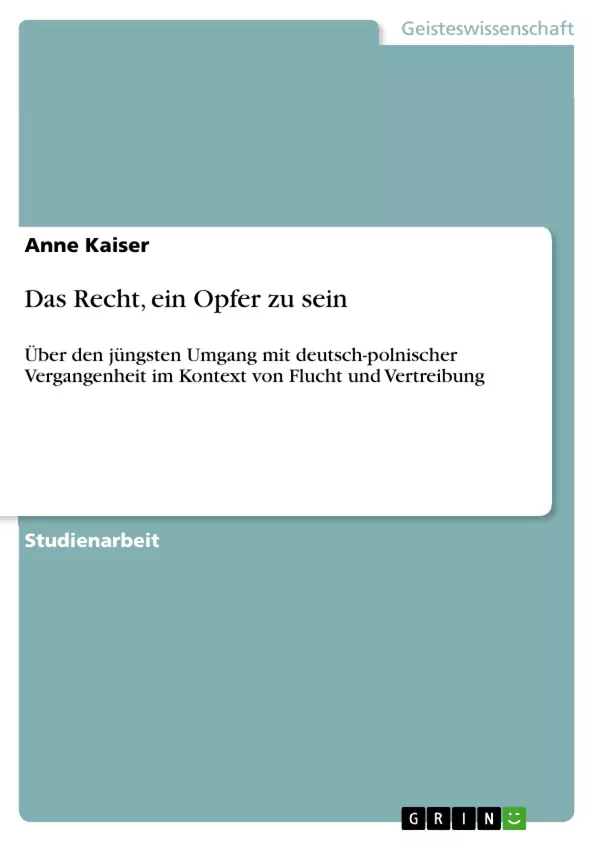Mit dem Jubiläum ‚60 Jahre Kriegsende’ und deren mediale Aufbereitung rücken die Ereignisse von 1945 wieder in nähere Gedächtnis. Gleichzeitig werden immer mehr Stimmen laut, die die Opfer-Seite Deutschlands verstärkt betrachten wollen. Hitler verliert in „Der Untergang“ das Bestialische und entwickelt sich auf der Leinwand zur bemitleidenswerten Kreatur. Das NS-Grauen darf durch Hitler-Sensibilisierung nicht verwaschen werden.
Der Opferstatus ist lukrativ geworden. Kämpfer und Sieger wie die USA werden für ihr Vorgehen im Irak gerügt. Die Opferrolle ermöglicht das Verständnis der Umwelt und Aufmerksamkeit ohne eigene Schuld. Auch die deutschen Vertriebenen fordern für sich den Opferstatus ein. Nur die Zugehörigkeit zu einem Staat oder einer hitlerschen Rasse kann sie nicht zu Tätern deklarieren.
Das Recht, sich Opfer zu nennen wird begründet durch das Verhalten Polens gegenüber der deutschen Minderheit. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurden deutsche Opfer polnischen Nationalismus. Mit der Niederlage Hitler-Deutschlands wurden die Zustände nicht nur revidiert, sondern darüber hinaus zu polnischen Gunsten ausgeweitet.
Die gegenwärtigen Forderungen und Opferdiskussionen erscheinen erst in den letzten drei Jahren ausgebrochen zu sein. Jedoch litten die Deutschen darunter, 45 Jahre lang sich durch die Systemgrenzen nicht aktiv mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen zu können. Mit den jetzigen politischen Verhältnissen blüht die Erinnerung neu auf und formt auch unsere kollektives Bewusstsein.
Der Umgang mit Erinnerung muss gelenkt und gehütete werden. Der Weg sollte nicht in Wiedergutmachungsforderungen sondern in einer gemeinsamen Erinnerungspolitik im europäischen Raum münden.
Inhaltsverzeichnis
- Opfer-Sein - ein Status-Symbol?
- Deutsche als Opfer
- Der Deutsche als Mensch
- Die Vertreibung der Deutschen aus Polen
- Vorgeschichte
- Vorgehensweise
- Die polnische Sicht der Vertreibung
- Verspätete Erinnerung
- 45 Jahre missgönnte Aufarbeitung
- Kollektive Erinnerung
- Erinnerungspolitik
- Gedanken zum Umgang mit der neuen Erinnerungsflut
- Der Ruf nach Entschädigung
- Zentrum gegen Vertreibungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den jüngsten Umgang mit deutsch-polnischer Vergangenheit im Kontext von Flucht und Vertreibung, insbesondere die Debatte um den Opferstatus der Deutschen im Zweiten Weltkrieg.
- Die Rolle des Opferstatus im öffentlichen Diskurs
- Die deutsche Perspektive auf die Vertreibung
- Die polnische Sicht auf die Vertreibung
- Die Herausforderungen der Erinnerungskultur
- Die Debatte um Entschädigungsforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet den aktuellen Diskurs um den Opferstatus der Deutschen und fragt nach dessen Legitimität im Kontext der NS-Verbrechen. Es analysiert den Hintergrund und die Motivationen für die deutsche Opferrhetorik.
- Kapitel zwei fokussiert auf die deutsche Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere die Erfahrungen von Hunger, Bombenkrieg und der Gefangenschaft in der Sowjetunion. Es beleuchtet die Situation des durchschnittlichen Deutschen im Kontext der Kriegsereignisse.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der Vertreibung der Deutschen aus Polen. Es behandelt die Vorgeschichte, die Vorgehensweise sowie die polnische Sicht auf die Vertreibung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Opferstatus, Vertreibung, Erinnerungskultur, deutsch-polnische Beziehungen, kollektives Gedächtnis, NS-Zeit, Zweiter Weltkrieg und Entschädigungsforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter dem "Recht, ein Opfer zu sein" im deutschen Kontext verstanden?
Es beschreibt die zunehmende Tendenz im öffentlichen Diskurs, auch die deutsche Seite als Opfer des Zweiten Weltkriegs (z. B. durch Vertreibung und Bombenkrieg) zu betrachten, ohne dabei die NS-Schuld zu relativieren.
Welche Rolle spielt die Vertreibung der Deutschen aus Polen in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Vorgeschichte, die Vorgehensweise der Vertreibung sowie die gegensätzlichen Sichtweisen (deutsch vs. polnisch) auf diese Ereignisse.
Warum wird die Erinnerung an diese Ereignisse als "verspätet" bezeichnet?
Aufgrund der Systemgrenzen während des Kalten Krieges konnten sich viele Deutsche 45 Jahre lang nicht aktiv mit diesem Teil ihrer Vergangenheit auseinandersetzen; erst nach der Wende blühte diese Erinnerung neu auf.
Was ist das Ziel einer gemeinsamen europäischen Erinnerungspolitik?
Anstatt in Entschädigungsforderungen zu münden, sollte der Weg in eine gemeinsame Aufarbeitung führen, die das kollektive Bewusstsein im europäischen Raum stärkt.
Was wird am Film „Der Untergang“ in diesem Kontext kritisiert?
Es wird die Sorge geäußert, dass durch eine Sensibilisierung für Hitlers menschliche Züge das Grauen der NS-Zeit verwaschen werden könnte.
- Quote paper
- Anne Kaiser (Author), 2005, Das Recht, ein Opfer zu sein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76342