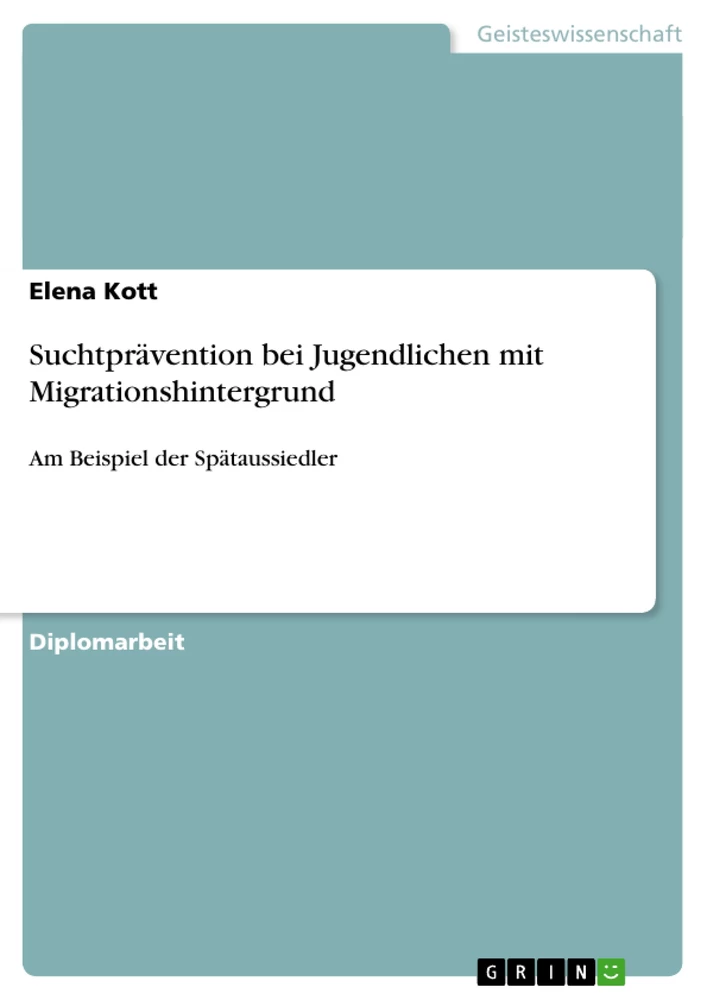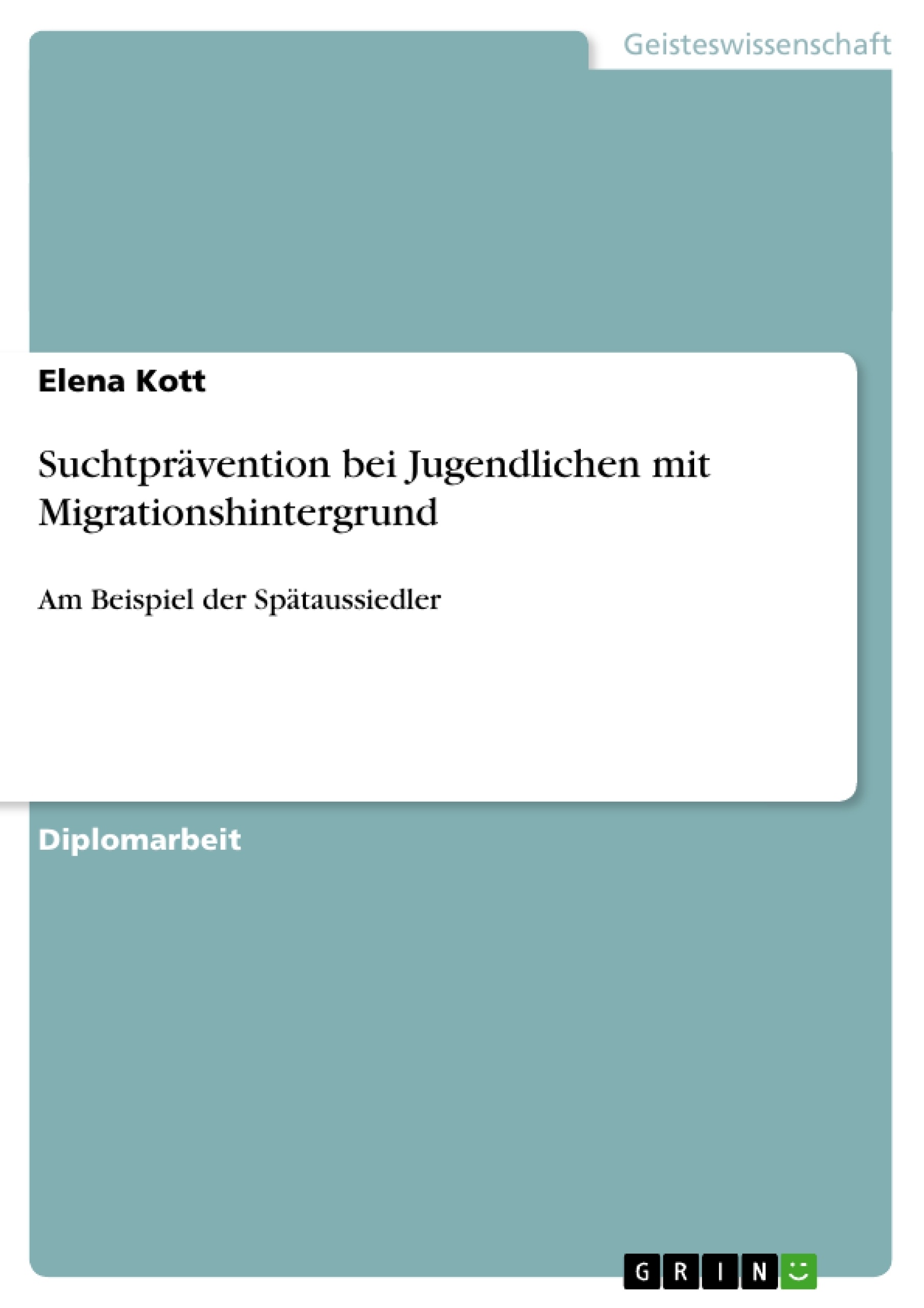Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatte Deutschland Ende 2004 82,501 Mio. Einwohner, darunter ungefähr 3 Mio. in der letzten Zeit zugewanderte Aussiedler. Dies entspricht ca. 3,6 % der Gesamtbevölkerung. 2004 gab es in Deutschland 1.385 Todesopfer im Zusammenhang mit Drogenkonsum, sogenannte Drogentote. Mit 123 Personen lag der Anteil der Spätaussiedler bei 9 % und ist damit in Relation zum Anteil an der Gesamtbevölkerung auf relativ hohem Niveau. Während die Zahl der Drogentoten insgesamt sinkt, ist sie bei Aussiedlern im Jahr 2003 um 25,3 % gestiegen.
Dieser alarmierende Tatbestand ist aber nur die Spitze des Eisbergs der „Drogen, Sucht und Migration“ umfasst viele nicht beschriebene Problemursachen und Problemfolgen. Einige davon sind Drogen, Alkohol, Kulturschock, Sprachbarrieren, schulische und berufliche Eingliederung, Status- und Integrationsprobleme. Jugendliche aus Migrantenfamilien erfahren diesen Stress doppelt. Bedingt durch die alterstypischen Entwicklungsaufgaben sind ihre Belastungen im Vergleich mit einheimischen Jugendlichen gewaltig. Für den größten Teil der jugendlichen Aussiedler verläuft die Integration aber erfolgreich. Für den anderen Teil begünstigen die Folgen auftretender Integrationsprobleme den Rückzug in die eigene Community und setzen jugendliche Migranten der Gefahr aus, im Drogenkonsum einen Kompensationsmechanismus für ihre Akzeptanzprobleme zu suchen. Die Drogen konsumierenden jugendlichen Spätaussiedler fallen durch einige Besonderheiten auf, wie z. B. wesentlich höhere Kritiklosigkeit und Unwissenheit über die Gefahrenpotenziale, schnellerer Verlauf vom Missbrauch zur Abhängigkeit, Mischkonsum von Heroin und Alkohol, hohes Niveau an Beschaffungskriminalität.
Es ist richtig, dass die Suchthilfe für alle, auch für die jugendlichen Aussiedler, ihre Unterstützungsleistungen anbietet. Die Frage ist, ob die für Einheimische entwickelten Präventions-, Beratungs- und Unterstützungsangebote in gleichem Maß für Aussiedler, aber auch für andere Migranten hilfreich bzw. angeboten werden können.Es gibt eine Reihe von Zugangsbarrieren, die das Suchthilfesystem unbewusst und weitgehend unreflektiert für drogengefährdete und drogenabhängige jugendliche Aussiedler errichtet hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 1.2 Zur Wortwahl
- 2 Lebens- und Migrationserfahrungen jugendlicher Aussiedler
- 2.1 Jugend in Russland
- 2.2 Rechtlicher Status von Aussiedlerjugendlichen
- 2.3 Integrationsverläufe jugendlicher Aussiedler und Risikofaktoren, die Drogenkonsum und Suchtentwicklung bedingen
- 2.4 Drogenabhängigkeit von Aussiedlerjugendlichen
- 2.5 Zugangsbarrieren und Probleme jugendlicher Aussiedler im System der Suchthilfe
- 3 Sucht und Abhängigkeit
- 3.1 Zum Begriff ,,Drogen“
- 3.2 Definition der Begriffe Sucht und Abhängigkeit
- 3.2.1 Stoffgebundene und Stoffungebundene Abhängigkeit
- 3.2.2 Physische Abhängigkeit
- 3.2.3 Psychische Abhängigkeit
- 3.3 Erklärungsansätze zur Entstehung von Sucht -und Drogenabhängigkeit
- 3.3.1 Psychoanalytische Suchttheorie
- 3.3.2 Lerntheoretisches Modell
- 3.3.3 Soziologische Theorien
- 3.3.4 Multifaktorieller Ansatz
- 3.4 Drogengebrauch in den Jugendphasen
- 3.5 Einfluss der Peer-group auf das Konsumverhalten
- 4 Zum Begriff der Prävention
- 4.1 Primäre Prävention
- 4.2 Sekundäre Prävention
- 4.3 Tertiäre Prävention
- 4.4 Suchtpräventionen als integrativer Bestandteil der Gesundheitserziehung und -Förderung bei jugendlichen Spätaussiedlern
- 4.5 Berücksichtigung rechtlicher Aspekte
- 4.6 Aufgaben und Ziele pädagogische Suchtprävention: Abstinenz oder Konsumtoleranz?
- 4.7 Erziehung zur Genussfähigkeit
- 5 Handlungskonzepte für Soziale Arbeit mit Suchtgefährdeten jugendlichen Spätaussiedlern
- 5.1 Case Management
- 5.2 Streetwork
- 5.3 Mobile Jugendarbeit bei Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien
- 6 Interkulturelle Öffnung der Suchthilfe
- 6.1 Die Notwendigkeit der interkulturellen kompetenten Sozialen Arbeit mit den Migranten
- 6.2 Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und die Bedeutung der Muttersprache
- 6.3 Anforderungen an das System der Suchthilfe
- 7 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit zielt darauf ab, die spezifischen Herausforderungen der Suchtprävention bei jugendlichen Spätaussiedlern zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Lebens- und Migrationserfahrungen dieser Jugendlichen, die mit ihnen verbundenen Risikofaktoren für Drogenkonsum und die besonderen Zugangsbarrieren im Suchthilfesystem.
- Lebensbedingungen und Migrationserfahrungen jugendlicher Aussiedler
- Risikofaktoren für Drogenkonsum und Suchtentwicklung bei jugendlichen Spätaussiedlern
- Zugangsbarrieren im Suchthilfesystem für jugendliche Aussiedler
- Konzeptionelle Ansätze und Ziele der Suchtprävention
- Handlungskonzepte für die soziale Arbeit mit suchtgefährdeten jugendlichen Spätaussiedlern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die Relevanz der Suchtprävention bei jugendlichen Spätaussiedlern und stellt den Aufbau der Arbeit dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Lebens- und Migrationserfahrungen jugendlicher Aussiedler. Es beleuchtet die Lebensbedingungen in Russland, den rechtlichen Status von Aussiedlerjugendlichen und die mit der Migration verbundenen Integrationsverläufe und Risikofaktoren.
Das dritte Kapitel definiert die Begriffe Sucht und Abhängigkeit und analysiert verschiedene Erklärungsansätze zur Entstehung von Sucht und Drogenabhängigkeit.
Im vierten Kapitel wird der Begriff der Prävention betrachtet, unterschiedliche Präventionsformen (primär, sekundär, tertiär) und die Bedeutung der Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler erläutert.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit Handlungskonzepten für die soziale Arbeit mit suchtgefährdeten jugendlichen Spätaussiedlern, wie Case Management, Streetwork und Mobile Jugendarbeit.
Das sechste Kapitel behandelt die Notwendigkeit einer interkulturellen Öffnung der Suchthilfe und die Bedeutung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund.
Schlüsselwörter
Suchtprävention, jugendliche Spätaussiedler, Migrationshintergrund, Risikofaktoren, Drogenkonsum, Suchtentwicklung, Zugangsbarrieren, interkulturelle Kompetenz, Suchthilfe, Handlungskonzepte, soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind jugendliche Spätaussiedler besonders suchtgefährdet?
Faktoren wie Kulturschock, Sprachbarrieren, Statusprobleme und Integrationsschwierigkeiten erzeugen Stress, der oft durch Drogenkonsum kompensiert wird.
Was sind Besonderheiten des Drogenkonsums bei dieser Gruppe?
Auffällig sind oft ein schnellerer Verlauf zur Abhängigkeit, Mischkonsum (z. B. Heroin und Alkohol) sowie Unwissenheit über die Gefahrenpotenziale der Stoffe.
Welche Barrieren gibt es im deutschen Suchthilfesystem?
Es bestehen Zugangsbarrieren durch mangelnde interkulturelle Öffnung, Sprachbarrieren und Angebote, die primär auf die einheimische Bevölkerung zugeschnitten sind.
Was bedeutet „interkulturelle Öffnung“ der Suchthilfe?
Es umfasst die Einstellung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund, muttersprachliche Beratung und die Sensibilisierung des Personals für unterschiedliche kulturelle Hintergründe.
Welche Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit werden empfohlen?
Empfohlen werden Case Management, Streetwork und mobile Jugendarbeit, um die Jugendlichen direkt in ihrem Lebensumfeld zu erreichen.
- Arbeit zitieren
- Elena Kott (Autor:in), 2007, Suchtprävention bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76463