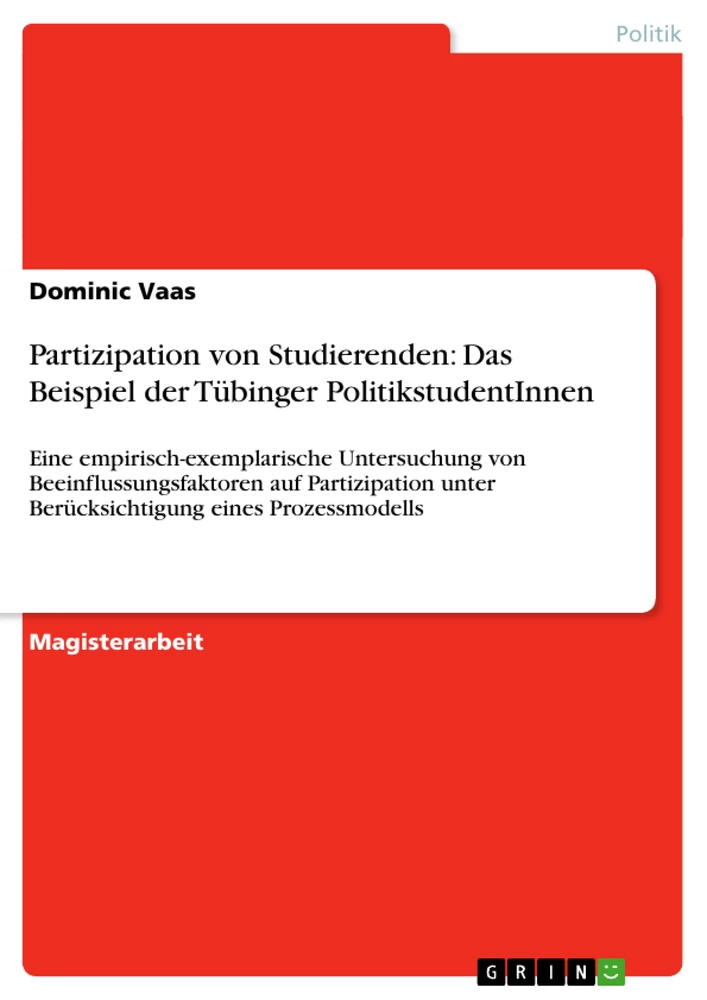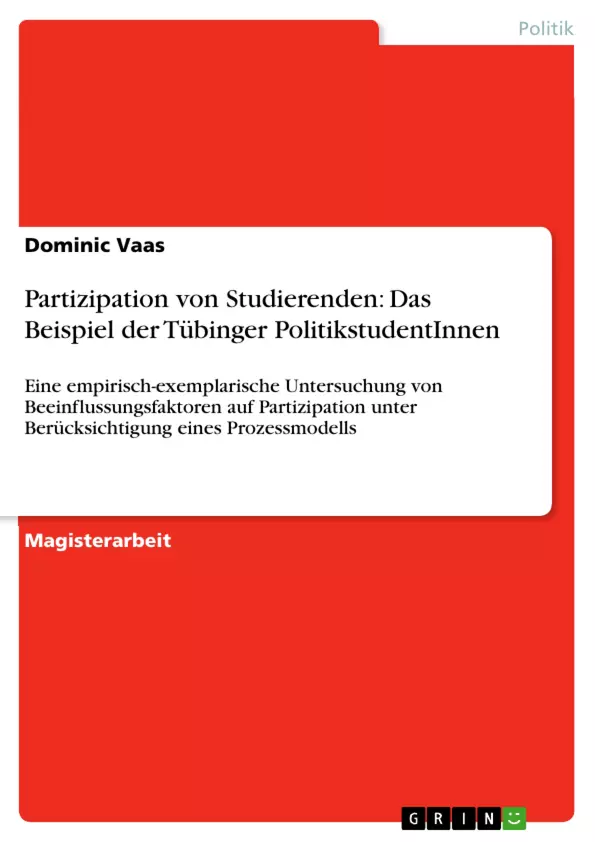Der Untersuchungsgegenstand:
Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die konventionelle u. die unkonventionelle politische Partizipation von Studierenden, aufgezeigt am Beispiel der PolitikstudentInnen in Tübingen, mittels einer Befragung dieser Studierenden (160 Befragte).
Eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes über Partizipation in der BRD ist diesem Untersuchungsgegenstand vorangestellt.
In einem zweiten Schritt wird dann gefragt: „Was wissen wir eigentlich über das politische Interesse, die politischen Einstellungen und das Partizipationsverhalten von Studierenden?“
Zudem wird ein Prozessmodell für politische Partizipation vorgestellt.
Als wichtigster Gegenstand der Untersuchung spielen dann das politische Interesse, die politischen Einstellungen und schließlich das Wissen u. das Verhalten im Bereich der Partizipation der befragten Tübinger StudentInnen für das Forschungsinteresse die zentrale Rolle.
Diese exemplarische Darstellung und Auseinandersetzung mit dem Partizipationsverhalten der Tübinger Studierenden soll letztlich auch dem Erkenntnisziel dienen, wichtige Determinanten für politische Partizipation anhand eines „Praxistests“ herauszustellen.
Fragestellung und Erkenntnisziel:
Das Erkenntnisziel meiner Arbeit richtet sich dabei besonders auf die Wahrnehmung von Partizipationsmöglichkeiten, die politischen Einstellungen, sowie das Ausmaß der tatsächlichen politischen Partizipation von Tübinger PolitikstudentInnen.
Das wichtigste Erkenntnisziel der Studie ist also die Darstellung eines Partizipationsprofils Tübinger PolitikstudentInnen.
Das zweite Erkenntnisziel dieser Forschungsarbeit ist es, mögliche Faktoren zu finden, die dabei helfen können das Partizipationsverhalten der Tübinger Politikstudierenden zu erklären.
Daran schließt sich das dritte Erkenntnisziel meiner Arbeit an, nämlich die Frage nach den Motiven und Hinderungsgründen für bzw. gegen Partizipation.
Hauptfragen:
1.) „Wie gestaltet sich die Wahrnehmung von Partizipationsmöglichkeiten und die tatsächliche Partizipation von Tübinger Politikstudierenden?“
2.) „Welche Faktoren beeinflussen das Partizipationsverhalten der Tübinger PoltitkstudentInnen am meisten und welche spielen eine untergeordnete Rolle?“
3.) „Welche Motive und Motivationen gibt es für – und was für Hinderungsgründe gibt es gegen eine politische Partizipation bei den Tübinger PolitikstudentInnen?“
Mit umfangreicher Literaturliste.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Rückblick
- 1.2. Der Untersuchungsgegenstand
- 1.3. Fragestellung und Erkenntnisziel
- 1.4. Vorgehen und Methode
- 2. Theoretische und begriffliche Grundlagen
- 2.1. Definition von Partizipation
- 2.2. Politische Sozialisation (Definition)
- 2.3. Analytische Dimensionen politischer Partizipation
- 2.4. Reale Formen von Partizipation
- 2.5. Allgemeine Grundlagen der Partizipationsforschung: Retrospektive
- 2.6. Das Prozessmodell politischer Partizipation
- 2.7. Das Modell politischer Partizipation an Hochschulen
- 2.8. Synthese: Das Modell politischer Partizipation Studierender
- 2.9. Fragebogenkonstruktion
- 3. Politische Partizipation und soziales Engagement in der BRD
- 3.1. Politisches Interesse
- 3.2. Informationsquellen
- 3.3. Politische Einstellungen
- 3.3.1. Demokratiezufriedenheit
- 3.3.2. Institutionenvertrauen
- 3.3.3. Beteiligungschancen
- 3.4. Konventionelle Partizipation: Wahlteilnahmen
- 3.4.1. Direkte Beteiligung: Plebiszite
- 3.4.2. Direkte Beteiligung: Politische Ämter
- 3.5. Unkonventionelle Partizipation
- 3.6. Freiwilliges soziales Engagement in Vereinen und Bürgergruppen
- 3.7. Die Bedeutung der finanziellen Situation
- 3.8. Zusammenfassung
- 4. Partizipation junger Erwachsener und Studierender: Thesenbildung
- 4.1. Das Alter der Befragten als Untersuchungsvariable
- 4.2. Stand der Forschung
- 4.3. Jugendstudien
- 4.4. Wertewandel
- 4.5. Parteipräferenzen
- 4.6. Politische Einstellungen auf der Links-Recht-Skala
- 4.7. Politisches Interesse
- 4.8. Politische Partizipation
- 4.9. Soziale Bindungen
- 5. Deskriptive Darstellung der Umfrageergebnisse
- 5.1. Teil 1: Politische Einstellungen und politisches Interesse
- 5.1.1. Politisches Interesse
- 5.1.2. Themeninteressen
- 5.1.3. Links-Rechts-Einstufung
- 5.1.4. Zuweisung von Verantwortung
- 5.1.5. Bewertung der Beteiligungsmöglichkeiten und –Chancen
- 5.2. Teil 2: Gesellschaftliche und politische Beteiligung
- 5.2.1. Wahlteilnahmen
- 5.2.2. Parteipräferenzen
- 5.2.3. Sonntagsfrage
- 5.2.4. Gründe für Wahlenthaltung
- 5.2.5. Aktive Mitgliedschaften
- 5.2.6. Politisches und soziales Engagement
- 5.2.7. Demokratieverständnis
- 5.2.8. Kenntnis und Teilnahmen im universitätsnahen Bereich
- 5.3. Teil 3: Persönlicher und sozialer Hintergrund
- 5.3.1. Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit
- 5.3.2. Angestrebter Abschluss
- 5.3.3. Semesterzahl
- 5.3.4. Bildungsniveau der Eltern
- 5.3.5. Überwiegende Wohnstätte
- 5.3.6. Finanzielle Lage
- 5.3.7. Verfügbare Freizeit
- 5.3.8. Arbeitspensum neben dem Studium
- 5.3.9. Ausmaß des Engagements in Studien- und Herkunftsort
- 5.4. Teil 4: Informationsquellen und Einflüsse
- 5.4.1. Parteipräferenzen der Eltern
- 5.4.2. Informationsquellen
- 5.4.3. Gruppen mit ähnlichen politischen Ansichten
- 5.5. Teil 5: Motive für politische Teilnahme
- 5.5.1. Gründe für Partizipation
- 5.5.2. Hinderungsgründe gegen Partizipation
- 5.5.3. Einfluss des Studiums auf Partizipation
- 5.6. Zusammenfassung der Umfrageergebnisse
- Einflussfaktoren auf politische Partizipation von Studierenden
- Anwendung eines Prozessmodells zur Analyse der Partizipation
- Vergleich der Partizipation von Studierenden mit der allgemeinen politischen Partizipation in der BRD
- Analyse des Zusammenhangs zwischen soziodemografischen Merkmalen und Partizipation
- Rolle des Studiums als Einflussfaktor auf die politische Partizipation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Partizipation von Politikstudenten in Tübingen. Ziel ist es, Einflussfaktoren auf die Partizipation zu identifizieren und mit Hilfe eines Prozessmodells zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der studentischen Partizipation ein, beschreibt den Untersuchungsgegenstand und formuliert die Forschungsfragen und das Erkenntnisziel der Arbeit. Es skizziert die Methodik und das Vorgehen der empirischen Untersuchung.
2. Theoretische und begriffliche Grundlagen: Hier werden zentrale Begriffe wie Partizipation und politische Sozialisation definiert und verschiedene Dimensionen politischer Partizipation analysiert. Es wird ein Prozessmodell der politischen Partizipation vorgestellt und auf den Kontext von Hochschulen angewendet, schließlich wird dieses Modell für die Untersuchung der Partizipation von Studierenden adaptiert. Die Konstruktion des verwendeten Fragebogens wird ebenfalls erläutert.
3. Politische Partizipation und soziales Engagement in der BRD: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Stand der politischen Partizipation und des sozialen Engagements in Deutschland. Es analysiert politische Interessen, Informationsquellen, Einstellungen (Demokratiezufriedenheit, Institutionenvertrauen, Beteiligungschancen), konventionelle und unkonventionelle Partizipationsformen sowie das freiwillige soziale Engagement. Die Bedeutung der finanziellen Situation wird ebenfalls beleuchtet.
4. Partizipation junger Erwachsener und Studierender: Thesenbildung: Dieses Kapitel befasst sich mit der spezifischen Partizipation junger Erwachsener und Studierender. Es analysiert den Forschungsstand zu diesem Thema, beleuchtet Aspekte wie Jugendstudien, Wertewandel, Parteipräferenzen und politische Einstellungen. Es werden Hypothesen zu den Einflussfaktoren auf die Partizipation dieser Gruppe aufgestellt.
5. Deskriptive Darstellung der Umfrageergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage. Es gliedert die Ergebnisse in fünf Teile: politische Einstellungen und Interessen, gesellschaftliche und politische Beteiligung, persönlicher und sozialer Hintergrund, Informationsquellen und Einflüsse sowie Motive für politische Teilnahme. Die Ergebnisse werden deskriptiv dargestellt und bilden die Grundlage für die Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Partizipation, Studierende, Politische Partizipation, Prozessmodell, Einflussfaktoren, Hochschulen, Tübingen, Empirische Untersuchung, Fragebogen, Politische Sozialisation, Jugend, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Politische Partizipation von Studierenden in Tübingen
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die politische Partizipation von Studierenden der Universität Tübingen. Sie analysiert Einflussfaktoren auf diese Partizipation und verwendet hierfür ein Prozessmodell.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Studie untersucht Einflussfaktoren auf die politische Partizipation von Studierenden, wendet ein Prozessmodell zur Analyse an, vergleicht die Partizipation von Studierenden mit der allgemeinen politischen Partizipation in Deutschland, analysiert den Zusammenhang zwischen soziodemografischen Merkmalen und Partizipation und untersucht die Rolle des Studiums als Einflussfaktor.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Studie verwendet eine empirische Untersuchung mit einem Fragebogen. Der Fragebogen wurde entsprechend einem entwickelten Prozessmodell konstruiert, welches die politischen Partizipation von Studierenden modelliert.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Studie basiert auf Definitionen von Partizipation und politischer Sozialisation. Es wird ein Prozessmodell politischer Partizipation vorgestellt und auf den Kontext von Hochschulen angewendet. Es werden verschiedene Dimensionen politischer Partizipation (konventionell und unkonventionell) analysiert.
Welche Aspekte der politischen Partizipation werden betrachtet?
Die Studie untersucht politisches Interesse, Informationsquellen, politische Einstellungen (Demokratiezufriedenheit, Institutionenvertrauen, Beteiligungschancen), konventionelle Partizipation (Wahlteilnahme, politische Ämter), unkonventionelle Partizipation, freiwilliges soziales Engagement, soziodemografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildung, finanzielle Situation), Parteipräferenzen und Motive für politische Teilnahme.
Wie sind die Ergebnisse der Studie strukturiert?
Die Ergebnisse der Umfrage werden in fünf Teilen präsentiert: Politische Einstellungen und Interessen, gesellschaftliche und politische Beteiligung, persönlicher und sozialer Hintergrund, Informationsquellen und Einflüsse sowie Motive für politische Teilnahme. Die Ergebnisse werden deskriptiv dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Partizipation, Studierende, Politische Partizipation, Prozessmodell, Einflussfaktoren, Hochschulen, Tübingen, Empirische Untersuchung, Fragebogen, Politische Sozialisation, Jugend, Deutschland.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung, Theoretische und begriffliche Grundlagen, Politische Partizipation und soziales Engagement in der BRD, Partizipation junger Erwachsener und Studierender: Thesenbildung und Deskriptive Darstellung der Umfrageergebnisse. Jedes Kapitel wird im HTML-Dokument zusammengefasst.
Gibt es einen Vergleich mit der allgemeinen politischen Partizipation in der BRD?
Ja, die Studie vergleicht die Partizipation der befragten Studierenden mit der allgemeinen politischen Partizipation in Deutschland.
Welche Rolle spielt das Studium in der Studie?
Das Studium wird als möglicher Einflussfaktor auf die politische Partizipation der Studierenden untersucht.
- Arbeit zitieren
- Mag. Dominic Vaas (Autor:in), 2006, Partizipation von Studierenden: Das Beispiel der Tübinger PolitikstudentInnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76480