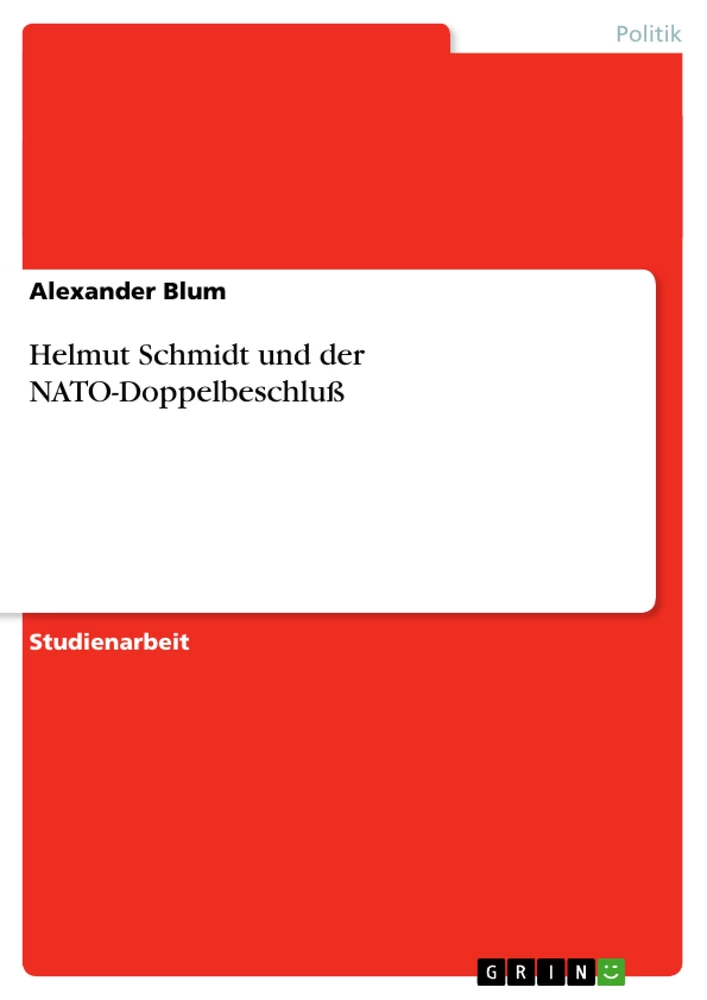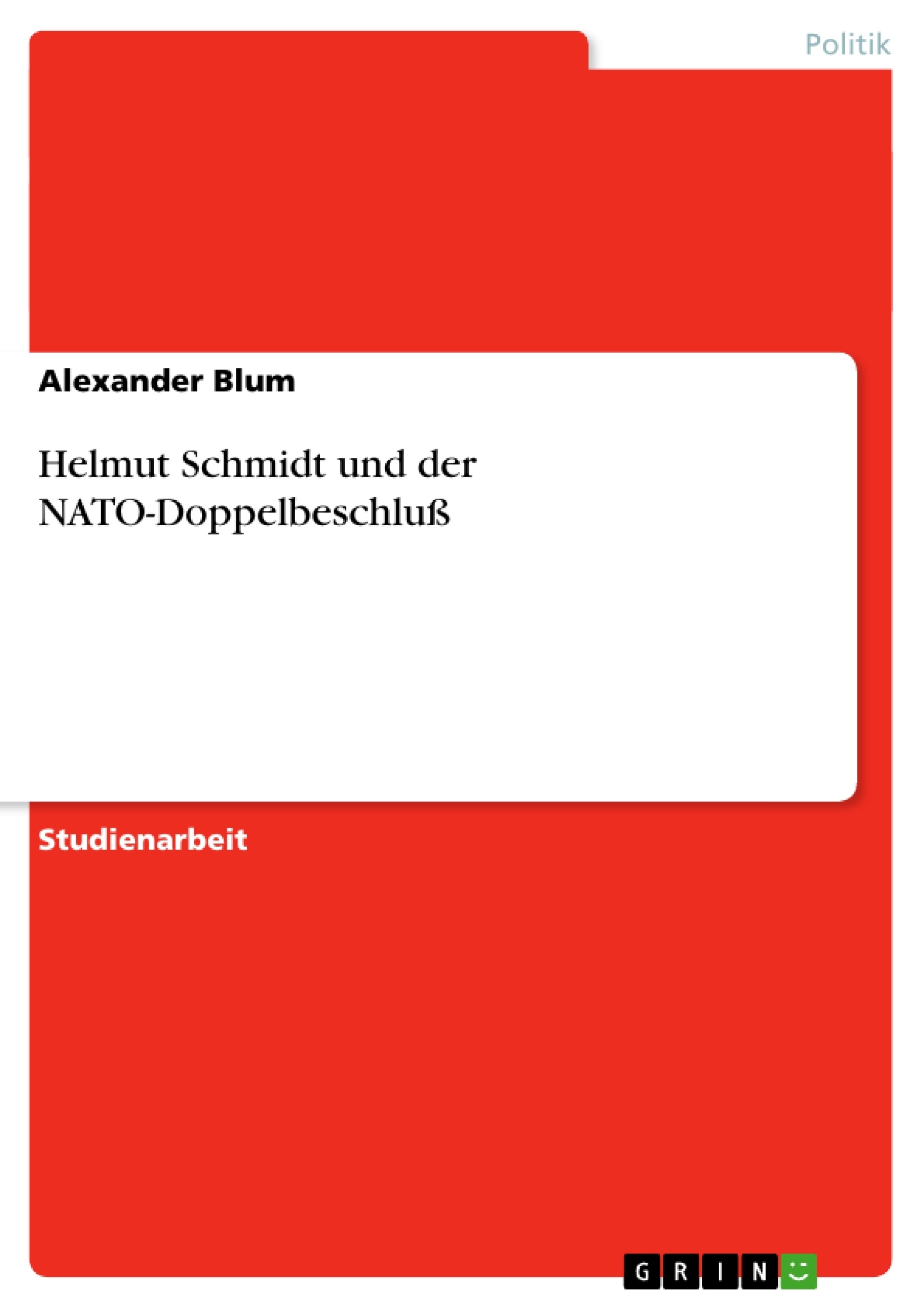Kaum eine andere politische Entscheidung, seit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik in den fünfziger Jahren unter Bundeskanzler Adenauer, führte zu ähnlich kontroversen Diskussionen in Deutschland, wie der NATO -Doppelbeschluss von 1979. Dieser enthielt ein Programm zur Modernisierung und Verstärkung der Nuklearsysteme und gleichzeitig signalisierte er Verhandlungsbereitschaft, sowie Initiativen zum Vorantreiben der Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion.
Mit dem Beschluss sollte dem durch Aufrüstung und Modernisierung der sowjetischen Seite entstandenen militärischem Ungleichgewicht in Europa begegnet werden. Innenpolitisch wurde er von starken Protesten, hervorgerufen durch die Angst eines nuklearen "Overkills" , begleitet. Trotz dieses Widerstandes setzte Helmut Schmidt sich für die Entwicklung der "ERW" ein und später für den Doppelbeschluss.
Im Folgenden soll deshalb erörtert werden, warum Schmidt an seiner Forderung nach Nachrüstung festhielt und welche Entwicklung dem Beschluss vorausging. Hierfür wird es notwendig sein, Schmidts Gleichgewichtsphilosophie genauer zu betrachten. Sein Buch "Strategie des Gleichgewichts", sowie seine Londoner Rede von 1977 sind dafür besonders geeignet. Ebenso zu untersuchen sein wird die Bedeutung des "Neutronenwaffen"-Debakels, und die sicherheitspolitische Lage in einem groben Überblick, sowie schließlich der Beschluss selber, seine Folgen und ob hierdurch ein bedeutender Beitrag zur Abrüstung und Entspannung geleistet werden konnte, und inwieweit Schmidt selber hierfür verantwortlich war.
Von der reichlich vorhandenen Literatur zu diesem Thema stechen "Sicherheit und Stabilität. [...]" von Helga Haftendorn, sowie "Erinnerungen" von Hans-Dietrich Genscher und die Rede Helmut Schmidts in London 1977 besonders hervor, da diese
einen sehr detaillierten Überblick zu der Thematik bieten.
Durch die Komplexität des Themas können nicht alle Aspekte der Diskussion um die "Neutronenwaffe" und den NATO-Doppelbeschluss betrachtet und erklärt werden. Vor allem die innerparteilichen Kontroversen werden nur kurz beleuchtet, und die Positionen der Protagonisten Großbritanniens (James Callaghan) und Frankreichs (Giscard d´Estaing) nicht behandelt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Helmut Schmidts politisches Denken
- a) Die Strategie des Gleichgewichts
- b) Der Politiker als Verantwortungsethiker
- c) Schmidts Rede vor dem Internationalen Institut für Strategische Studien
- III. Die sicherheitspolitische Lage
- a) Die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik
- b) Das Debakel um die „,Neutronenwaffe“
- c) Die SALT und MBFR Abrüstungsverhandlungen und die Entstehung der „,Grauzonenproblematik“
- IV. Der NATO-Doppelbeschluss
- a) Die Entstehungsphase
- b) Der doppelte Beschluss
- c) Das doppelte Missverständnis
- d) Die unmittelbaren Folgen des Beschlusses
- V. Ein Rückblick aus heutiger Sicht (Schlussbetrachtung)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle Helmut Schmidts im Kontext des NATO-Doppelbeschlusses von 1979. Sie beleuchtet die Entstehungsbedingungen des Beschlusses, Schmidts sicherheitspolitisches Denken und die Folgen des Beschlusses. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich Schmidt im Angesicht der sich verändernden sicherheitspolitischen Landschaft der 1970er Jahre gegenüber sah.
- Die Strategie des Gleichgewichts und ihre Rolle in Schmidts politischem Denken
- Die Bedeutung des NATO-Doppelbeschlusses für die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland
- Die sicherheitspolitische Lage der 1970er Jahre und die Herausforderungen für die Bundesrepublik
- Der Einfluss des „Neutronenwaffen“-Debakels auf die Entscheidung zum Doppelbeschluss
- Die Folgen des Doppelbeschlusses für die Entspannungspolitik und die Abrüstungsverhandlungen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des NATO-Doppelbeschlusses ein und skizziert die Bedeutung dieses Ereignisses für die deutsche Geschichte. Sie stellt die wichtigsten Protagonisten und ihre Positionen vor, beleuchtet die kontroversen Diskussionen um den Doppelbeschluss und die politischen Hintergründe des Beschlusses.
II. Helmut Schmidts politisches Denken: Dieses Kapitel beleuchtet die sicherheitspolitische Philosophie von Helmut Schmidt und seine „Strategie des Gleichgewichts“. Es analysiert die Bedeutung des Prinzips des Gleichgewichts für Schmidts außenpolitisches Denken und seine Haltung zum NATO-Doppelbeschluss.
III. Die sicherheitspolitische Lage: Das Kapitel beleuchtet die sicherheitspolitische Situation der 1970er Jahre. Es analysiert die sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik im Kontext des Kalten Krieges, die Aufrüstung der Sowjetunion und die entstehende „Grauzonenproblematik“. Außerdem untersucht dieses Kapitel die Auswirkungen des „Neutronenwaffen“-Debakels auf die sicherheitspolitische Debatte.
IV. Der NATO-Doppelbeschluss: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung, den Inhalten und den Folgen des NATO-Doppelbeschlusses. Es beleuchtet die Entstehungsphase des Beschlusses, die politischen Verhandlungen, die verschiedenen Perspektiven auf den Beschluss und die unmittelbaren Auswirkungen des Beschlusses auf die politische Landschaft.
Schlüsselwörter
NATO-Doppelbeschluss, Helmut Schmidt, Sicherheitspolitik, Strategie des Gleichgewichts, Gleichgewicht, Entspannung, Abrüstung, Kalter Krieg, „Neutronenwaffe“, SALT-Verhandlungen, MBFR-Verhandlungen, „Grauzonenproblematik“
- Arbeit zitieren
- Alexander Blum (Autor:in), 2001, Helmut Schmidt und der NATO-Doppelbeschluß, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7649