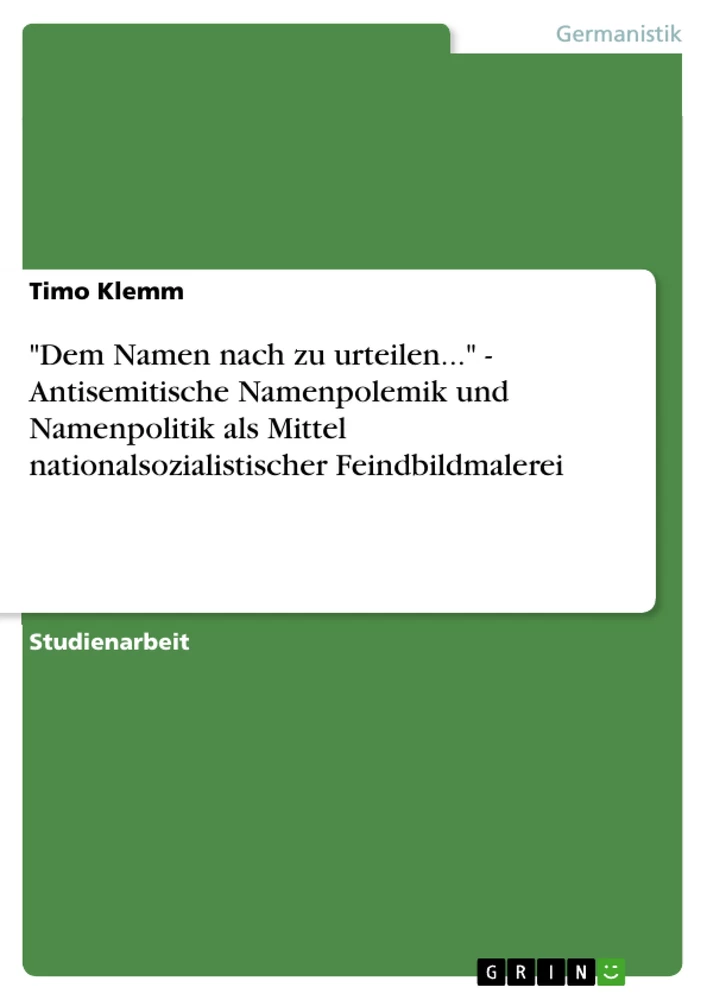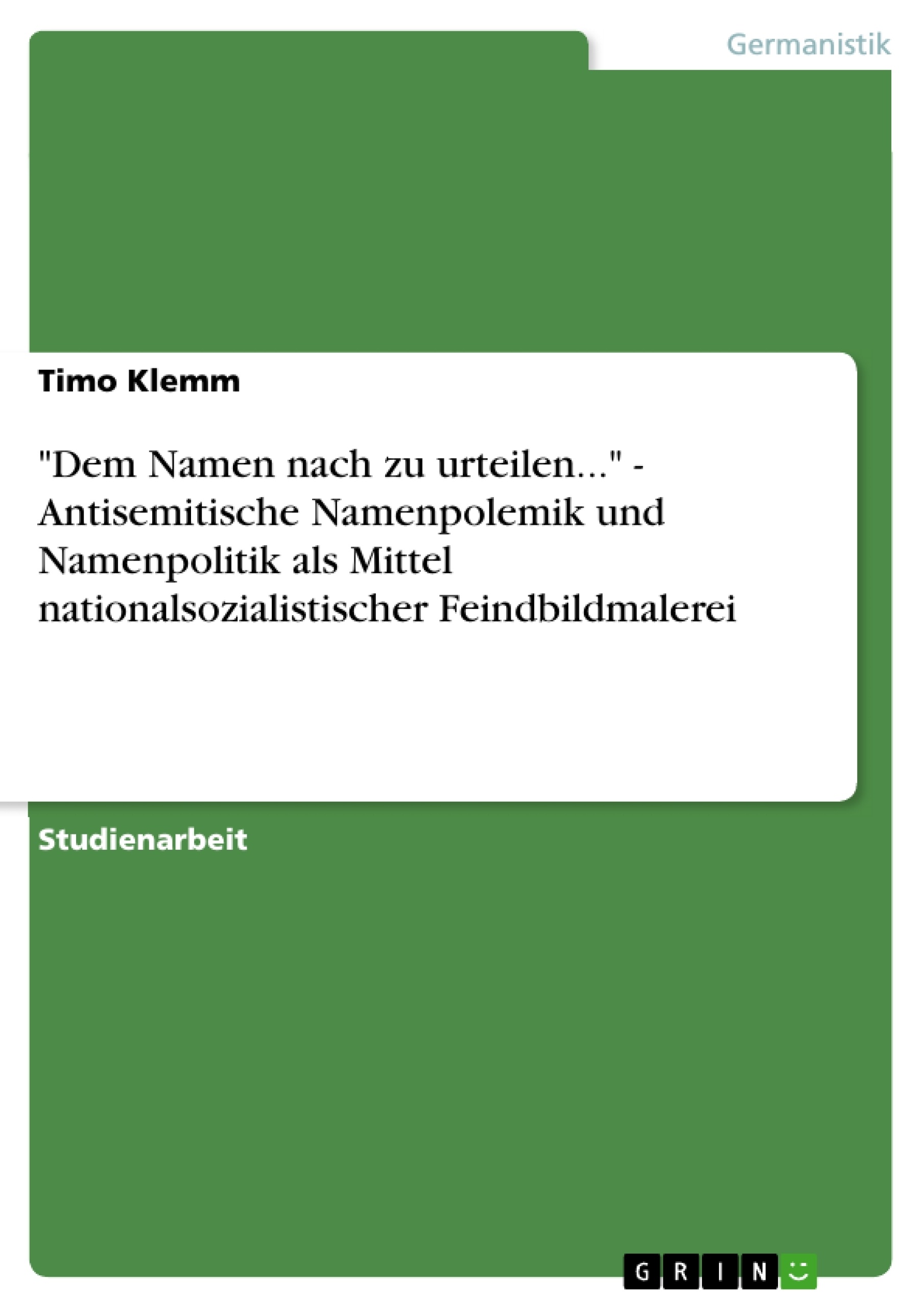Sowohl zahlreiche Witze, Spottlieder und Karikaturen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, die – mündlich überliefert oder in antisemitischen Propagandazeitschriften verbreitet – vermeintlich typisch jüdische Namen aufgriffen und parodierten, als auch Verbalattacken von Politikern, die den tatsächlichen oder angedichteten jüdischen Namen ihrer Opfer als Mittel der Verleumdung und Diffamierung nutzten, zeugen von einer schon vor dem Nationalsozialismus bestehenden Tradition antisemitischer Namenpolemik. Dieser Tradition folgend ist es nur konsequent, wenn der in der Rhetorik nationalsozialistischer Rädelsführer als ‚undeutsches’ Brandmal verwendete jüdische Name schließlich sein Pendant im stilisierten „wahrhaft deutschen Namen“ fand, einem in seiner Bedeutung schwankenden Begriff , dem angeschlossen alsbald auch die Forderung laut wurde: „Deutschen Kindern – Deutsche Namen!“
An diesen kurzen historischen Überblick anschließend ergeben sich nun folgende Überlegungen und Fragestellungen:
Wie wurden Namen von den Nazis zu antisemitischen oder anderen ideologischen Zwecken instrumentalisiert? Wodurch war dies möglich?
Warum sind Namen ein geeignetes Mittel der Kennzeichnung, welchen sprachtheoretischen Status haben sie?
Was bedeutet der Name seinem Träger, in wie weit identifiziert dieser sich mit jenem und welche Folgen haben Angriffe auf den Namen?
Haben Namen eine soziale Funktion, üben sie in irgendeiner Weise Wirkung auf das Umfeld des Trägers aus?
Woher kommen die verschiedenen Namen, wo liegen die Unterschiede? Gibt es für bestimmte Volksgruppen typische Namen und wenn ja, was lässt sie als typisch erscheinen?
Welche Erkenntnis über die Mentalität der Deutschen zur NS-Zeit kann man aus der Beanwortung dieser Fragen gewinnen?
Da viele dieser Fragen nicht ausschließlich den Nationalsozialismus betreffen, sondern eher allgemeiner Natur sind, erscheint es sinnvoll, ihre Bearbeitung als Basis späterer Konkretisierungen vornan zu stellen. Dies soll nun in Form eines namentheoretischen bzw. namenkundlichen Überblicks geschehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Namentheorie und Namenkunde
- 2.1 Propria vs. Appellativa
- 2.2 Namenpsychologie
- 2.3 Zur Geschichte deutscher Namen
- 2.3.1 Ruf- und Vornamen
- 2.3.2 Die Entstehung der Familiennamen
- 2.3.3 Jüdische Namen
- 3. Namenpolemik und Namenpolitik
- 3.1 Die namenpolemische Propaganda der „Kampfzeit“
- 3.2 Namenpolitik im „Dritten Reich“
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Instrumentalisierung von Namen im Nationalsozialismus als Mittel antisemitischer Feindbildmalerei. Sie beleuchtet die sprachtheoretischen Grundlagen der Namensgebung und deren Bedeutung für die Identität des Namensträgers. Die Analyse fokussiert auf die Entwicklung und Anwendung der Namenpolemik und -politik im Dritten Reich.
- Sprachtheoretische Grundlagen von Namen (Propria vs. Appellativa)
- Die Geschichte deutscher Namen und die Besonderheiten jüdischer Namen
- Antisemitische Namenpolemik im 19. und frühen 20. Jahrhundert
- Namenpolitik im Nationalsozialismus (Kennzeichnungspflicht, Namensänderungen)
- Die soziale Funktion von Namen und deren Wirkung auf das Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie wurden Namen im Nationalsozialismus instrumentalisiert, und welche sprachtheoretischen und soziologischen Aspekte sind damit verbunden? Sie veranschaulicht die Verwendung jüdischer Namen als Kennzeichen und die damit verbundene Entmenschlichung. Die Kennzeichnungspflicht von Juden mit dem Namen "Israel" oder "Sara" und das Tragen des gelben Sterns werden als Beispiele für die Praxis der nationalsozialistischen Namenpolitik angeführt. Die Einleitung betont den langen Vorlauf an antisemitischer Namenpolemik, der bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert existierte und die spätere NS-Politik vorbereitete. Die im Text genannten Fragen leiten zu den folgenden Kapiteln über Namentheorie und -geschichte hin.
2. Namentheorie und Namenkunde: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Theorie und die Geschichte der Namen. Es unterscheidet zwischen Eigennamen (Propria) und Gattungsnamen (Appellativa), beleuchtet die psychologische Bedeutung von Namen für den Einzelnen und untersucht die historische Entwicklung deutscher Vor- und Familiennamen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Geschichte jüdischer Namen und ihrer Rolle im Kontext antisemitischer Propaganda. Der Abschnitt liefert das theoretische Fundament für das Verständnis der späteren Analyse der nationalsozialistischen Namenpolitik.
3. Namenpolemik und Namenpolitik: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Namen in der nationalsozialistischen Propaganda und Politik. Es differenziert zwischen der namenpolemischen Propaganda der „Kampfzeit“ und der systematischen Namenpolitik im „Dritten Reich“. Die Kennzeichnungspflicht für Juden und die Vorschriften zur Änderung von Namen werden im Detail betrachtet. Dieser Abschnitt zeigt die systematische Umsetzung der antisemitischen Ideologie in der Sprachpraxis und dokumentiert die politische Instrumentalisierung von Namen zur Diskriminierung und Verfolgung.
Schlüsselwörter
Antisemitische Namenpolemik, Namenpolitik, Nationalsozialismus, Namensgebung, Jüdische Namen, Deutsche Namen, Identitätsbildung, Sprachideologie, Propaganda, Diskriminierung, Kennzeichnungspflicht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Instrumentalisierung von Namen im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Instrumentalisierung von Namen im Nationalsozialismus als Mittel antisemitischer Feindbildmalerei. Sie beleuchtet die sprachtheoretischen Grundlagen der Namensgebung und deren Bedeutung für die Identität des Namensträgers und analysiert die Entwicklung und Anwendung der Namenpolemik und -politik im Dritten Reich.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sprachtheoretische Grundlagen von Namen (Propria vs. Appellativa), die Geschichte deutscher Namen und Besonderheiten jüdischer Namen, antisemitische Namenpolemik im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Namenpolitik im Nationalsozialismus (Kennzeichnungspflicht, Namensänderungen) und die soziale Funktion von Namen und deren Wirkung auf das Umfeld.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die zentrale Fragestellung vor: Wie wurden Namen im Nationalsozialismus instrumentalisiert? Es veranschaulicht die Verwendung jüdischer Namen als Kennzeichen und die damit verbundene Entmenschlichung (z.B. Kennzeichnungspflicht mit "Israel" oder "Sara" und gelber Stern). Es betont den Vorlauf an antisemitischer Namenpolemik im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Kapitel 2 (Namentheorie und Namenkunde): Bietet einen Überblick über die Theorie und Geschichte von Namen. Es unterscheidet zwischen Eigen- und Gattungsnamen, beleuchtet die psychologische Bedeutung von Namen und untersucht die historische Entwicklung deutscher Vor- und Familiennamen mit Fokus auf jüdische Namen im Kontext antisemitischer Propaganda.
Kapitel 3 (Namenpolemik und Namenpolitik): Analysiert die Verwendung von Namen in nationalsozialistischer Propaganda und Politik. Es differenziert zwischen der Propaganda der „Kampfzeit“ und der systematischen Namenpolitik im „Dritten Reich“, betrachtet die Kennzeichnungspflicht für Juden und Vorschriften zur Namensänderung und zeigt die Umsetzung antisemitischer Ideologie in der Sprachpraxis.
Kapitel 4 (Resümee): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen (detaillierte Beschreibung fehlt im Preview).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Antisemitische Namenpolemik, Namenpolitik, Nationalsozialismus, Namensgebung, Jüdische Namen, Deutsche Namen, Identitätsbildung, Sprachideologie, Propaganda, Diskriminierung, Kennzeichnungspflicht.
Welche sprachtheoretischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Unterscheidung zwischen Eigennamen (Propria) und Gattungsnamen (Appellativa) und untersucht die Bedeutung von Namen für die Identität des Namensträgers. Sie analysiert, wie die nationalsozialistische Ideologie sprachlich umgesetzt und Namen als Mittel der Diskriminierung und Verfolgung instrumentalisiert wurden.
Wie wurde die Namenpolitik im Nationalsozialismus umgesetzt?
Die nationalsozialistische Namenpolitik umfasste Maßnahmen wie die Kennzeichnungspflicht für Juden (z.B. durch den Zusatz "Israel" oder "Sara") und das Tragen des gelben Sterns, sowie Vorschriften zur Änderung von Namen. Diese Maßnahmen dienten der Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung.
Welche Rolle spielten jüdische Namen im Kontext des Nationalsozialismus?
Jüdische Namen wurden im Nationalsozialismus als Kennzeichen und Mittel der Entmenschlichung verwendet. Die Arbeit untersucht die Geschichte jüdischer Namen und deren Rolle in der antisemitischen Propaganda und Politik des Dritten Reiches.
- Citation du texte
- Timo Klemm (Auteur), 2005, "Dem Namen nach zu urteilen..." - Antisemitische Namenpolemik und Namenpolitik als Mittel nationalsozialistischer Feindbildmalerei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76515