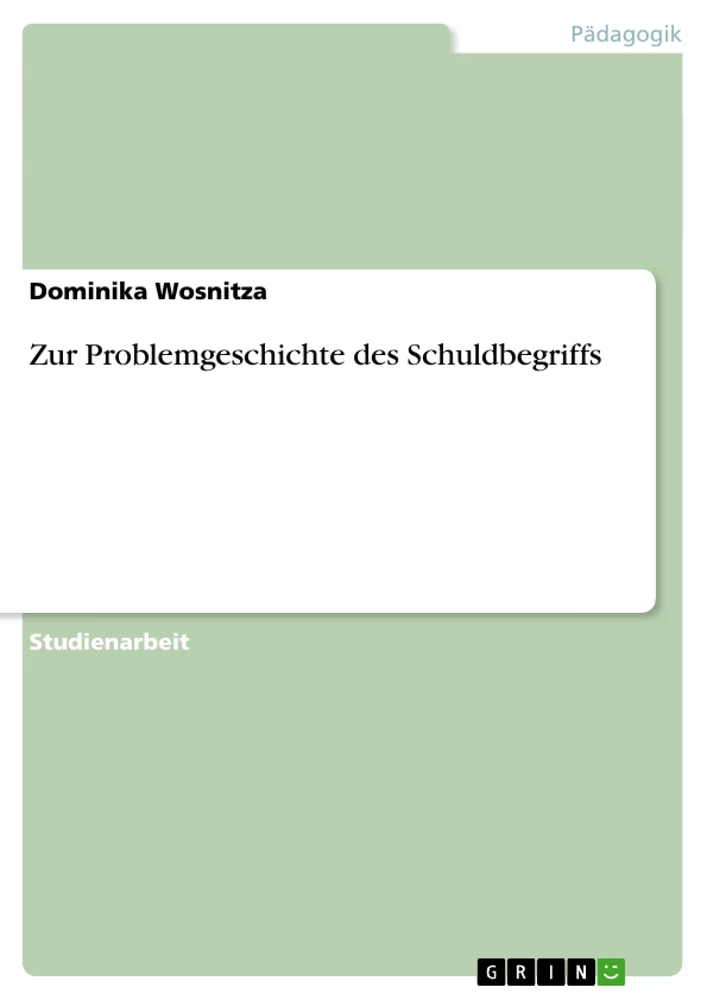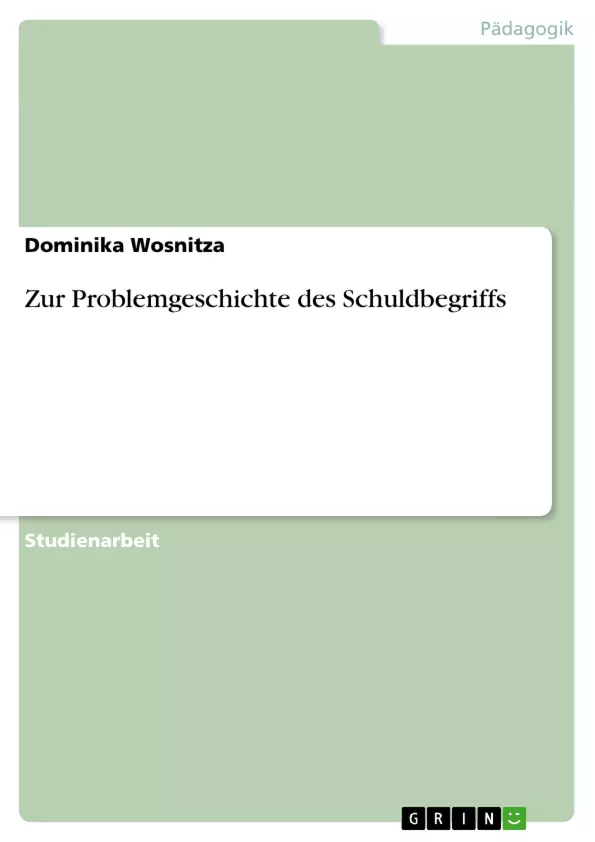Der vorliegende Text befasst sich mit dem Begriff der Schuld, einem Phänomen, welches aufgrund seiner Vieldimensionalität von keiner Wissenschaft adäquat zu fassen ist. Nicht nur wird Schuld in jeder Disziplin anders definiert, sondern auch jede Epoche, jede Strömung, jede Weltanschauung hat ihr eigenes Schuldverständnis, welches auf seine eigene Art und Weise mit dem jeweiligen Selbstverständnis der Menschen korreliert. Schuld jedoch erwächst in all diesen Denkansätzen stets aus einer Interaktion. Niemand könnte allein existierend, ohne Bezug zu irgend etwas oder irgend jemandem schuldig werden. Dieses macht Schuld zu einem sozialen Phänomen, denn sie erwächst aus missglückten Beziehungen zwischen dem Einzelwesen und seinem Lebensumfeld. Stets ist sie verknüpft mit dem Gefühl der Ohnmacht, dem Wissen um die eigene Unzulänglichkeit bei der Bewältigung seiner Existenz, gleichzeitig auch der Angst, dem Ringen nach Freiheit und der Frage nach erantwortlichkeiten. Im Folgenden wird Schuld in ihrer literarischen Darstellung in den Tragödien der Antike sowie denen der Neuzeit und im Zusammenhang mit der Umbruchstimmung des 19. Jahrhunderts untersucht. Die Tragödie hat sich in ihrer Bedeutung bis zur heutigen Zeit gewandelt, jedoch die Kernaus-sage dabei nur aktualisiert, nie eingebüsst. Das Problem des tragischen Helden ist in sofern auch ein theologisches, da es uns mit der Frage konfrontiert, ob Sünde, Fehl und Schicksal verknüpft, gottgewollt, Zufall oder doch Schuld des „Helden“, der doch zum Opfer wird, sind. Ausgehend von der Entwicklung im 19. Jahrhundert wird am Beispiel Friedrich Nietzsches verstärkt auf die psychologische Komponente eingegangen, die durch Siegmund Freud, den Begründer der Psychoanalyse, einen ganz neuen Betrachtungswinkel der Schuld eröffnet. Desweiteren wird die theologische Betrachtungsweise der Schuld untersucht, wobei auf Kierkegaards Schuldverständnis und Ansicht über die Erbsünde besonderes Augenmerk gelegt wird. Psychologie, Philosophie, Theologie und nicht zuletzt dramatische Literatur standen einerseits in ihren Versuchen Schuld fassbar zu machen in ständiger Konkurrenz zueinander, bedingten aber gleichzeitig gegenseitig ihre Weiterentwicklung. Diese Entwicklung des Schuldverständnisses soll hier erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Schuld\" in der Antike
- Platonische,,Wahl\" gegen Aristotelischen „Willen“
- Platon: Schuld als „,Wahl“
- Aristoteles: Schuld als Willensentscheid
- Der Schuldbegriff zu Beginn der Neuzeit
- ,,Schuld\" im 19. Jahrhundert
- Friedrich Nietzsche: Schuld als Verlust des Anrechts auf Grausamkeit
- Siegmund Freud: Das Schuldverständnis in der Psychoanalyse
- ,,Schuld\" in der Theologie
- Kierkegaard: Angst als Voraussetzung der Erbsünde
- Schuld und Angst als Grundphänomene menschlichen Daseins
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert den vielschichtigen Begriff der Schuld und beleuchtet dessen Entwicklung in verschiedenen historischen Epochen und Denkströmungen. Die Arbeit untersucht die philosophische, theologische und psychologische Perspektive auf Schuld und zeigt, wie diese Perspektiven in literarischen Werken der Antike und Neuzeit widergespiegelt werden.
- Die historische Entwicklung des Schuldbegriffs in der Antike, Neuzeit und im 19. Jahrhundert
- Der Einfluss unterschiedlicher Denkströmungen auf das Verständnis von Schuld
- Die Rolle der Tragödie in der Darstellung von Schuld und Schicksal
- Das Verhältnis von Schuld, Freiheit und Verantwortung
- Die psychologische und theologische Dimension von Schuld
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text führt in das Thema Schuld ein und skizziert die Vielschichtigkeit des Begriffs, der durch verschiedene Disziplinen und Epochen unterschiedlich definiert wird. Schuld wird als ein soziales Phänomen dargestellt, das aus Interaktionen und Missverständnissen entsteht.
- ,,Schuld\" in der Antike: In der Antike war Schuld eng mit religiösen und kultischen Handlungen verbunden. Schuld entstand durch die Verletzung göttlicher Ordnung, die mit Sanktionen belegt war. Die Tragödie der Antike zeigt, wie der tragische Held in einer Dilemma-Situation gefangen ist, die ihn unweigerlich in die Schuld treibt.
- Platonische,,Wahl\" gegen Aristotelischen „Willen“: Platon und Aristoteles unterscheiden sich in ihrer Sicht auf die Entstehung von Schuld. Platon sieht Schuld als eine "Wahl" der Seele, die vor der Inkarnation getroffen wird. Aristoteles hingegen betont die freie Willensentscheidung des Menschen in der diesseitigen Welt.
Schlüsselwörter
Schuld, Antike, Neuzeit, Tragödie, Schicksal, Platon, Aristoteles, Nietzsche, Freud, Kierkegaard, Erbsünde, Psychologie, Theologie, Philosophie, Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Schuld als soziales Phänomen betrachtet?
Schuld erwächst stets aus Interaktionen und missglückten Beziehungen zwischen einem Individuum und seinem Umfeld; niemand kann allein existierend schuldig werden.
Wie unterschieden Platon und Aristoteles den Schuldbegriff?
Platon sah Schuld als eine „Wahl“ der Seele vor der Inkarnation, während Aristoteles Schuld als eine bewusste Entscheidung des freien Willens in der diesseitigen Welt definierte.
Welche psychologische Sichtweise brachte Siegmund Freud ein?
Freud untersuchte Schuld im Rahmen der Psychoanalyse und verknüpfte sie mit unbewussten Trieben und der Entwicklung des Über-Ichs.
Was versteht Kierkegaard unter der Erbsünde?
Für Kierkegaard ist die Angst die notwendige Voraussetzung für die Erbsünde und ein Grundphänomen des menschlichen Daseins.
Welche Rolle spielt die Tragödie für das Verständnis von Schuld?
In der Tragödie (Antike bis Neuzeit) wird Schuld oft als Verstrickung zwischen individuellem Handeln und göttlichem oder gesellschaftlichem Schicksal dargestellt.
- Quote paper
- Dominika Wosnitza (Author), 2003, Zur Problemgeschichte des Schuldbegriffs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76572