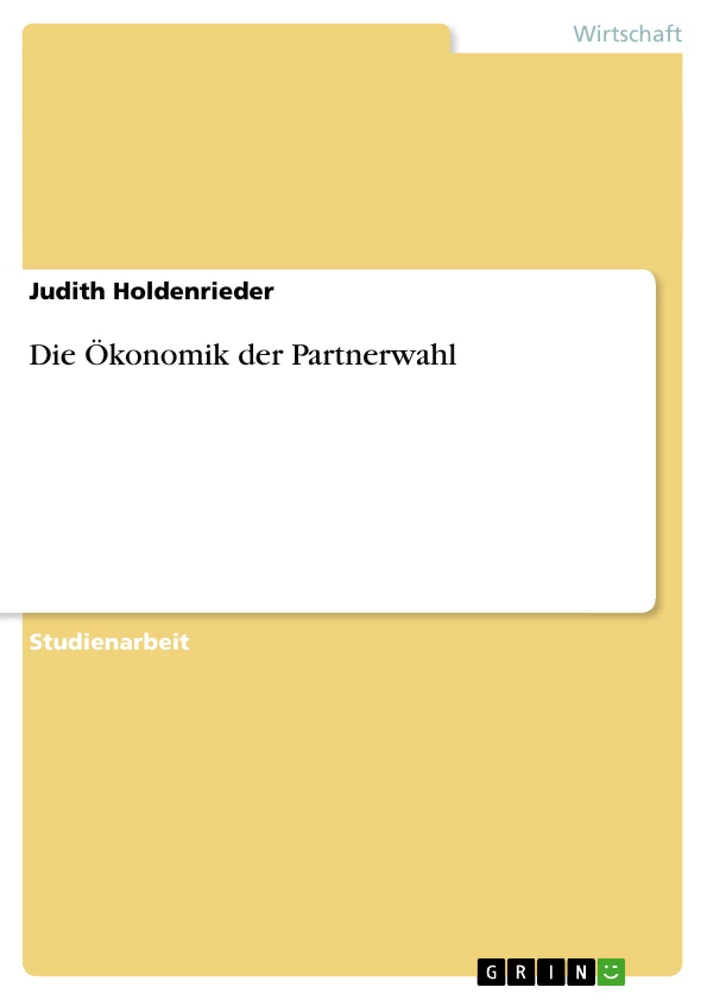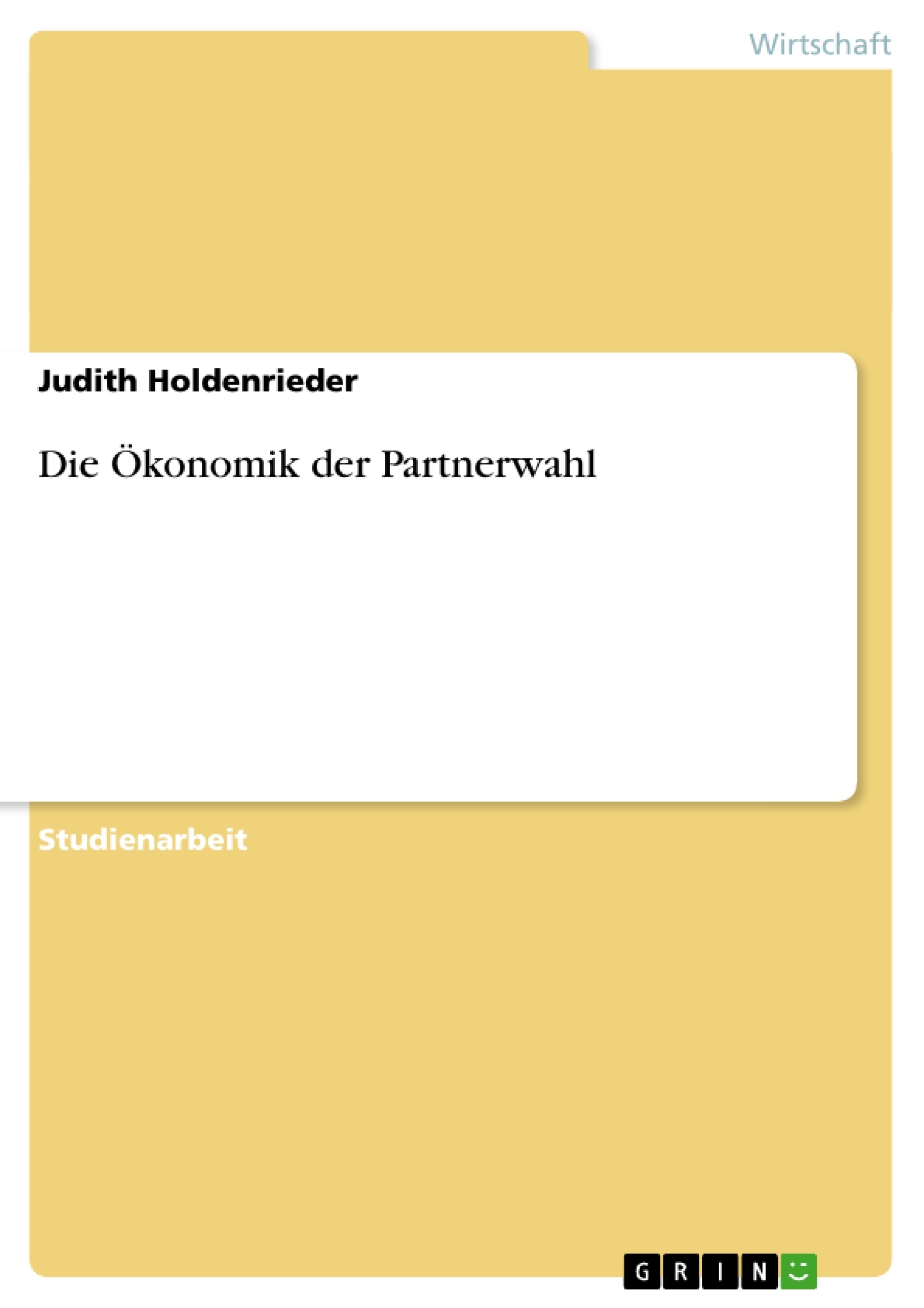„Der Papa hat es sich leicht gemacht, der hat einfach die Mama geheiratet, aber wen soll ich mal heiraten?“ Diese Frage eines kleinen Jungen macht deutlich wie schwer es ist „den Richtigen“ oder „die Richtige“ zu finden.
Die richtige Wahl des Partners bzw. der Partnerin ist die Grundlage jeder auf Dauer gelingenden Liebesbeziehung. Doch wer ist die Richtige? Wie kann man sie finden? Woran erkennt man sie? Was ist überhaupt „Liebe“? Diese Fragen, die sich der Junge stellt, beschäftigt auch die Wissenschaft seit langem. Philosophen, Soziologen, Psychologen, Biologen und Ethnologen beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit dieser Thematik. Unzählige Bücher wurden veröffentlicht um dieses Phänomen zu erklären - aber gelang es bisher? Oder beruht die Liebe und die Partnerwahl auf ganz anderen Aspekten zum Beispiel denen der Ökonomik? Gibt es bestimmte Auswahlkriterien, Regelmäßigkeiten oder Systematiken, nach denen wir unsere Partner aussuchen, wenn wir den Aspekt der Liebe außen vor lassen?
Auf den ersten Blick klingt das wenig romantisch und ein Zusammenhang zwischen der Partnerwahl und der Ökonomik ist nicht selbstverständlich zu sehen. Jedoch ist die Liebe ein zwischenmenschlicher Zustand und die Ökonomik die Lehre davon, wie Menschen miteinander das Beste aus Ihrem Leben machen können.
Im Folgenden soll sowohl auf die Vorteile der Partnerschaft gegenüber dem Single-Dasein, als auch auf die Funktionsweise der Partnerwahl an sich und ihre historische Entwicklung vom Mittelalter bis in die Gegenwart eingegangen werden. Darüber hinaus werden auch verschiedene ökonomische Ansätze zur Partnerwahl dargestellt. Abschließend stellt sich die Frage, ob sich nun Gleich und Gleich gern gesellt oder Gegensätze sich anziehen.
Ziel dieser Arbeit ist es darzustellen, nach welchen rationalen Kriterien und Motiven Menschen einen Partner auswählen.
Hierbei werden ausschließlich ökonomische Ansätze berücksichtigt und ein rational handelnder Mensch zugrunde gelegt, der sich kühl Gedanken darum macht, ob er eine Beziehung eingehen soll oder nicht – ob sie sich lohnt oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 SINGLE-DASEIN UND PARTNERSCHAFT
- 2.1 Single
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Ausprägungen
- 2.1.3 Situation der Singles
- 2.2 Partnerschaft
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Allgemeine Merkmale
- 2.2.3 Ökonomische Vorteile einer Partnerschaft
- 2.2.3.1 Fixkostendegression
- 2.2.3.2 Ausnutzung von Spezialisierungsvorteilen
- 2.2.3.2.1 Arbeitsteilung
- 2.2.3.2.2 Komparativer Vorteil
- 2.2.3.2.3 Erzielung von Skaleneffekten
- 3 PARTNERWAHL UND DEREN HISTORISCHE ENTWICKLUNG
- 3.1 Was ist Partnerwahl
- 3.2 Gesellschaftliche Vorbestimmung im Mittelalter
- 3.3 Instrumenteller Charakter im 17., 18. und 19. Jahrhundert
- 3.4 Freie Partnerwahl im 20. Jahrhundert
- 4 ÖKONOMISCHE ANSÄTZE DER PARTNERWAHL
- 4.1 Familienökonomischer Ansatz
- 4.2 Austauschtheoretischer Ansatz
- 4.3 Die Theorie des subjektiven Erwartungsnutzens
- 5 GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN VS. GLEICH UND GLEICH GESELLT SICH GERN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der Partnerwahl aus ökonomischer Perspektive. Ziel ist es, die ökonomischen Faktoren zu beleuchten, die bei der Partnerwahl eine Rolle spielen, und die historische Entwicklung der Partnerwahl zu analysieren.
- Ökonomische Aspekte der Partnerschaft, wie Fixkostendegression, Spezialisierungsvorteile und Skaleneffekte
- Die historische Entwicklung der Partnerwahl von gesellschaftlicher Vorbestimmung hin zur freien Partnerwahl
- Verschiedene ökonomische Ansätze zur Erklärung der Partnerwahl, wie der familienökonomische Ansatz, der austauschtheoretische Ansatz und die Theorie des subjektiven Erwartungsnutzens
- Die Rolle von Ähnlichkeiten und Unterschieden bei der Partnerwahl
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema der Partnerwahl ein und erläutert die Relevanz der ökonomischen Betrachtungsweise. Es stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit dar.
- Kapitel 2: Single-Dasein und Partnerschaft
Dieses Kapitel beleuchtet die Situation von Singles und Partnerschaften, definiert die Begriffe und untersucht die ökonomischen Vorteile einer Partnerschaft, wie Fixkostendegression und Spezialisierungsvorteile.
- Kapitel 3: Partnerwahl und deren historische Entwicklung
Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Partnerwahl von der gesellschaftlichen Vorbestimmung im Mittelalter bis zur freien Partnerwahl im 20. Jahrhundert.
- Kapitel 4: Ökonomische Ansätze der Partnerwahl
Dieses Kapitel stellt verschiedene ökonomische Ansätze vor, die die Partnerwahl erklären können, wie den Familienökonomischen Ansatz, den Austauschtheoretischen Ansatz und die Theorie des subjektiven Erwartungsnutzens.
Schlüsselwörter
Partnerwahl, Ökonomik, Familienökonomie, Austauschtheorie, subjektiver Erwartungsnutzen, Fixkostendegression, Spezialisierungsvorteile, Skaleneffekte, historische Entwicklung, freie Partnerwahl.
Häufig gestellte Fragen
Welche ökonomischen Vorteile bietet eine Partnerschaft?
Zu den Vorteilen zählen die Fixkostendegression (gemeinsame Wohnung/Auto), Spezialisierungsvorteile durch Arbeitsteilung und die Erzielung von Skaleneffekten.
Was ist die Theorie des subjektiven Erwartungsnutzens?
Diese Theorie geht davon aus, dass Menschen rational abwägen, ob der Nutzen einer Beziehung die Kosten übersteigt und ob sie ihre Ziele mit diesem Partner erreichen.
Wie hat sich die Partnerwahl historisch entwickelt?
Die Entwicklung verlief von der gesellschaftlichen Vorbestimmung im Mittelalter über den instrumentellen Charakter (Standesheirat) bis zur freien Partnerwahl im 20. Jahrhundert.
Was besagt der austauschtheoretische Ansatz?
Er betrachtet die Partnerwahl als einen Austauschprozess, bei dem Individuen versuchen, Belohnungen zu maximieren und Kosten zu minimieren.
Ziehen sich Gegensätze wirklich an?
Die Arbeit untersucht das Sprichwort „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ im Vergleich zu „Gegensätze ziehen sich an“ unter ökonomischen Gesichtspunkten der Komplementarität.
- 2.1 Single
- Arbeit zitieren
- Judith Holdenrieder (Autor:in), 2006, Die Ökonomik der Partnerwahl, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76632