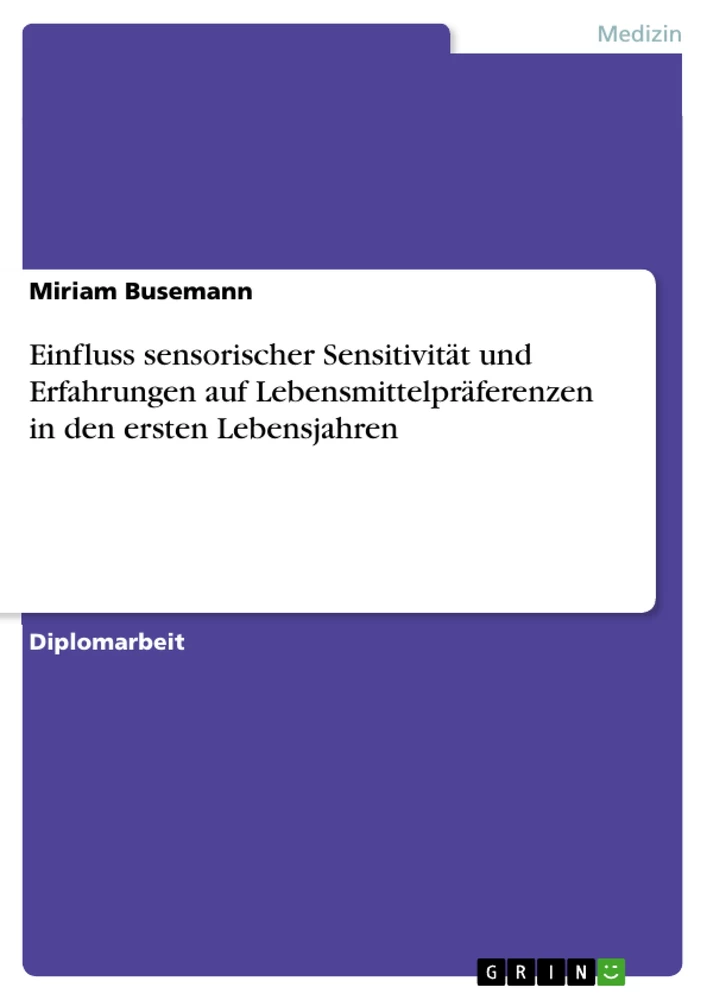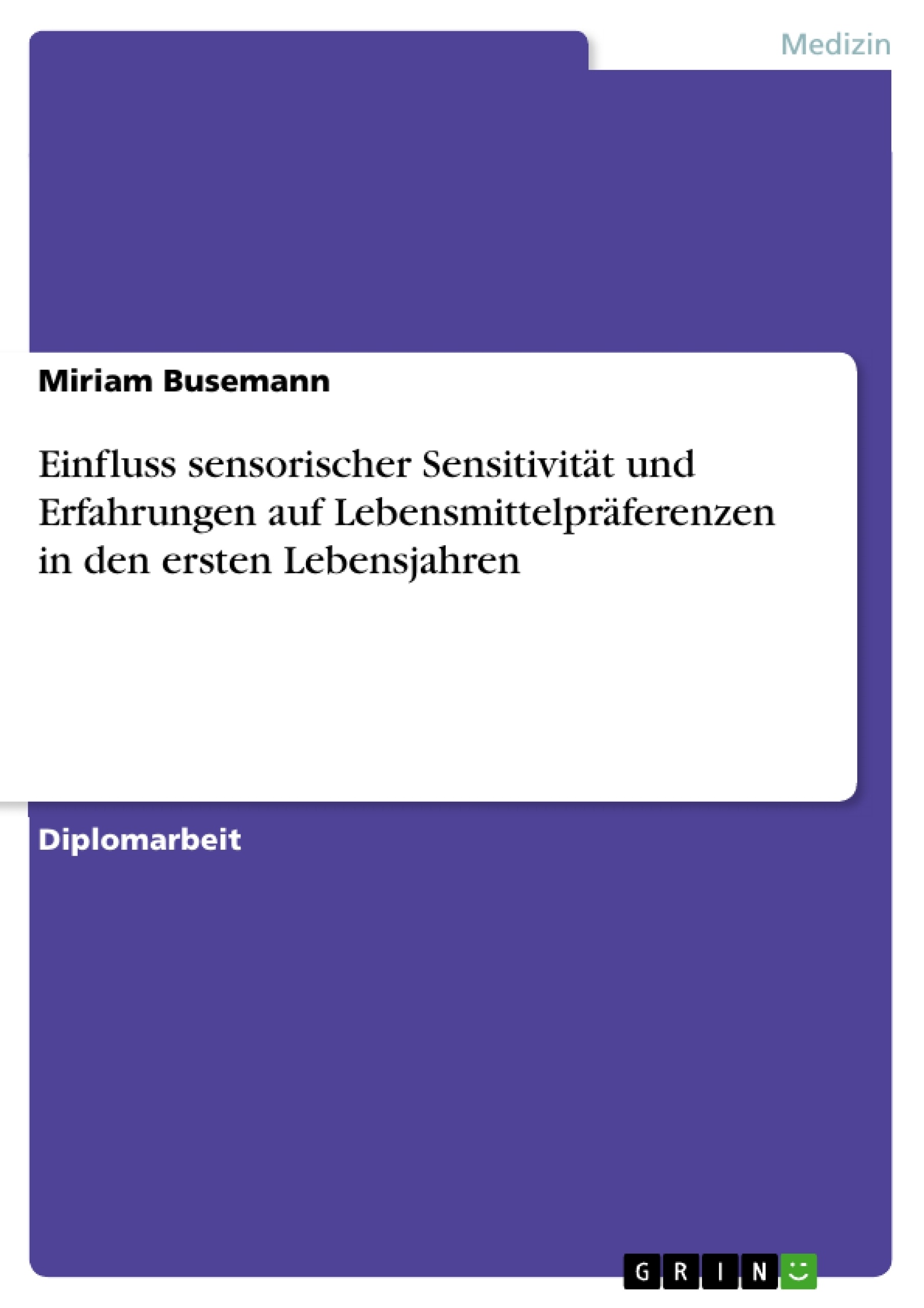Voraussetzung für die Ableitung gesicherter Empfehlungen zur Ernährungserziehung von Kindern ist das Verständnis der Entstehung von Lebensmittelpräferenzen. Schon von frühester Kindheit an ist ein günstiges Ernährungsverhalten von Bedeutung, da in der Kindheit erlernte Verhaltensweisen oft bis ins Erwachsenenalter beibehalten werden.
In dieser Arbeit sollen Einflussfaktoren auf die Ausbildung von Lebensmittelpräferenzen in den ersten Lebensjahren aufgezeigt werden. Dabei werden einerseits genetische Veranlagungen, wie die Sensitivität auf die Grundgeschmacksqualitäten und die genetisch bestimmte Schmeckfähigkeit von PROP näher betrachtet. Andererseits wird eine Vielzahl von verschiedenen Umweltfaktoren beleuchtet, die einen Einfluss auf Vorlieben und Abneigungen für bestimmte Lebensmittel und Geschmacksrichtungen haben.
Es wird deutlich, dass Geschmackspräferenzen bereits durch die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft und der Stillzeit geprägt werden. Durch das Fruchtwasser bzw. die Muttermilch sammeln Kinder, auch schon vor der Geburt, erste Erfahrungen mit Aromen der Lebensmittel die von der Mutter konsumiert werden. Aber auch nicht gestillte Säuglinge werden durch die Art der erhaltenen ersten Nahrung in ihren Geschmackspräferenzen geprägt. So bilden sich sensorisch spezifische Präferenzen je nach Art der erhaltenen Säuglingsnahrung aus.
Dem soziokulturellen Umfeld des Kindes, sowie seinen Eltern, Geschwistern und sonstigen Bezugspersonen, wird ebenfalls ein Einfluss auf die Ausbildung von Lebensmittelpräferenzen zugeschrieben. Gerade durch die Beobachtung Anderer beim Verzehr von Lebensmitteln werden das Essverhalten und damit auch die Lebensmittelpräferenzen beeinflusst.
Eltern und Erziehende beeinflussen allerdings nicht nur durch ihre Vorbildfunktion die Präferenzen und Abneigungen des Kindes. Sie fördern bzw. hemmen die Akzeptanz bestimmter Lebensmittel zudem durch Maßnahmen, wie die Beschränkung des Zugangs zu beliebten Lebensmitteln oder durch den Einsatz von Belohnungen für den Verzehr von unbeliebten Lebensmitteln. Zur Förderung eines günstigen Ernährungsverhaltens des Kindes lassen sich somit Empfehlungen an Eltern und Erziehende, sowie an Verantwortliche im Bereich der Ernährungserziehung von Kindern ableiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen der Sensorik
- Sinnesphysiologie
- Sinneseindrücke und Empfindungen
- Das Zusammenspiel der verschiedenen Sinneseindrücke beim Essen und Trinken
- Anatomische und physiologische Grundlagen der Sinne
- Gesichtssinn
- Geruchssinn
- Geschmackssinn
- Hautsinn
- Gehörsinn
- Geruchswahrnehmung
- Klassifikation von Geruchsqualitäten
- Klassifikation durch Kreuzadaptation
- Die Rolle der Geruchswahrnehmung beim Verzehr von Lebensmitteln
- Geschmackswahrnehmung
- Geschmacksqualitäten
- Adaptation der Geschmacksqualitäten
- Biologische Bedeutung des Geschmackssinns
- Unterschiede in der gustatorischen Wahrnehmung bei Kindern und Erwachsenen
- Wahrnehmung von Flavor und Aroma
- Aroma
- Flavor
- Sensorische Prüfmethoden
- Sensorische Prüfmethoden bei Säuglingen
- Hedonische Prüfungen bei Kleinkindern und Kindern
- Akzeptanztests
- Präferenztest
- Grundlagen der Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern
- Die Ernährung des Säuglings
- Ernährungsplan für das erste Lebensjahr
- Muttermilch und Säuglingsanfangsnahrungen
- Stillen
- Säuglingsanfangsnahrung
- Ernährungsverhalten von Säuglingen und Kleinkindern
- Psychologische Einflussfaktoren bei der Entwicklung des Ernährungsverhaltens
- Veränderungen der Einflussfaktoren des Essverhaltens im Lebensverlauf
- Verhalten von Säuglingen und Kleinkindern
- Einfluss der Eltern auf das Ernährungsverhalten des Kindes
- Ähnlichkeiten im Ernährungsverhalten von Eltern und Kindern
- Bildung von Nahrungsmittelpräferenzen
- Angeborene Geschmackspräferenzen
- Konditionierte Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen
- Kulturelle Einflüsse
- Nahrungsmittelaversionen
- Nahrungsmittelneophobien und die Akzeptanz neuer Nahrungsmittel
- Sensorische Studien mit Säuglingen, Kleinkindern und jungen Schulkindern
- Frühkindliche Geschmackserfahrungen
- Geschmackserfahrungen durch Muttermilch
- Geschmackserfahrungen durch Säuglingsanfangsnahrung
- Akzeptanz von Hydrolysat-Nahrungen
- Aromen in der Säuglingsnahrung
- Ausbildung von Geschmackspräferenzen auf Basis der erhaltenen Säuglingsnahrung
- Reaktionen auf die Grundgeschmacksqualitäten und ihre Auswirkungen auf Geschmackspräferenzen
- Geschmacksqualität süß
- Geschmacksqualität sauer
- Geschmacksqualität salzig
- Geschmacksqualität bitter
- Olfaktorische Studien bei Säuglingen
- Pränatale Gerüche
- Geruchswahrnehmung in der Gebärmutter
- Der Einfluss pränataler Gerüche
- Pränatale und postnatale Gerüche im Vergleich
- Postnatale Gerüche
- Entwicklung der Akzeptanz von Lebensmitteln in den ersten Lebensjahren
- Einfluss der Eltern
- Einfluss des Verhaltens der Eltern
- Einfluss des Gewichts der Eltern
- Neue / unbekannte Lebensmittel
- Vergleich der Studiendesigns
- Schlussbetrachtung und Ausblick
- Zusammenfassung
- Abstract
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Entstehung von Lebensmittelpräferenzen in den ersten Lebensjahren zu beleuchten und die Einflussfaktoren auf die Ausbildung dieser Präferenzen zu untersuchen. Im Fokus stehen dabei sowohl genetische Faktoren, wie die Sensitivität auf die Grundgeschmacksqualitäten und die Schmeckfähigkeit für PROP, als auch Umweltfaktoren, wie die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft, die Art der ersten Nahrung und die Ernährungserfahrungen des Kindes im Allgemeinen.
- Die Bedeutung angeborener und erlernter Geschmackspräferenzen
- Der Einfluss von Ernährungserfahrungen im Mutterleib und in der Stillzeit
- Die Auswirkungen der Art der ersten Nahrung (Muttermilch vs. Säuglingsnahrung)
- Die Rolle von Nahrungsmittelneophobie und die Bedeutung einer vielfältigen Ernährungserfahrung
- Der Einfluss des sozialen Umfelds und des Verhaltens der Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der Sensorik, insbesondere die Sinnesphysiologie und sensorische Prüfmethoden. Kapitel 3 beschreibt die Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern, einschließlich der psychologischen Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten. Kapitel 4 beleuchtet die Bildung von Nahrungsmittelpräferenzen, wobei sowohl angeborene als auch erlernte Präferenzen, kulturelle Einflüsse, Nahrungsmittelaversionen und Neophobie behandelt werden. In Kapitel 5 werden ausgewählte sensorische Studien mit Säuglingen, Kleinkindern und jungen Schulkindern vorgestellt und hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Designs verglichen. Kapitel 6 bietet eine zusammenfassende Analyse der Studiendesigns und beleuchtet die Unterschiede in den Methoden und den untersuchten Altersgruppen. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und leitet daraus Empfehlungen für Eltern und Erziehende ab.
Schlüsselwörter
Lebensmittelpräferenzen, Geschmacksempfindungen, Säuglinge, Kinder, Akzeptanz, Neophobie, Prädisposition, Entwicklung, Ernährungserziehung, Muttermilch, Säuglingsnahrung, sensorische Erfahrungen.
Häufig gestellte Fragen
Wann beginnen Kinder, Lebensmittelpräferenzen zu entwickeln?
Die Prägung beginnt bereits vor der Geburt im Mutterleib durch das Fruchtwasser und setzt sich während der Stillzeit über die Muttermilch fort, basierend auf der Ernährung der Mutter.
Welchen Einfluss hat das Stillen auf den Geschmackssinn?
Gestillte Säuglinge lernen eine Vielzahl von Aromen aus der Nahrung der Mutter kennen, während nicht gestillte Säuglinge durch die spezifischen Aromen ihrer Säuglingsnahrung geprägt werden.
Was ist Nahrungsmittelneophobie?
Es handelt sich um die Angst vor neuen oder unbekannten Lebensmitteln, die in den ersten Lebensjahren häufig auftritt. Regelmäßige Erfahrung mit Vielfalt kann diese Neophobie mindern.
Wie beeinflussen Eltern das Essverhalten ihrer Kinder?
Eltern wirken als Vorbilder durch ihr eigenes Essverhalten. Zudem beeinflussen sie Präferenzen durch Belohnungssysteme oder die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Lebensmitteln.
Sind Geschmackspräferenzen genetisch bedingt?
Ja, es gibt angeborene Präferenzen (z.B. für Süßes) und genetische Unterschiede in der Sensitivität gegenüber Bitterstoffen (wie PROP-Schmeckfähigkeit).
- Arbeit zitieren
- Miriam Busemann (Autor:in), 2007, Einfluss sensorischer Sensitivität und Erfahrungen auf Lebensmittelpräferenzen in den ersten Lebensjahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76754