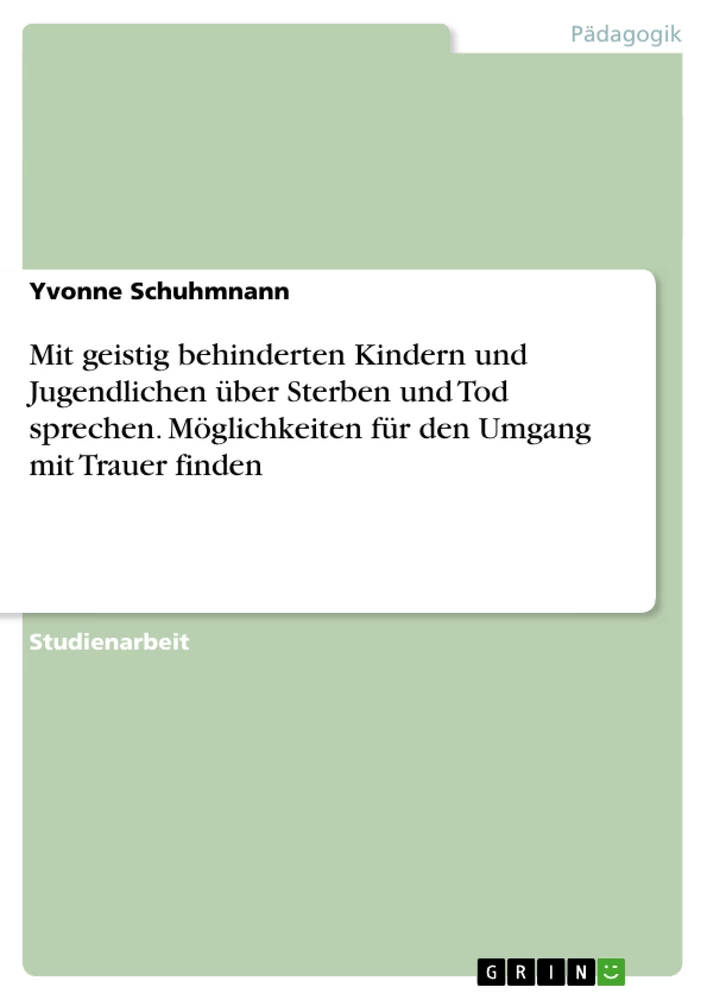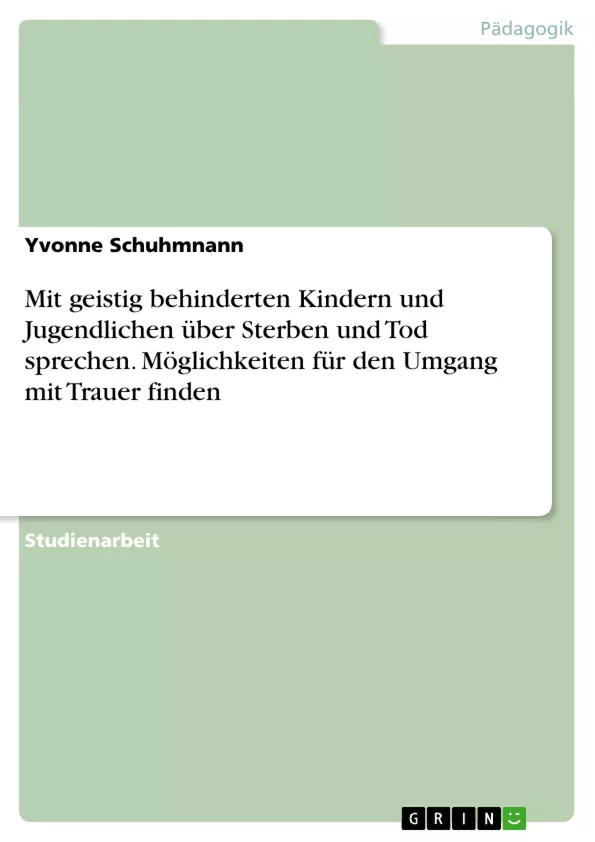Als Eltern und Erwachsene wollen wir, dass Kinder fröhlich sind, lachen und spielen. Wir glauben nicht daran, dass es für ein Kind schon von Bedeutung sein könnte, über den Tod zu reden. Denn oft fehlt uns der Mut, die Worte oder auch die Einsicht, dass es notwendig ist mit Kindern darüber zu sprechen. Es macht vielen Menschen Angst, und wenn sie in ein oder andere Form damit konfrontiert werden, können sie nicht adäquat reagieren.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit dem Thema „Sterben, Tod und Trauer von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen“ befassen. Dabei möchte ich Antworten auf folgende Fragen finden: Welche Vorstellungen vom Tod haben Kinder und Jugendliche? In welchem Alter kann man mit Kindern über Tod reden? Welche Worte sind hilfreich? Sind Kinder überhaupt in der Lage zu trauern und welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es? Sollte darüber im Unterricht gesprochen werden und wenn ja, wie?
In meinen Ausführungen werde ich jedoch nicht unterscheiden zwischen Todesvorstellungen von Behinderten und nicht Behinderten. Ich werde auch nicht unterscheiden zwischen dem Trauerverhalten von Behinderten und nicht Behinderten. Ich werde hierzu lediglich Äußerungen von Wickert und Hoogers-Dörr anführen. Denn Tod und Trauer ist ein Thema, welches meiner Meinung nach individuell zu betrachten ist. Es gibt hierfür kein allgemeingültiges Rezept. Jeder hat seine individuellen Vorstellungen und Strategien mit dem Tod umzugehen, ob geistig Behindert oder nicht.
Zur Erarbeitung habe ich mich hauptsächlich auf das Buch von H. Iskenius-Emmler „Psychologische Aspekte von Tod und Trauer bei Kindern und Jugendlichen“ gestützt. Zur Ergänzung meiner Aufzeichnungen verwendete ich Literatur von T. Brocher, A. Boogert, E. Fischer und einige andere (siehe Literaturliste).
Zunächst werden die Todeskonzepte von Kindern und Jugendlichen von verschiedenen Autoren vorgestellt sowie Grundsätze, wie man mit Kindern über den Tod sprechen könnte. Im weiteren werde ich kurz auf die Unterschiede vom Trauerverhalten von Kindern und Erwachsenen eingehen sowie auf Möglichkeiten, wie man gesunde Trauerarbeit unterstützt. Dann werde ich auf die Frage eingehen, wie das Thema im Unterricht aufbereitet werden könnte. Darauf folgt die Darstellung des Todes im Märchen mit einem Beispiel von Susan Varley.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen
- Die kognitive Entwicklung des Todeskonzeptes nach Nagy
- Das Todesbewusstsein von Kindern und Jugendlichen nach Stern
- Das Todesverständnis des Kindes nach Furman
- Mit Kinder über den Tod sprechen- Grundsätze nach Brocher
- Tod und Trauer in der Gesellschaft
- Das Trauerverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Unterschiede zwischen dem Trauerverhalten von Kindern und Erwachsenen
- Bedingungen, die eine gesunde Trauerarbeit von Kindern und Jugendlichen begünstigen oder erschweren
- Tod und Trauer im Erleben von geistig Behinderten
- Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in der Schule
- Progredient erkrankte Kinder und Pädagogik
- Beispiel: Leb wohl, lieber Dachs
- Tod und Sterben im Märchen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Sterben, Tod und Trauer von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen“. Sie versucht Antworten auf die Fragen nach den Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen, dem geeigneten Alter für Gespräche über den Tod, hilfreichen Worten und der Fähigkeit von Kindern zu trauern zu finden. Die Arbeit untersucht auch die Möglichkeiten der Unterstützung von Kindern in Trauerprozessen und die Frage, ob und wie dieses Thema im Unterricht behandelt werden sollte.
- Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen
- Kommunikation mit Kindern über Tod und Trauer
- Trauerverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in Trauerprozessen
- Integration des Themas Tod und Trauer in den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Entwicklung von Todesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen. Es werden verschiedene Theorien vorgestellt, die unterschiedliche Ansätze zur Entwicklung des Todesverständnisses bei Kindern und Jugendlichen vertreten. Dabei wird deutlich, dass die kognitiven Reifungsprozesse und die Interaktion mit dem gesellschaftlichen Umfeld eine wichtige Rolle spielen. Der zweite Teil behandelt das Trauerverhalten von Kindern und Jugendlichen und die Unterschiede zum Trauerverhalten von Erwachsenen. Die Arbeit beleuchtet auch die Bedeutung des Einflusses des elterlichen Umgangs mit dem Tod und den Erfahrungen mit dem Tod auf die kindliche Trauerarbeit.
Schlüsselwörter
Todesvorstellungen, Tod, Trauer, Kinder, Jugendliche, geistig behindert, Trauerarbeit, Kommunikation, Unterricht.
- Quote paper
- Yvonne Schuhmnann (Author), 2001, Mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen über Sterben und Tod sprechen. Möglichkeiten für den Umgang mit Trauer finden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7698