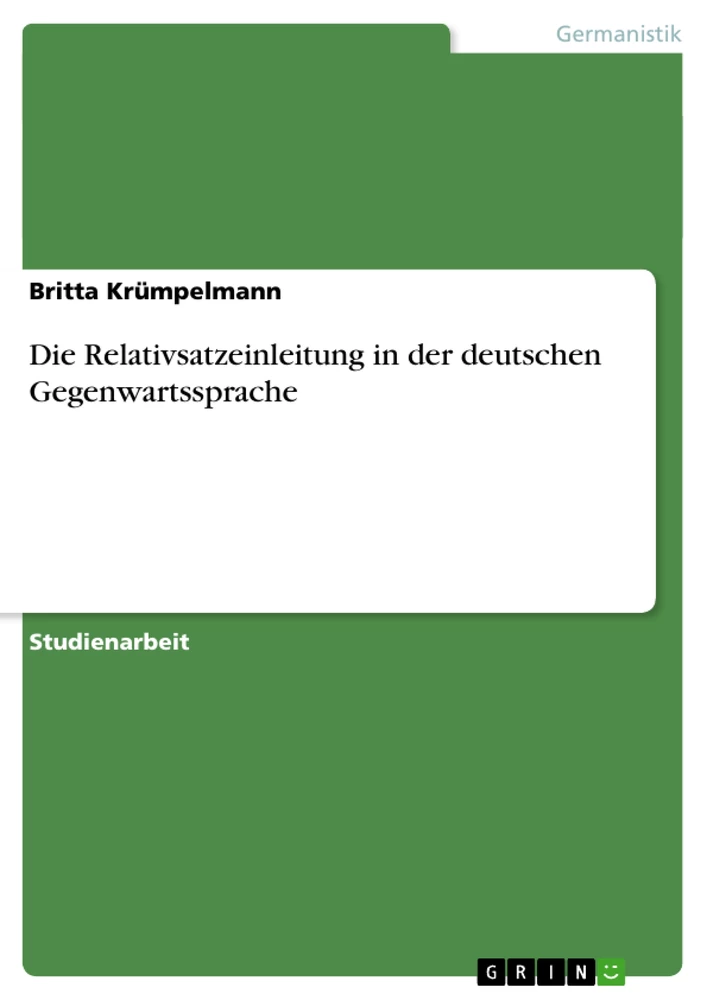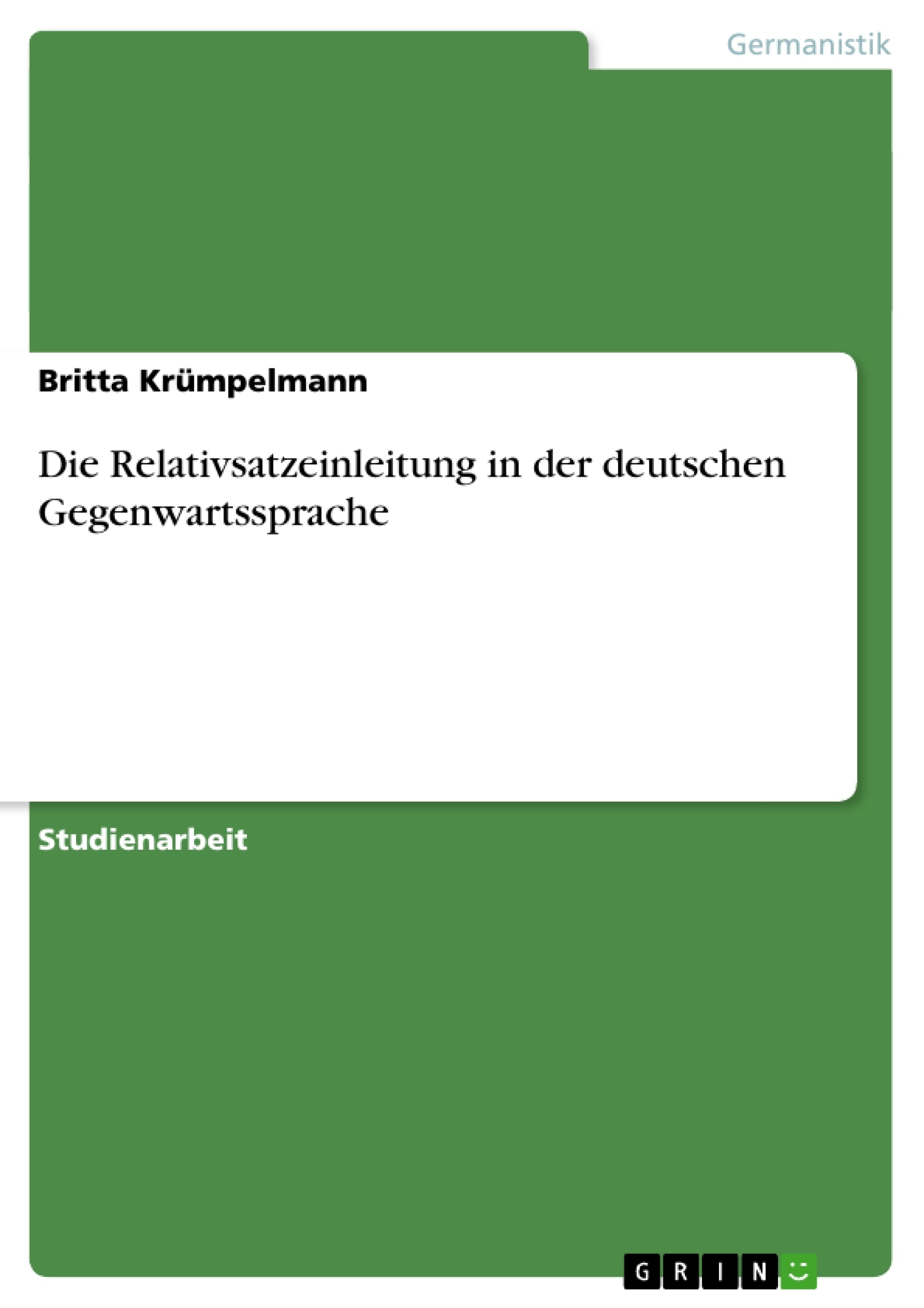Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Die Relativsatzeinleitung in der deutschen Gegenwartssprache“.
Eine Untersuchung innerhalb des Fachbereichs der Relativsätze erscheint mir aus den folgenden Gründen interessant:
Zunächst sind Relativsätze innerhalb der Gruppe der Nebensätze eine vergleichsweise häufig auftretende Struktur, da sie eine „einfache Baustruktur“ (Eroms 2000:290) besitzen und somit Attribute relativ einfach durch einen Relativsatz an ein Bezugswort bzw. einen Bezugssatz angeschlossen werden können (vgl. Eisenberg 2004:268ff, Engel 1996:292 und Eroms 1997:42). Der Relativsatz hat auch auf Grund der Tatsache, dass er die einzig mögliche Form des relativen Anschlusses ist, im Gegenwartsdeutsch eine besondere Stellung inne (s. Zifonun 2001:9).
Zudem ist mir in der Auseinandersetzung mit der von mir herangezogenen Literatur Folgendes aufgefallen: Obwohl die Grammatik des Relativsatzes „[…] in den meisten Hinsichten zu den am besten erforschten Gebieten der Syntax“ (Lehmann 1995:1199) gehört, so gibt es doch kaum Untersuchungen, die sich einer ausführlichen Analyse der Relativsatzeinleitung widmen.
In der Art der Relativsatzeinleitung ist unsere deutsche Sprache kreativer, als man zunächst annehmen mag. Vorerst soll die Andeutung genügen, dass die Leistung des Relativsatzanschlusses nicht allein von den Relativpronomen der/ die/ das, welcher/ welche/ welches etc., sondern auch von ganz anderen Elementen der deutschen Sprache geleistet werden kann. Hierbei spielt auch die gesprochene Sprache eine nicht zu unterschätzende Rolle. In dieser Arbeit werde ich nun wie folgt vorgehen:
Zunächst werde ich mich dem Begriff des Relativsatzes über eine kurze Betrachtung seiner Wortgeschichte nähern (unter 1.1), um daraufhin (unter 1.2) auf das Spektrum der gegenwartssprachlichen Definitionen des Terminus Relativsatz einzugehen. Dabei wird der Schwerpunkt auf dem Begriff der Relativsatzeinleitung liegen.
Daran anschließend (in den Kapiteln 2, 3 und 4) untersuche ich, welche Elemente im Deutschen überhaupt für einen relativen Anschluss in Frage kommen. Hiernach werden diese Elemente in sinnvolle Untergruppen gegliedert und im Hinblick auf Herkunft, Verwendung und Flektierbarkeit näher analysiert.
Im Anschluss (in Kapitel fünf) soll betrachtet werden, inwiefern die verschiedenen Relativsatzeinleiter eine bzw. mehrere Funktionen im Satz übernehmen.
Abschließend (in Kapitel sechs) folgt die Zusammenfassung meiner Untersuchungen
Inhaltsverzeichnis
- 0. Vorbemerkung
- 1. Begriff und Definition des Relativsatzes
- 1.1 Zur Etymologie des Begriffs
- 1.2 Gegenwartssprachliche Definitionen unter besonderer Berücksichtigung der Relativsatzeinleitung
- 2. Untersuchung der Relativpronomen
- 2.1 Vorbemerkung
- 2.2 Bestandsaufnahme der Relativpronomen
- 2.2.1 Das Relativpronomen der/die/ das
- 2.2.2 Die Relativpronomen welche/ welche/welches und derjenige/ diejenige/ dasjenige
- 2.2.3 Das Relativpronomen wer/was
- 2.3 Zur Flektierbarkeit der Relativpronomen
- 2.4 Strategien im Falle der Subjektsfunktion eines Personalpronomens: „Ich, der/die ich... mache“ vs. „Ich, der/die... macht“
- 3. Untersuchung der Relativadverbien und der Relativpartikel wo
- 3.1 Vorbemerkung
- 3.2 Die einfachen Relativadverbien
- 3.3 Die Relativsatzeinleitung in gesprochener Sprache: Der Gebrauch der Relativpartikel bzw. der Relativsubjunktion wo
- 3.4 Die komplexen Relativadverbien: Die Präpositionaladverbien
- 4. Der relative Anschluss durch andere Elemente
- 5. Zur Funktion der Relativsatzeinleiter: Die besondere Leistung der Relativpronomen im Vergleich zu anderen relativ gebrauchten Elementen
- 6. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema „Die Relativsatzeinleitung in der deutschen Gegenwartssprache“. Die Untersuchung der Relativsätze ist aufgrund ihrer häufigen Verwendung im Deutschen und der besonderen Rolle der Relativsatzeinleiter für ihre Konstruktion relevant.
- Etymologie des Begriffs „Relativsatz“
- Definition des Relativsatzes in der Gegenwartssprache
- Untersuchung der Relativpronomen, -adverbien und der Relativpartikel „wo“
- Die Funktion der verschiedenen Relativsatzeinleiter
- Vergleich der Leistung von Relativpronomen mit anderen relativ gebrauchten Elementen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Begriff und Definition des Relativsatzes: Dieses Kapitel beleuchtet die Etymologie des Begriffs „Relativsatz“ und analysiert verschiedene Definitionen des Terminus in der Gegenwartssprache, wobei der Fokus auf der Relativsatzeinleitung liegt.
- Kapitel 2: Untersuchung der Relativpronomen: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Arten von Relativpronomen im Deutschen, analysiert ihre Flektierbarkeit und beleuchtet Strategien zur Verwendung von Personalpronomen in der Subjektsfunktion.
- Kapitel 3: Untersuchung der Relativadverbien und der Relativpartikel wo: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Typen von Relativadverbien, analysiert den Gebrauch der Relativpartikel und Relativsubjunktion „wo“ in der gesprochenen Sprache und befasst sich mit komplexen Relativadverbien, den Präpositionaladverbien.
- Kapitel 4: Der relative Anschluss durch andere Elemente: Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeit des relativen Anschlusses durch Elemente, die nicht direkt als Relativpronomen oder -adverbien klassifiziert werden.
- Kapitel 5: Zur Funktion der Relativsatzeinleiter: Die besondere Leistung der Relativpronomen im Vergleich zu anderen relativ gebrauchten Elementen: Dieses Kapitel analysiert die Funktionen der verschiedenen Relativsatzeinleiter im Satz und vergleicht die Leistung der Relativpronomen mit anderen Elementen, die im Relativsatz eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der deutschen Grammatik, insbesondere mit der Syntax des Relativsatzes. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Relativsatz, Relativsatzeinleitung, Relativpronomen, Relativadverb, Relativpartikel, Bezugswort, Bezugssatz, Flektierbarkeit, Subjektsfunktion, gesprochene Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten Einleiter für Relativsätze im Deutschen?
Am häufigsten werden die Relativpronomen 'der, die, das' verwendet. Aber auch 'welcher, welche, welches' sowie Relativadverbien kommen zum Einsatz.
Welche Rolle spielt die Partikel 'wo' in der gesprochenen Sprache?
In der gesprochenen Sprache wird 'wo' oft als Relativpartikel oder Relativsubjunktion verwendet (z. B. 'der Mann, wo ich gestern gesehen habe'), was standardsprachlich meist als falsch gilt.
Können Relativpronomen flektiert werden?
Ja, Relativpronomen wie 'der' oder 'welcher' werden nach Genus, Numerus und Kasus dekliniert, um sich an das Bezugswort anzupassen.
Was ist ein Präpositionaladverb im Kontext von Relativsätzen?
Dies sind komplexe Relativadverbien wie 'wovon, worüber, womit', die einen relativen Anschluss herstellen, wenn das Bezugswort eine Sache oder ein ganzer Satz ist.
Warum sind Relativsätze in der deutschen Grammatik so wichtig?
Sie haben eine einfache Baustruktur und sind die einzige Möglichkeit des relativen Anschlusses an ein Bezugswort, was sie zu einer sehr häufigen Struktur in der Gegenwartssprache macht.
- Quote paper
- Britta Krümpelmann (Author), 2007, Die Relativsatzeinleitung in der deutschen Gegenwartssprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77040