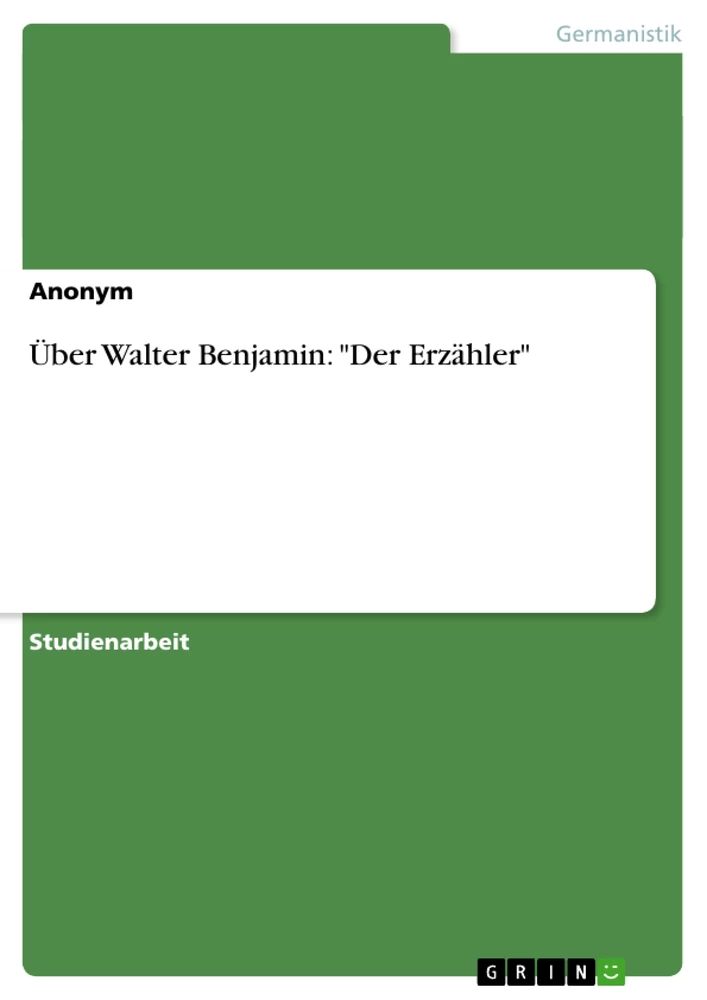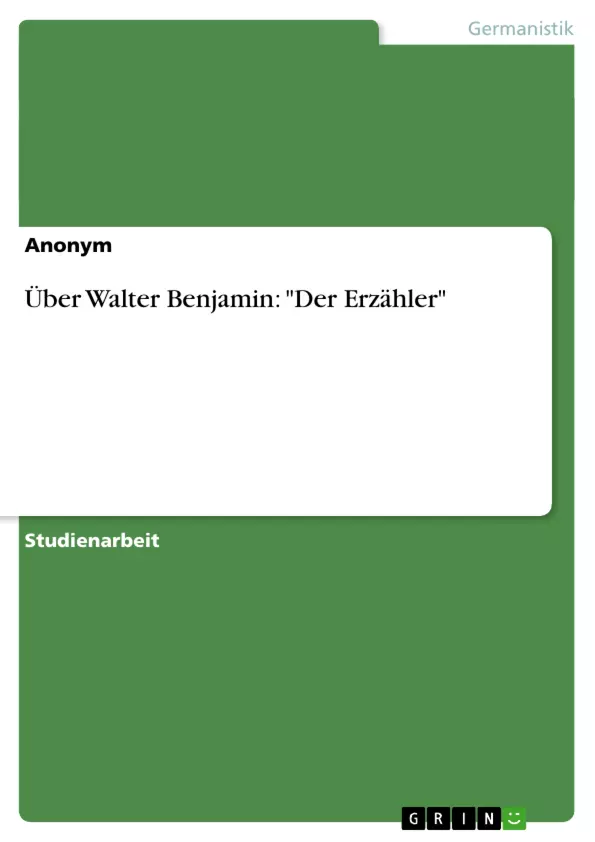Analyse von Benjamins Erzähler-Aufsatz PLUS eine Zusammenfassung der einzelnen Abschnitte des Aufsatzes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erzählen
- Krise
- Roman
- Kritik
- Inhaltszusammenfassung: Walter Benjamin, Der Erzähler (1936)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay von Walter Benjamin, "Der Erzähler," zielt darauf ab, eine neue Theorie des Erzählens zu entwickeln, die sich kritisch mit den bestehenden Theorien, insbesondere der von Lukács, auseinandersetzt. Benjamin untersucht den Wandel des Erzählens im Kontext gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen. Er analysiert die Beziehung zwischen Erzählen und Erfahrung, die Krise des Erzählens im Industriezeitalter und den Aufstieg des Romans als neue Form der literarischen Kommunikation.
- Der Wandel des Erzählens im Laufe der Geschichte
- Die Beziehung zwischen Erzählen und Erfahrung
- Die Krise des Erzählens im Industriezeitalter
- Der Roman als neue Form der literarischen Kommunikation
- Die Kritik am Roman im Vergleich zum Erzählen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Essay, veröffentlicht 1936, beabsichtigt eine neue Romantheorie neben Lukács' Ansatz zu etablieren, greift dabei aber auf dessen Konzepte zurück. Benjamin legt den Fokus auf die Geschichtlichkeit und den Wandel des Erzählens.
Erzählen: Benjamin entwickelt eine Theorie des Epischen, basierend auf dessen Geschichtlichkeit. Er unterscheidet zwischen Erzähler und Romancier und betont den "naturgeschichtlichen" Kern des Erzählens: die Weitergabe von Erfahrung (besonders im Umgang mit dem Tod) und die Begegnung mit dem Außermenschlichen. Erzählen ist für ihn eine unmittelbare, mündliche Vermittlung kollektiv rezipierter Erfahrungen mit praktischem Bezug und moralischer Implikation. Der Erzähler bearbeitet den "Rohstoff der Erfahrung" handwerklich, indem er die erzählte Begebenheit in sein eigenes Leben einwebt. Nikolai Lesskow wird als idealer Erzähler vorgestellt, der Heimatverbundenheit mit weitreichender Erfahrung und mystischem Blick verbindet.
Krise: Benjamin verbindet literarische Gattungen mit dem Geschichtsstand der Kultur und dem Weltverhältnis. Er sieht das Erzählen im Industriezeitalter in der Krise, da Erfahrungen entwertet werden und die Tagespresse mit ihrer Informationsform das Erzählen verdrängt. Die "Schwingungsbreite" des Erzählens, die Offenheit für Interpretationen, fehlt der Information. Im Gegensatz zu Lukács historisiert Benjamin stärker, indem er die gesellschaftliche Wirklichkeit in den Vordergrund stellt und ein materialistisches Geschichtsverständnis zugrunde legt.
Roman: Der Roman wird als neue Form der literarischen Kommunikation dargestellt, die nicht der Erfahrungsübermittlung dient. Benjamin kritisiert den Roman durch den Vergleich mit dem Erzählen. Der mediale Wandel von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit führt zum Verlust der Aura, zur Kommerzialisierung von Literatur und zur Entkopplung von Kommunikation und Interaktion. Die Einsamkeit des Schreibens ersetzt die Gemeinsamkeit des Erzählens, und der Roman spiegelt die Ratlosigkeit des Individuums in einer Welt des Sinnverlustes wider.
Schlüsselwörter
Erzählen, Roman, Erfahrung, Krise, Industriezeitalter, Lukács, Benjamin, Geschichtlichkeit, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Aura, Information, Mystik, Heilsgeschichte, Kommunikation, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen zu Walter Benjamins "Der Erzähler"
Was ist der Hauptfokus von Walter Benjamins Essay "Der Erzähler"?
Der Essay von Walter Benjamin, "Der Erzähler" (1936), entwickelt eine neue Theorie des Erzählens, die sich kritisch mit bestehenden Theorien, insbesondere der von Georg Lukács, auseinandersetzt. Benjamin untersucht den Wandel des Erzählens im Kontext gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen und analysiert die Beziehung zwischen Erzählen und Erfahrung, die Krise des Erzählens im Industriezeitalter und den Aufstieg des Romans als neue Form der literarischen Kommunikation.
Welche zentralen Themen werden in Benjamins Essay behandelt?
Zentrale Themen sind der Wandel des Erzählens im Laufe der Geschichte, die Beziehung zwischen Erzählen und Erfahrung, die Krise des Erzählens im Industriezeitalter, der Roman als neue Form der literarischen Kommunikation und die Kritik am Roman im Vergleich zum traditionellen Erzählen. Benjamin analysiert die Verschiebung von mündlicher zu schriftlicher Tradition und den damit verbundenen Verlust der Aura und der unmittelbaren, gemeinschaftlichen Erfahrung.
Wie unterscheidet Benjamin zwischen Erzählen und Roman?
Benjamin unterscheidet Erzählen und Roman als zwei grundlegend verschiedene Formen der literarischen Kommunikation. Erzählen basiert auf der unmittelbaren, mündlichen Vermittlung kollektiv rezipierter Erfahrungen mit praktischem Bezug und moralischer Implikation. Der Roman hingegen dient nicht der Erfahrungsübermittlung, sondern spiegelt eher die Ratlosigkeit des Individuums in einer Welt des Sinnverlustes wider. Der Roman ist ein Produkt der Schriftlichkeit und der damit einhergehenden Kommerzialisierung und Entkopplung von Kommunikation und Interaktion.
Welche Rolle spielt die "Krise des Erzählens" in Benjamins Argumentation?
Benjamin sieht das Erzählen im Industriezeitalter in der Krise, da Erfahrungen entwertet werden und die Tagespresse mit ihrer Informationsform das Erzählen verdrängt. Die "Schwingungsbreite" des Erzählens, die Offenheit für Interpretationen, fehlt der flüchtigen Information der Massenmedien. Er verbindet literarische Gattungen mit dem Geschichtsstand der Kultur und dem Weltverhältnis, wobei er ein materialistisches Geschichtsverständnis zugrunde legt.
Wer ist für Benjamin der ideale Erzähler und welche Eigenschaften besitzt er?
Benjamin präsentiert Nikolai Lesskow als idealen Erzähler. Dieser verbindet Heimatverbundenheit mit weitreichender Erfahrung und einem mystischen Blick. Der ideale Erzähler verarbeitet den "Rohstoff der Erfahrung" handwerklich, indem er die erzählte Begebenheit in sein eigenes Leben einwebt und somit authentische und sinnhafte Erzählungen schafft.
Welche Bedeutung hat die Geschichtlichkeit für Benjamins Erzähltheorie?
Die Geschichtlichkeit spielt eine zentrale Rolle in Benjamins Theorie. Er betont den "naturgeschichtlichen" Kern des Erzählens, die Weitergabe von Erfahrung (besonders im Umgang mit dem Tod) und die Begegnung mit dem Außermenschlichen. Er historisiert stärker als Lukács, indem er die gesellschaftliche Wirklichkeit in den Vordergrund stellt.
Wie setzt sich Benjamin kritisch mit Lukács auseinander?
Benjamin entwickelt seine Erzähltheorie in kritischer Auseinandersetzung mit Lukács' Ansatz. Während er auf dessen Konzepte zurückgreift, legt er den Fokus stärker auf die Geschichtlichkeit und den Wandel des Erzählens im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen. Benjamin geht über eine rein ästhetische Betrachtung hinaus und bezieht die materialistische Geschichtsauffassung mit ein.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis von Benjamins Essay wichtig?
Schlüsselbegriffe sind Erzählen, Roman, Erfahrung, Krise, Industriezeitalter, Lukács, Benjamin, Geschichtlichkeit, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Aura, Information, Mystik, Heilsgeschichte, Kommunikation und Interpretation. Das Verständnis dieser Begriffe ist essentiell für die Erfassung der Komplexität von Benjamins Argumentation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2002, Über Walter Benjamin: "Der Erzähler", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77084