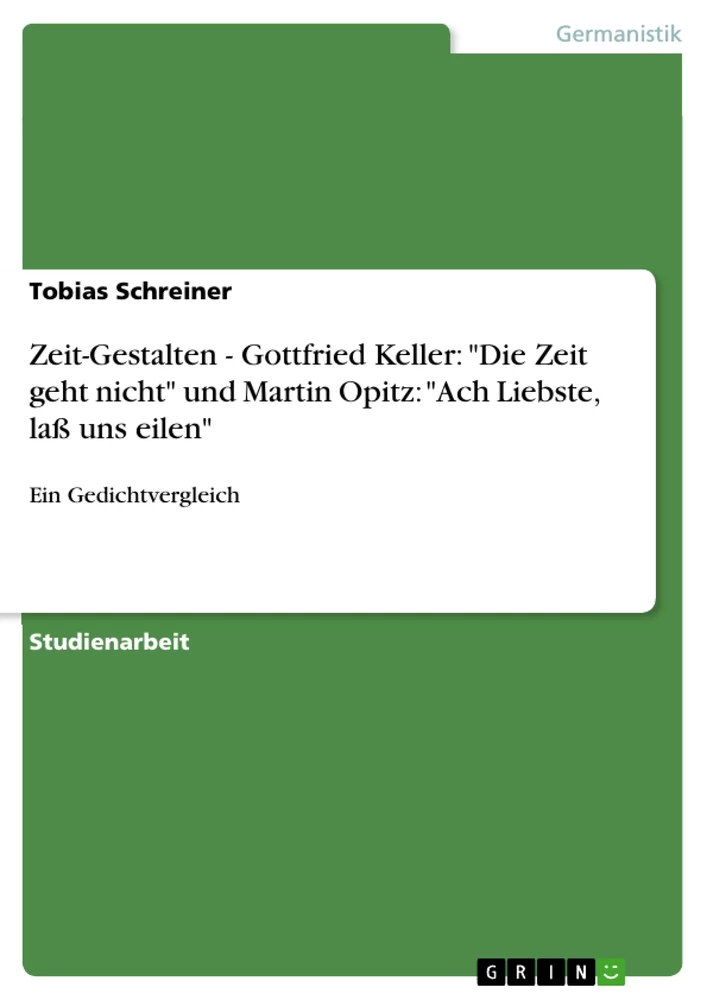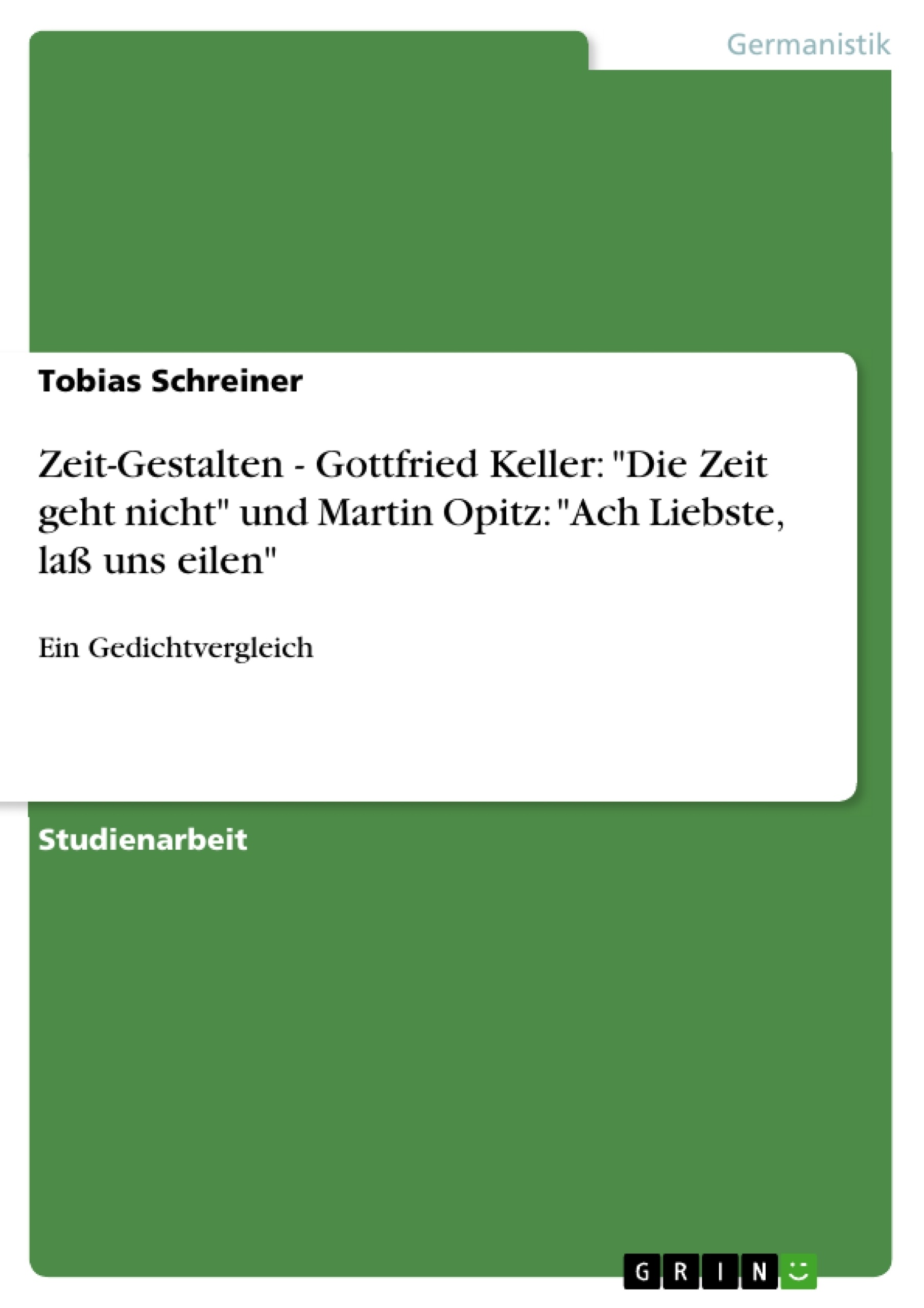Sieht man einmal von Einsteins Relativitätstheorie ab, darf die Zeit als die große Konstante menschlichen Lebens gelten. Zumindest das irdische Dasein wird von ihr absolut determiniert: Es gibt einen klaren Anfangs- und einen klaren Endpunkt dieser Zeitspanne. Ob sich davor oder dahinter die zeitlose Ewigkeit verbirgt, bleibt unserer Erkenntnis verschlossen. Zwischen diesen Punkten beherrscht die Zeit als objektiv messbare und bestimmende Größe unser Leben.
Das individuelle Zeitempfinden mag nun dieser Feststellung häufig vehement widersprechen. Die Vorweihnachtszeit (insbesondere dann, wenn die Geschenke noch in den Märkten liegen) oder auch die Lernzeit vor einer schweren Prüfung scheinen zu rasen; die halbe Stunde auf dem Zahnarztstuhl kommt einem dagegen vor wie eine nicht enden wollende Ewigkeit.
In dieser Diskrepanz zwischen Messbarkeit einerseits und Empfindung andererseits bewegen sich auch die beiden Gedichte, die ich in dieser kleinen Arbeit näher untersuchen möchte. Gedichte sind Zeit-Gestalter, sie besitzen die Macht, in wenigen Worten und Zeilen beliebige Zeitspannen einzufangen. Sie beherbergen Sekunden für die Ewigkeit und lassen Jahrhunderte in einer Silbe verpuffen. Unsere beiden Gedichte beschäftigen sich darüber hinaus noch auf ihre je eigene Art mit der Gestalt der Zeit an sich, sie formulieren Zeit-Gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil - Gottfried Keller: Die Zeit geht nicht
- Textgrundlage
- Das Thema des Gedichts
- Formale Analyse
- Inhaltliche Analyse
- Perspektive, Zeit und Raum
- Bilder
- Einordnung in die Epoche
- Zweiter Teil - Martin Opitz: Ach Liebste, laß uns eilen
- Textgrundlage
- Das Thema des Gedichtes
- Formale Analyse
- Inhaltliche Analyse
- Perspektive und Raum
- Argumentationsstruktur und Zeitperspektive
- Einordnung in die Epoche
- Dritter Teil – Vergleich der beiden Gedichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht zwei Gedichte – Gottfried Kellers „Die Zeit geht nicht“ und Martin Opitz' „Ach Liebste, laß uns eilen“ – um deren unterschiedliche Konzepte und Darstellungen von Zeit zu analysieren. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der formalen und inhaltlichen Aspekte, sowie der Einordnung in ihre jeweiligen Epochen.
- Die Darstellung von Zeit als konstante und variable Größe
- Der Vergleich unterschiedlicher poetischer Strategien zur Abbildung von Zeit
- Die Rolle des lyrischen Ichs in der Wahrnehmung und Gestaltung der Zeit
- Die Verwendung von Metaphern und Bildern zur Veranschaulichung der Zeit
- Die Einordnung der Gedichte in ihren historischen und literarischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Zeitwahrnehmung ein und stellt die Diskrepanz zwischen objektiver Messbarkeit und subjektivem Empfinden heraus. Sie begründet die Auswahl der beiden Gedichte und hebt deren jeweilige Auseinandersetzung mit dem Thema „Zeitgestalt“ hervor.
Erster Teil - Gottfried Keller: Die Zeit geht nicht: Dieser Teil analysiert Kellers Gedicht „Die Zeit geht nicht“. Die Analyse umfasst die Textgrundlage, das zentrale Thema der stillstehenden Zeit, sowie die formale und inhaltliche Struktur. Die inhaltliche Analyse beleuchtet die Perspektive, die verwendeten Bilder und die Einordnung in die Epoche. Die Metaphern der Karawanserei, des Morgentaus, des Pergaments und des Stroms werden detailliert untersucht und in ihren Bedeutungszusammenhängen interpretiert. Das Gedicht wird als eine Auseinandersetzung mit der Natur der Zeit und ihrer Widersprüchlichkeit präsentiert. Die Frage nach der Gestalt der Zeit wird im Zentrum der Betrachtung stehen und durch die Analyse der bildlichen Sprache beleuchtet.
Zweiter Teil - Martin Opitz: Ach Liebste, laß uns eilen: Dieser Teil widmet sich Opitz' Gedicht „Ach Liebste, laß uns eilen“. Ähnlich wie im ersten Teil wird die Textgrundlage, die Thematik, die formale Struktur und die inhaltliche Analyse beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Perspektive, der Argumentationsstruktur, der Zeitperspektive und der Einordnung des Gedichts in seine Epoche. Die Analyse untersucht, wie Opitz Zeit in seinem Gedicht darstellt und welche unterschiedlichen Aspekte im Vergleich zu Keller in den Vordergrund treten. Die Besonderheiten der formalen Gestaltung werden analysiert und auf ihren Zusammenhang mit der Zeitthematik untersucht.
Schlüsselwörter
Zeitwahrnehmung, Zeitgestaltung, Gedichtvergleich, Gottfried Keller, Martin Opitz, Metapher, Bildsprache, Epochenvergleich, Lyrik, Formale Analyse, Inhaltliche Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Gedichte "Die Zeit geht nicht" und "Ach Liebste, laß uns eilen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht und analysiert zwei Gedichte: Gottfried Kellers "Die Zeit geht nicht" und Martin Opitz' "Ach Liebste, laß uns eilen". Der Schwerpunkt liegt auf der unterschiedlichen Darstellung und Konzeption von Zeit in beiden Gedichten.
Welche Aspekte der Gedichte werden untersucht?
Die Analyse umfasst die formale und inhaltliche Struktur beider Gedichte, einschließlich der verwendeten Metaphern und Bilder, der Perspektive des lyrischen Ichs, der Argumentationsstruktur und der Einordnung in den jeweiligen historischen und literarischen Kontext (Epochenvergleich).
Welche konkreten Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Zeit als konstante und variable Größe, vergleicht unterschiedliche poetische Strategien zur Abbildung von Zeit, analysiert die Rolle des lyrischen Ichs in der Zeitwahrnehmung und -gestaltung, interpretiert die Verwendung von Metaphern und Bildern zur Veranschaulichung von Zeit und ordnet die Gedichte in ihren historischen und literarischen Kontext ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Einleitung, eine Analyse von Gottfried Kellers "Die Zeit geht nicht", eine Analyse von Martin Opitz' "Ach Liebste, laß uns eilen" und einen abschließenden Vergleich beider Gedichte. Jedes Gedicht wird hinsichtlich Textgrundlage, Thema, formaler Analyse und inhaltlicher Analyse (einschließlich Perspektive, Raum, Bilder und Argumentationsstruktur) untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Zeitwahrnehmung, Zeitgestaltung, Gedichtvergleich, Gottfried Keller, Martin Opitz, Metapher, Bildsprache, Epochenvergleich, Lyrik, Formale Analyse, Inhaltliche Analyse.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der Zeitwahrnehmung ein, betont die Diskrepanz zwischen objektiver Messbarkeit und subjektivem Empfinden und begründet die Auswahl der beiden Gedichte.
Was ist der Fokus der Analyse von Kellers "Die Zeit geht nicht"?
Die Analyse von Kellers Gedicht konzentriert sich auf das Thema der stillstehenden Zeit, die formale und inhaltliche Struktur, die Perspektive, die verwendeten Bilder (z.B. Karawanserei, Morgentau, Pergament, Strom) und die Einordnung in die Epoche. Die Metaphern werden detailliert interpretiert.
Was ist der Fokus der Analyse von Opitz' "Ach Liebste, laß uns eilen"?
Die Analyse von Opitz' Gedicht beleuchtet die Textgrundlage, die Thematik, die formale Struktur, die Perspektive, die Argumentationsstruktur, die Zeitperspektive und die Einordnung in die Epoche. Der Vergleich mit Kellers Gedicht wird vorbereitet.
Wie werden die Gedichte letztendlich verglichen?
Der dritte Teil der Arbeit vergleicht die beiden Gedichte umfassend, wobei die unterschiedlichen Konzepte und Darstellungen von Zeit im Vordergrund stehen.
- Quote paper
- Tobias Schreiner (Author), 2004, Zeit-Gestalten - Gottfried Keller: "Die Zeit geht nicht" und Martin Opitz: "Ach Liebste, laß uns eilen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77125