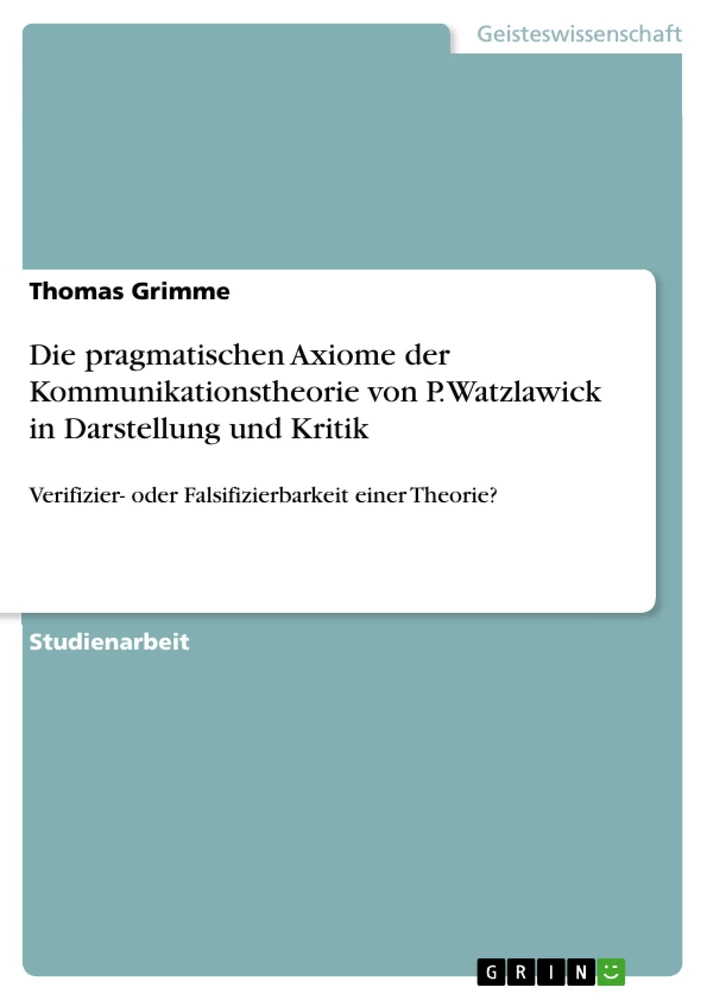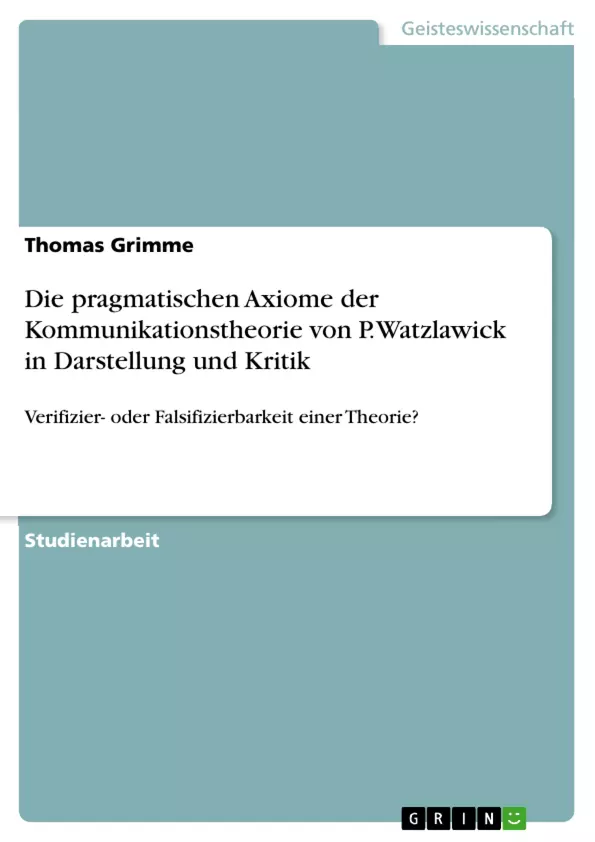Die Semiotik besteht aus den Teilgebieten der Syntax, Semantik und Pragmatik, welche sich gegenseitig bedingen und deren Grenzen fließend ineinander übergehen. „In many ways it is true to say that syntax is mathematical logic, semantics is philosophy or philosophy of science, and pragmatics is psychology, but these fields are not really all distinct” (George 1973, S. 38). Während die Syntax und Semantik relativ durchdringend erforscht sind, stellt die pragmatische Redundanz menschlicher Kommunikationsprozesse in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme dar. Angefangen bei den genuinen Wurzeln einer derartigen Analyse in Systemen und sich hinziehend bis in unsere Gegenwart hat die Pragmatik nichts an ihrem Forschungs- und Diskussionsreiz verloren. Die pragmatische Theorie und ihre Axiome der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick , Janet H. Beavin und Don D. Jackson, publiziert 1969 in dem Werk „Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen und Paradoxien“, werden in dieser Arbeit auf ihren Wahrheits- und Scheingehalt hin überprüft. Daran angelehnt werden die Methodologien der Verifizier- und Falsifizierbarkeit auf Watzlawicks Werk transferiert, mit dem Ziel, den realen Wahrheitsgehalt der Theorie und der Axiome herauszufiltern. Um eine vollständige Beurteilung zu gewährleisten, bedarf es primär eines chronologischen Rückbezugs in die Anfänge der Systemtheorie und Kybernetik.
Die relevanten Anfänge der Systemtheorie und Kybernetik lassen sich auf Mitte des 20. Jahrhundert datieren. Systemtheorie wird dabei genuin mit dem österreichischen Biologen und Systemtheoretiker Ludwig von Bertalanffy in Verbindung gebracht. „Die erste Ausarbeitung einer allgemeinen Systemtheorie legte v. Bertalanffy 1937 im Philosophie-Seminar von Charles Morris an der Universität Chicago vor“ (Meister 1987, S. 5). Die Anfänge der Kybernetik werden im Konnex des Mathematikers Norbert Wiener gesehen. „Als endgültig etabliert darf die moderne Kybernetik spätestens seit 1948 angesehen werden, als Norbert Wiener ... sein grundlegendes Werk ´Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine´ veröffentlichte“ (Meister 1987, S. 5). In Bezug auf die kognitive Beeinflussung Watzlawicks sind vor allem die Kybernetiker verantwortlich. Letztere beschäftigten sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nur mit basalen Analysen von beispielsweise Feedback-Mechanismen oder Definitionsbestimmungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1 Chronologie der Systemtheorie und Kybernetik
- Die Kommunikationstheorie und ihre Axiome
- Verifikation oder Falsifikation einer Theorie
- 4.1 Verifizierbarkeit
- 4.2 Falsifizierbarkeit
- Persönliche Bewertung und Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die pragmatischen Axiome der Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson. Ziel ist es, die Verifizier- und Falsifizierbarkeit dieser Axiome zu prüfen und eine kritische Bewertung vorzunehmen. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Systemtheorie und Kybernetik, um die Entstehung und Entwicklung der Watzlawickschen Theorie besser zu verstehen.
- Die pragmatischen Axiome der Kommunikationstheorie von Watzlawick
- Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit wissenschaftlicher Theorien
- Der historische Kontext der Systemtheorie und Kybernetik
- Die Anwendung systemischer Ansätze auf die Kommunikation
- Kritische Auseinandersetzung mit den Watzlawickschen Axiomen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Forschungsgegenstand: die pragmatischen Axiome der Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick. Sie betont die Bedeutung der Pragmatik in der Kommunikationswissenschaft und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Verifizier- und Falsifizierbarkeit der Axiome untersucht. Der Bezug zur Systemtheorie und Kybernetik wird hergestellt, um den historischen Kontext der Theorie zu verdeutlichen und deren Entwicklung nachzuvollziehen. Die Einleitung legt den Fokus auf die Untersuchung des Wahrheitsgehalts der Watzlawickschen Axiome und deren Relevanz für das Verständnis menschlicher Kommunikation.
1.1 Chronologie der Systemtheorie und Kybernetik: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Systemtheorie und Kybernetik, beginnend mit den Arbeiten von Ludwig von Bertalanffy und Norbert Wiener. Es wird aufgezeigt, wie diese Entwicklungen die Entstehung der Watzlawickschen Kommunikationstheorie beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung zwischen kybernetischen Konzepten und der pragmatischen Analyse menschlicher Kommunikation. Die Beschreibung der frühen Arbeiten von Ruesch und Bateson verdeutlicht den Einfluss dieser auf Watzlawicks Werk. Der Kapitelverlauf unterstreicht den wissenschaftlichen Kontext, aus dem Watzlawicks Theorie hervorgegangen ist.
Die Kommunikationstheorie und ihre Axiome: Dieses Kapitel stellt die fünf pragmatischen Axiome von Watzlawick vor und erläutert deren Bedeutung für ein funktionierendes Kommunikationssystem. Es werden die einzelnen Axiome detailliert beschrieben und ihre Interdependenzen aufgezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation und der Bedeutung der Interpunktion von Kommunikationsabläufen. Die Ausführungen verdeutlichen die komplexen Zusammenhänge, die in der Kommunikation bestehen und deren Einfluss auf das Verständnis und die Interpretation von Botschaften.
Schlüsselwörter
Paul Watzlawick, Kommunikationstheorie, Pragmatik, Axiome, Systemtheorie, Kybernetik, Verifizierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Inhalts- und Beziehungsaspekt, Metakommunikation, Interpunktion, digitale und analoge Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Pragmatische Axiome der Kommunikationstheorie von Watzlawick
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die pragmatischen Axiome der Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson. Im Mittelpunkt steht die Überprüfung der Verifizier- und Falsifizierbarkeit dieser Axiome und deren kritische Bewertung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die pragmatischen Axiome der Kommunikationstheorie, die Verifizier- und Falsifizierbarkeit wissenschaftlicher Theorien, den historischen Kontext der Systemtheorie und Kybernetik, die Anwendung systemischer Ansätze auf die Kommunikation und eine kritische Auseinandersetzung mit den Watzlawickschen Axiomen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Chronologie der Systemtheorie und Kybernetik, ein Kapitel zur Kommunikationstheorie und ihren Axiomen, Abschnitte zur Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit, eine persönliche Bewertung und Kritik sowie ein Fazit. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Systemtheorie und Kybernetik, um die Entstehung und Entwicklung der Watzlawickschen Kommunikationstheorie besser zu verstehen. Sie beschreibt die Entwicklung von den Arbeiten von Ludwig von Bertalanffy und Norbert Wiener bis hin zu den frühen Arbeiten von Ruesch und Bateson, um den Einfluss auf Watzlawicks Werk aufzuzeigen.
Wie werden die Watzlawickschen Axiome behandelt?
Die Arbeit stellt die fünf pragmatischen Axiome von Watzlawick detailliert vor, erläutert deren Bedeutung für ein funktionierendes Kommunikationssystem und zeigt deren Interdependenzen auf. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation und der Bedeutung der Interpunktion von Kommunikationsabläufen.
Wie wird die Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit der Axiome untersucht?
Die Arbeit untersucht die Verifizier- und Falsifizierbarkeit der Watzlawickschen Axiome als zentralen methodischen Ansatz. Dies beinhaltet eine Auseinandersetzung mit den Kriterien der Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit wissenschaftlicher Theorien im Allgemeinen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Paul Watzlawick, Kommunikationstheorie, Pragmatik, Axiome, Systemtheorie, Kybernetik, Verifizierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Inhalts- und Beziehungsaspekt, Metakommunikation, Interpunktion, digitale und analoge Kommunikation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Verifizier- und Falsifizierbarkeit der pragmatischen Axiome der Kommunikationstheorie von Watzlawick zu prüfen und eine kritische Bewertung vorzunehmen. Sie soll zum Verständnis der Axiome und ihres Einflusses auf die menschliche Kommunikation beitragen.
- Citar trabajo
- Thomas Grimme (Autor), 2007, Die pragmatischen Axiome der Kommunikationstheorie von P. Watzlawick in Darstellung und Kritik , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77161