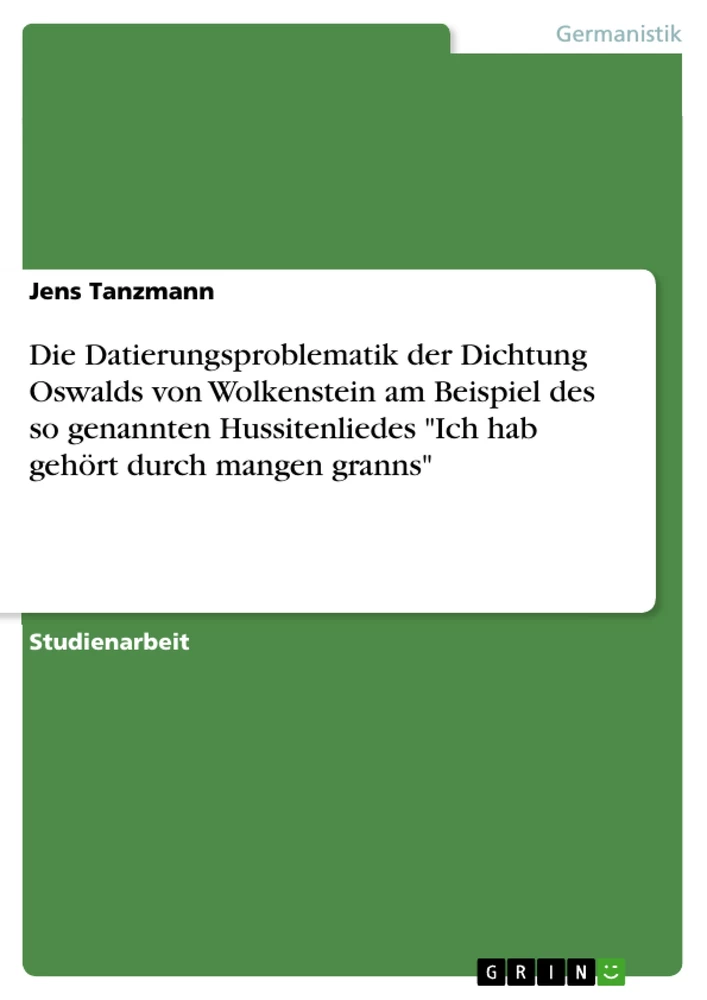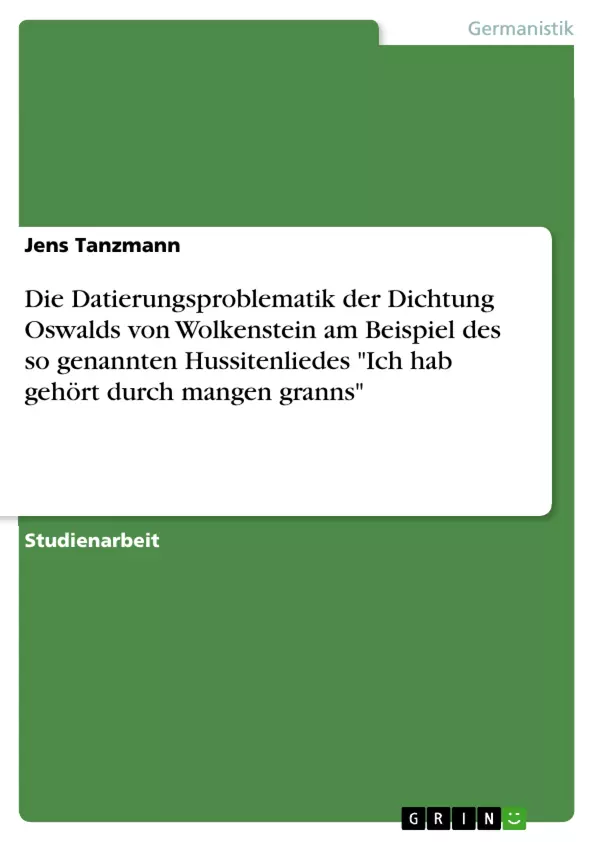Die Verbrennung des Prager Gelehrten Jan Hus (ca. 1370–1415) auf dem Konstanzer Konzil am 6. Juli 1415 glich einem Fanal und bildete den eigentlichen Ausgangspunkt zur Verbrei-tung der hussitischen Lehre. Bereits Leopold von Ranke betont die beschleunigende Wirkung des Märtyrertods für die hussitische Bewegung: „Erst da Hus tot war, wurden seine Gedanken ledeutung zu, wovon nicht nur das Hus-Denkmal aus dem Jahr 1915 auf dem Altstädter Ring in Prag zeugt. Es verwundert daher nicht, dass sowohl die Aufsehen erregenden Vorgänge auf dem Konstanzer Konzil als auch die politischen Entwicklungen in der Folgezeit zum Gegenstand von Chroniken, Stichen und Schlachtgemälden, musikalischen Werken und politischer Lyrik erhoben wurden. Aus dem Jahr 1433 ist z. B. ein achtzehn Strophen umfassendes Volkslied Vom Hussitenkrieg ein Gesang überliefert. Martin Luther, der mehr als hundert Jahre nach den Konstanzer Er-eignissen seine Lehre entwickelte, bekannte sich zu der Inspiration, die er durch den böhmi-schen Reformator erfahren hatte. Auch musikalisch wurden die Auswirkungen der hussiti-schen Bewegung rezipiert: Franz Liszt und Antonin Dvořak vertonten 1840 und 1883, mehr als vierhundert Jahre nach dem Tode Hus’ „Hussitenlieder“.
Oswald von Wolkenstein (um 1376–1445) verarbeitete wesentlich zeitnäher in dem ungewöhnlichen Lied Ich hab gehört durch mangen granns , dem so genannten Hussitenlied, die politischen Ereignisse um den böhmischen Reformator und die Folgen, die sich aus dessen Lehre ergaben. Der Verfasser bezieht mit dem Lied eindeutig gegen die hussitische Bewegung Stellung, – er entwickelt gar einen „fanatischen Hass auf diese bürgerlich-bäuerlichen Aufrührer und Ketzer.“ Die politische Stoßrichtung des Liedes kommt bereits durch die Verwendung des pejorativ aufgeladenen Begriffs „Gans“ zum Ausdruck. Oswald verwendet dieses Bild aus der Ornithologie und zielt damit auf den böhmischen Gelehrten ab, denn Hus bedeutet im Tschechischen soviel wie Gans. Diese Übersetzung war bereits den Teilnehmern am Konstanzer Konzils geläufig und für sie negativ besetzt. Die Gegner des Hus’ verwendeten die Beschreibung deshalb schon zu Beginn des Konzils und verhöhnten den böhmischen Lehr-meister als „Ganskopf“. Während des Prozesses blieb die anklagende Seite, namentlich die Bischöfe von Brixen und Konstanz im Bild, indem sie forderten, dass die Gans „geröstet“ und „gerupft“ werden solle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Historischer Kontext: Jan Hus, Oswald von Wolkenstein, das Konstanzer Konzil und die Hussitenkriege
- 2. Das „Hussitenlied“ als politische Lyrik
- 3. Die Überlieferungssituation des „Hussitenliedes“
- 4. Ältere Datierungsansätze
- 4.1. Beda Weber, 1850
- 4.2. Max Herrmann, 1890
- 4.3. Josef Schatz, 1902
- 4.4. Werner Marold, 1926
- 5. Neuere Datierungsansätze
- 5.1. Norbert Mayr und George F. Jones, 1961 und 1973
- 5.2. Mathias Feldges, 1977
- 5.3. Ute Monika Schwob, 2001
- 6. Resümee
- 7. Literaturverzeichnis
- A. Quellen
- B. Untersuchungen
- C. Links
- 8. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das sogenannte „Hussitenlied“ von Oswald von Wolkenstein und beschäftigt sich mit der Problematik seiner Datierung. Der Fokus liegt dabei auf der Einordnung des Liedes in den historischen Kontext der Hussitenkriege und der politischen Lyrik des Spätmittelalters.
- Die politische Funktion des „Hussitenliedes“ im Kontext der Hussitenkriege
- Die Überlieferungssituation des Liedes und die verschiedenen Datierungsansätze
- Die Verwendung von Tierallegorien in der politischen Lyrik Oswalds von Wolkenstein
- Der Einfluss von Jan Hus und der Hussitenbewegung auf die europäische Gesellschaft des Spätmittelalters
- Die Rezeption des „Hussitenliedes“ in der Literatur und Musikgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den historischen Kontext des „Hussitenliedes“ vor und erläutert die Bedeutung der Hussitenkriege für die europäische Geschichte.
- Kapitel 1 beleuchtet die historischen Figuren Jan Hus und Oswald von Wolkenstein sowie das Konstanzer Konzil und die Hussitenkriege, die den Hintergrund des „Hussitenliedes“ bilden.
- Kapitel 2 analysiert das „Hussitenlied“ als politische Lyrik und untersucht die politischen Motive und Ziele, die in dem Lied zum Ausdruck kommen.
- Kapitel 3 beschreibt die Überlieferungssituation des „Hussitenliedes“ und die verschiedenen Handschriften, die uns das Lied überliefert haben.
- Kapitel 4 stellt verschiedene ältere Datierungsansätze zum „Hussitenlied“ vor und analysiert deren Stärken und Schwächen.
- Kapitel 5 präsentiert neuere Datierungsansätze zum „Hussitenlied“ und diskutiert die aktuellen Forschungsergebnisse.
Schlüsselwörter
Oswald von Wolkenstein, Hussitenlied, Hussitenkriege, Jan Hus, Konstanzer Konzil, politische Lyrik, Spätmittelalter, Tierallegorie, Datierungsproblematik, Überlieferungssituation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Hussitenlied“ von Oswald von Wolkenstein?
Es ist ein politisches Lied mit dem Titel „Ich hab gehört durch mangen granns“, in dem Wolkenstein fanatischen Hass gegen die hussitische Bewegung und Jan Hus ausdrückt.
Warum wird Jan Hus im Lied als „Gans“ bezeichnet?
„Hus“ bedeutet im Tschechischen „Gans“. Wolkenstein nutzt dieses Bild pejorativ, wie es bereits Gegner auf dem Konstanzer Konzil taten.
Was ist die zentrale Problematik der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Datierungsproblematik des Liedes und vergleicht ältere Ansätze (ab 1850) mit neueren Forschungsergebnissen.
In welchem historischen Kontext steht das Lied?
Es steht im Kontext der Hussitenkriege und der Verbrennung von Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil im Jahr 1415.
Welche Rolle spielen Tierallegorien in Wolkensteins Lyrik?
Sie dienen als verschlüsseltes oder spöttisches Mittel der politischen Auseinandersetzung, um Gegner herabzuwürdigen oder politische Botschaften zu transportieren.
- Arbeit zitieren
- Jens Tanzmann (Autor:in), 2007, Die Datierungsproblematik der Dichtung Oswalds von Wolkenstein am Beispiel des so genannten Hussitenliedes "Ich hab gehört durch mangen granns", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77189