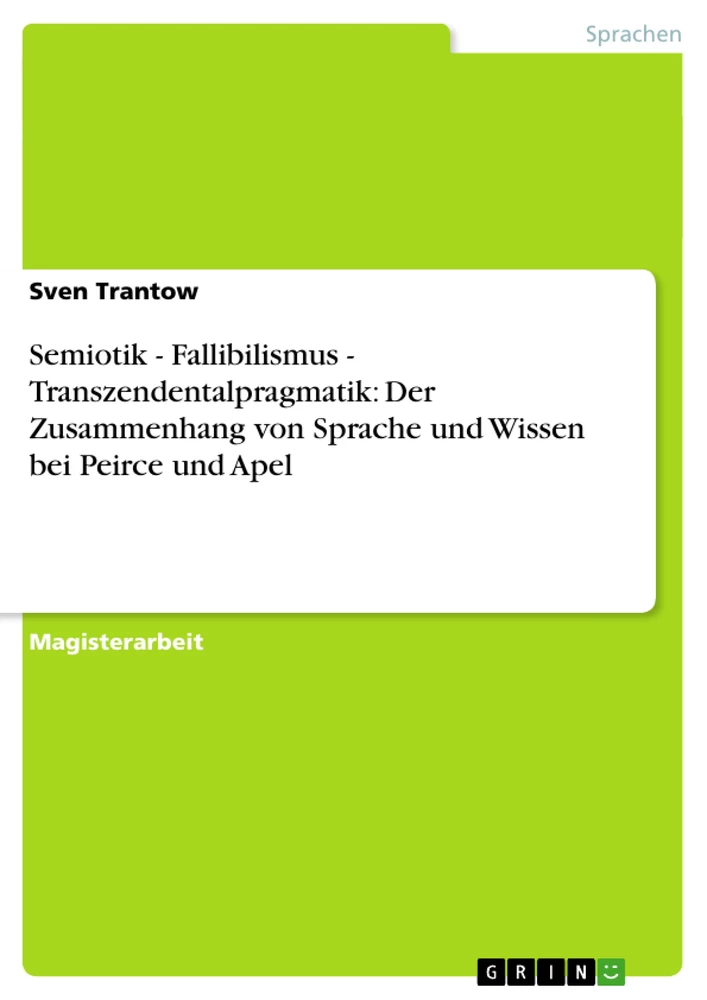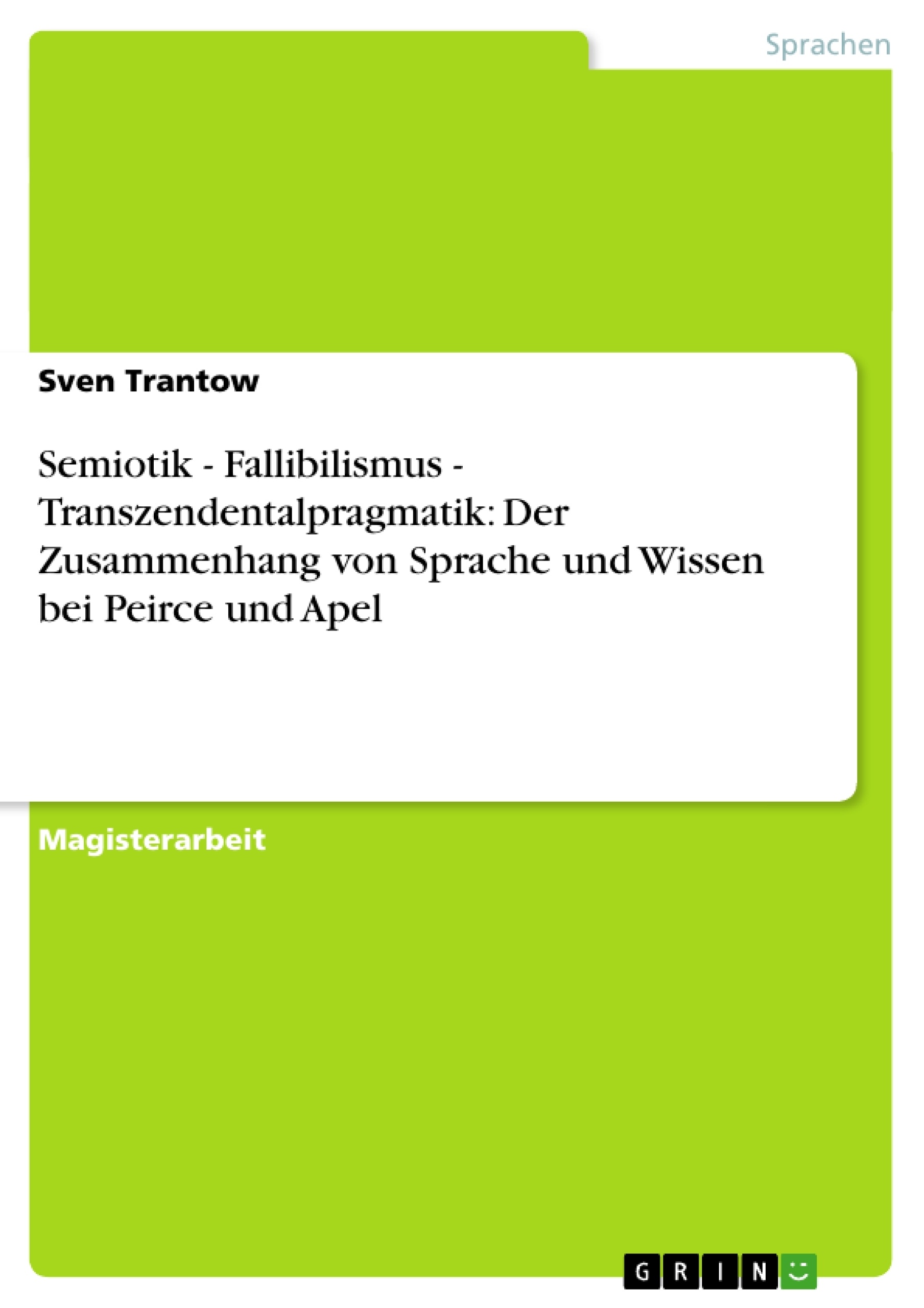„Und ich will so lange weiter vordringen, bis ich irgend etwas Gewisses, oder, wenn nicht anderes, so doch wenigstens das für gewiß erkenne, daß es nichts Gewisses gibt.“ (René Descartes: „Meditationen über die Grundlagen der Philosophie“)
Mit der ebenso berühmten wie evidenten Einsicht des cogito, ergo sum hatte Descartes´ Streben nach einer unerschütterlichen Gewissheit bekanntlich ein Ende gefunden. Diese faszinierende Suche nach einem archimedischen Punkt unserer Erkenntnis kommt in heutigen Zeiten eher der Arbeit des Sisyphus als der eines Wissenschaftlers gleich. Die umgreifende Relativität unserer Erkenntnisse ist zu einem fundamentalen Prinzip nicht nur innerhalb der Philosophie und Geisteswissenschaften, sondern innerhalb der öffentlichen Meinung westlicher Kulturkreise überhaupt avanciert. Dabei hat gerade die Besinnung auf den elementaren Stellenwert der Sprache für die Erzeugung und Strukturierung unseres Wissens einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung. Die Reflexion auf das eigene Bewusstsein wurde im Zuge der linguistischen und pragmatischen Wende durch eine Reflexion auf unsere sprachlich-kommunikativen Voraussetzungen substituiert.
Wer heute also wissen will, was er wissen kann, kommt an einer Analyse der Möglichkeiten und Leistungen von sprachlicher Kommunikation nicht vorbei. Welche Art von Wissen erlaubt uns die Sprache eigentlich? Liegt der Grund für den modernen Wissensrelativismus womöglich schon in der Sprachlichkeit unserer Einsichten? Oder sind wir vielleicht doch, vielleicht gerade durch Sprache in der Lage, absolutes, unfehlbares und universales Wissen zu formulieren? Der Fallibilismus Karl Poppers und die Transzendentalpragmatik Karl-Otto Apels geben zwei kontradiktorische Antworten auf diese Fragen. Die grundsätzliche Fehlbarkeit unseres Wissens steht hier den invarianten und unfehlbaren Voraussetzungen des Argumentierens und Kommunizierens gegenüber.
Doch wie kommen zwei derart unterschiedliche Ansichten zustande, wenn sich beide Ansätze auf die semiotische Erkenntnistheorie von Charles S. Peirce gründen? In diesem Buch finden sich damit nicht nur jene Argumente und Problemstellungen, die den Kern der Diskussion über die Grenzen und Möglichkeiten unseres expliziten Wissens ausmachen; denn darüber hinaus gibt die kritische Auseinandersetzung mit Fallibilismus und Transzendentalpragmatik Antworten auf die Frage nach angemessenen Interpretationen der semiotischen Erkenntnistheorie von Charles S. Peirce.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der semiotische Ansatz zu Erkenntnis und Realität bei Charles S. Peirce
- Semiotik und die triadische Struktur des Zeichens
- Repräsentamen - Die Materialität des Zeichens
- Objekt - Der Gegenstandsbezug des Zeichens
- Interpretant - Die Wirkung des Zeichens
- Semiose - der unendliche Prozess der Zeichenvermittlung
- Realität und Erkenntnis
- Wahrheit als Konsens in der finalen Meinung
- Zweifel und Überzeugung
- Abduktion, Deduktion und Induktion
- Fallibilismus und die Crux des Münchhausen-Trilemmas
- Die Suspendierung der Begründungsidee und die impliziten Voraussetzungen des Münchhausen-Trilemmas
- Können wir das Zweifeln bezweifeln? Die Grenzen sinnvoller Kritik
- Der Sprechakt der Behauptung und die Selbstauflösung des konsequenten Fallibilismus
- Evidentes Handlungswissen – der Ausweg aus dem Münchhausen-Trilemma?
- Transzendentalpragmatik und das Sprachspiel der Argumentation
- Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und der harte Kern des Argumentierens
- Die performativ-propositionale Doppelstruktur der Rede
- Das Aufdecken der Unhintergehbaren – Reflexive Argumente als Lösung des Münchhausen-Trilemmas?
- Das Prinzip des zu vermeidenden performativen Selbstwiderspruchs
- Die Methode der strikten Reflexion
- Selbstexplikationen des Handlungswissens
- ...denn sie wissen nicht, was sie tun? Das Problem der Transformation von implizitem in explizites Wissen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet den elementaren Zusammenhang zwischen Sprache und Wissen, indem sie verschiedene, teilweise gegensätzliche Perspektiven aufzeigt und einen aufeinander aufbauenden Argumentationsverlauf ermöglicht. Ziel ist es nicht, alle Positionen umfassend darzustellen, sondern Argumente herauszufiltern, die das Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen sprachlich-expliziten Wissens fördern.
- Die pragmatische Dimension von Zeichen- und Sprachgebrauch nach Peirce
- Die Fehlbarkeit und Hypothetizität unseres Wissens im Kontext des Fallibilismus und des Münchhausen-Trilemmas
- Die Grenzen sinnvollen Zweifels und die Rolle evidenter Voraussetzungen
- Der transzendentalpragmatische Ansatz Karl-Otto Apels und das Handlungswissen
- Die Transformation von implizitem in explizites Wissen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die erkenntnistheoretische Problematik der Suche nach absoluter Gewissheit, ausgehend von Descartes' cogito, ergo sum. Sie betont die Verschiebung des erkenntnistheoretischen Paradigmas hin zu einer Reflexion auf die sprachlich-kommunikativen Voraussetzungen unseres Wissens. Die Arbeit fokussiert den Zusammenhang von Sprache und Wissen und kündigt die Auseinandersetzung mit semiotischen, fallibilistischen und transzendentalpragmatischen Ansätzen an, wobei die Argumente herausgefiltert werden, welche für ein Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen sprachlich-expliziten Wissens fruchtbar gemacht werden können.
Der semiotische Ansatz zu Erkenntnis und Realität bei Charles S. Peirce: Dieses Kapitel erläutert Peirces semiotischen Ansatz, der das Denken als untrennbar mit dem Gebrauch von Zeichen verknüpft sieht. Peirces triadische Zeichenstruktur (Repräsentamen, Objekt, Interpretant) und der Begriff der Semiose als unendlicher Prozess der Zeichenvermittlung werden detailliert dargestellt. Es wird gezeigt, wie die Möglichkeiten unseres Wissens aus der semiotischen Struktur des Zeichens resultieren und welche Bedeutung der Sprache im Erkenntnisprozess zukommt. Die prinzipielle Fehlbarkeit und Hypothetizität unseres Wissens wird als Konsequenz des pragmatischen Zeichenzusammenhangs herausgestellt.
Fallibilismus und die Crux des Münchhausen-Trilemmas: Dieses Kapitel befasst sich mit der Fehlbarkeit unseres sprachlich-expliziten Wissens im Kontext des Münchhausen-Trilemmas. Es wird die Aberkennung der erkenntnistheoretischen Relevanz des Begründungsprinzips im Zusammenhang mit der Substitution durch Poppers Methode der kritischen Prüfung diskutiert. Durch die Einführung sprechakttheoretischer Elemente wird aufgezeigt, dass wir als zweifelnde und argumentierende Subjekte immer bereits gewisse Evidenzen voraussetzen, die einer Kritik nicht sinnvoll unterzogen werden können. Die Grenzen sinnvollen Zweifels werden kritisch beleuchtet.
Transzendentalpragmatik und das Sprachspiel der Argumentation: Hier wird der transzendentalpragmatische Ansatz Karl-Otto Apels vorgestellt, der das Handlungswissen vom Argumentieren als transzendentales Sprachspiel und unhintergehbare Grundlage unseres Wissenserwerbs deutet. Dieses Wissen ist weder begründungs- noch kritikfähig, da es bei jedem Versuch bereits implizit vorausgesetzt wird. Es wird die Frage nach der Relation von implizitem und explizitem Wissen behandelt, insbesondere die Möglichkeit der Transformation von implizitem in explizites Wissen wird im Hinblick auf die Bedingungen der Möglichkeit sinnvoller Argumentation untersucht.
Schlüsselwörter
Semiotik, Charles S. Peirce, Erkenntnis, Realität, Zeichen, Fallibilismus, Münchhausen-Trilemma, Transzendentalpragmatik, Karl-Otto Apel, Handlungswissen, implizites Wissen, explizites Wissen, Argumentation, Sprache, Wissen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprache und Wissen - Semiotische, Fallibilistische und Transzendentalpragmatische Perspektiven
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den fundamentalen Zusammenhang zwischen Sprache und Wissen. Sie beleuchtet verschiedene, teilweise gegensätzliche Perspektiven und verfolgt einen aufeinander aufbauenden Argumentationsverlauf. Das Ziel ist nicht die umfassende Darstellung aller Positionen, sondern die Herausarbeitung von Argumenten, die das Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen sprachlich-expliziten Wissens fördern.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die pragmatische Dimension von Zeichen- und Sprachgebrauch nach Peirce, die Fehlbarkeit und Hypothetizität unseres Wissens im Kontext des Fallibilismus und des Münchhausen-Trilemmas, die Grenzen sinnvollen Zweifels und die Rolle evidenter Voraussetzungen, der transzendentalpragmatische Ansatz Karl-Otto Apels und das Handlungswissen sowie die Transformation von implizitem in explizites Wissen.
Welche Perspektiven werden eingenommen?
Die Arbeit betrachtet den Zusammenhang von Sprache und Wissen aus drei Hauptperspektiven: dem semiotischen Ansatz von Charles Sanders Peirce, dem fallibilistischen Ansatz mit Fokus auf das Münchhausen-Trilemma und dem transzendentalpragmatischen Ansatz von Karl-Otto Apel.
Wie wird Peirces Semiotik behandelt?
Peirces triadische Zeichenstruktur (Repräsentamen, Objekt, Interpretant) und die Semiose als unendlicher Prozess der Zeichenvermittlung werden detailliert erklärt. Die Arbeit zeigt, wie die Möglichkeiten unseres Wissens aus der semiotischen Struktur des Zeichens resultieren und welche Bedeutung die Sprache im Erkenntnisprozess hat. Die prinzipielle Fehlbarkeit und Hypothetizität unseres Wissens wird als Konsequenz des pragmatischen Zeichenzusammenhangs hervorgehoben.
Wie wird der Fallibilismus und das Münchhausen-Trilemma behandelt?
Das Kapitel zum Fallibilismus und dem Münchhausen-Trilemma befasst sich mit der Fehlbarkeit unseres sprachlich-expliziten Wissens. Die Aberkennung der erkenntnistheoretischen Relevanz des Begründungsprinzips und die Substitution durch Poppers Methode der kritischen Prüfung werden diskutiert. Sprechakttheoretische Elemente zeigen, dass wir als zweifelnde und argumentierende Subjekte immer bereits gewisse Evidenzen voraussetzen, die einer Kritik nicht sinnvoll unterzogen werden können. Die Grenzen sinnvollen Zweifels werden kritisch beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Transzendentalpragmatik von Apel?
Der transzendentalpragmatische Ansatz von Karl-Otto Apel wird vorgestellt. Apels Konzept des Handlungswissens als transzendentales Sprachspiel und unhintergehbare Grundlage unseres Wissenserwerbs wird erläutert. Dieses Wissen ist weder begründungs- noch kritikfähig, da es bei jedem Versuch bereits implizit vorausgesetzt wird. Die Relation von implizitem und explizitem Wissen und die Möglichkeit der Transformation von implizitem in explizites Wissen im Hinblick auf die Bedingungen sinnvoller Argumentation werden untersucht.
Was sind die wichtigsten Schlüsselbegriffe?
Schlüsselbegriffe sind Semiotik, Charles S. Peirce, Erkenntnis, Realität, Zeichen, Fallibilismus, Münchhausen-Trilemma, Transzendentalpragmatik, Karl-Otto Apel, Handlungswissen, implizites Wissen, explizites Wissen, Argumentation, Sprache und Wissen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu einem Inhaltsverzeichnis, einer Einleitung, dem semiotischen Ansatz Peirces, dem Fallibilismus und dem Münchhausen-Trilemma, der Transzendentalpragmatik und dem Problem der Transformation von implizitem in explizites Wissen, sowie einem Literaturverzeichnis.
Gibt es Zusammenfassungen der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält zusammenfassende Beschreibungen jedes Kapitels, die die zentralen Inhalte und Argumente kurz erläutern.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Erkenntnistheorie, Semiotik, Pragmatik und Sprachphilosophie auseinandersetzt.
- Quote paper
- Sven Trantow (Author), 2007, Semiotik - Fallibilismus - Transzendentalpragmatik: Der Zusammenhang von Sprache und Wissen bei Peirce und Apel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77252