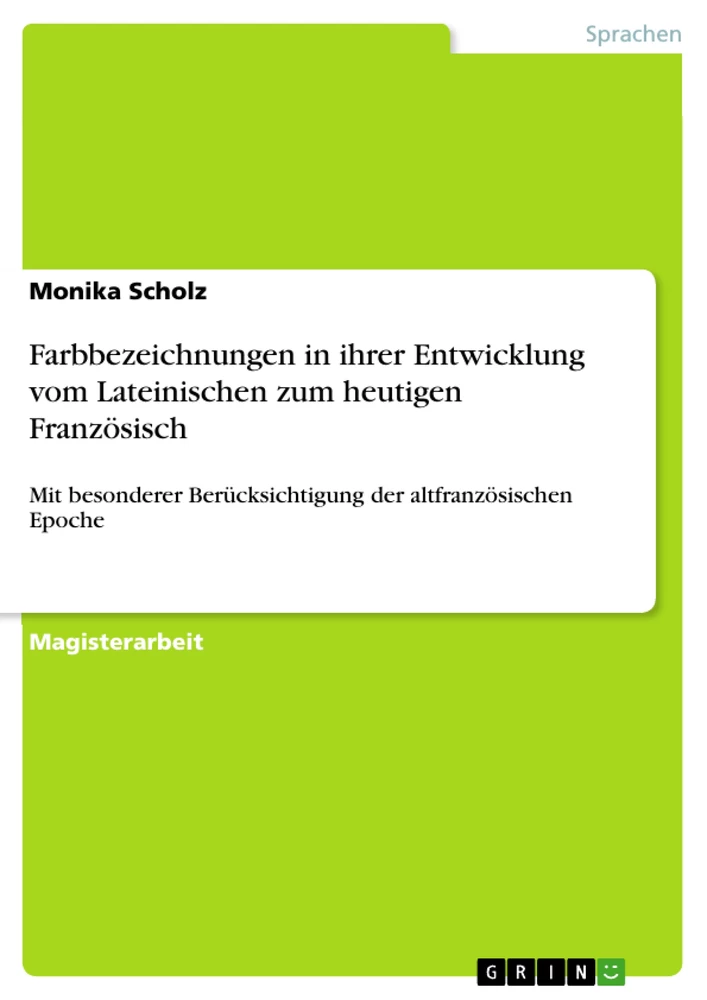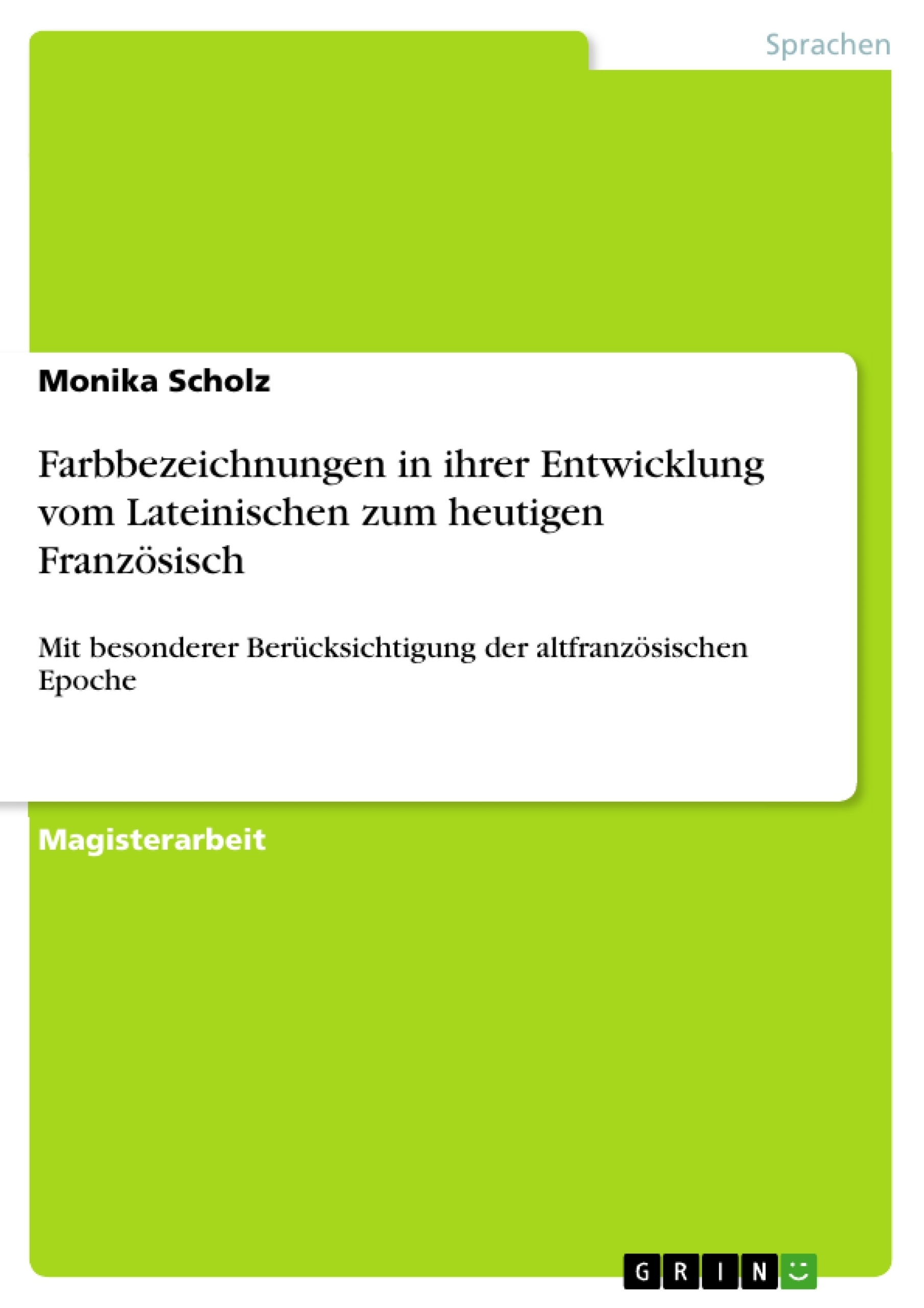Vorliegende Arbeit möchte eine Übersicht über die Vielzahl der Bezeichnungsmöglichkeiten für die verschiedenen Farben geben, die im heutigen Französisch existieren, und in vielen Fällen auch deren Herkunft erläutern.
Im sprachhistorischen Teil der Arbeit werden also die verschiedenen Möglichkeiten der Farbenbenennungen für das Lateinische und das Altfranzösische vorgestellt. Man spricht oft von einem Zusammenbruch des lateinischen Farbsystems, da das Altfranzösische eine Vielzahl der lateinischen Benennungen komplett aufgegeben hat. Es wird versucht einen Überblick über die neuen Farbbezeichungen im Mittelalter zu geben und dabei auch zu klären, woher sie stammen.
Im zweiten Teil der Arbeit wird sich zeigen, dass sich insbesondere das heutige Französisch im Bereich von Mode und Kosmetik als äußerst kreativ beim Schaffen neuer Farbbezeichnungen erweist. Dies geschieht zum Teil aus eigenen Mitteln, andererseits spielen auch Entlehnungen aus anderen Sprachen eine Rolle.
Für das Altfranzösische und das Gegenwartsfranzösisch werden auch jeweils Romane der jeweiligen Epochen untersucht, um zu sehen, welche Farbbezeichnungen in der Literatur besonders häufig vorkommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. DIE BEDEUTUNG VON FARBEN IN UNSEREM TÄGLICHEN LEBEN SOWIE DARSTELLUNG DER GLIEDERUNG MEINER ARBEIT
- 2. SPRACHHISTORISCHER TEIL
- 2.1 VORBEMERKUNG: DER ÜBERGANG VOM LATEINISCHEN INS FRANZÖSISCHE
- 2.2 DIE FARBE WEIß
- 2.2.1 Die Farbe Weiß im Lateinischen
- 2.2.2 Die Farbe Weiß im Altfranzösischen
- 2.2.3 Zusammenfassung
- 2.3 DIE FARBE SCHWARZ
- 2.3.1 Die Farbe Schwarz im Lateinischen
- 2.3.2 Die Farbe Schwarz im Altfranzösischen
- 2.3.3 Zusammenfassung
- 2.4 DIE FARBE ROT
- 2.4.1 Die Farbe Rot im Lateinischen
- 2.4.2 Die Farbe Rot im Altfranzösischen
- 2.4.3 Zusammenfassung
- 2.5 DIE FARBE BLAU
- 2.5.1 Die Farbe Blau im Lateinischen
- 2.5.2 Zusammenfassung
- 2.5.3 Die Farbe Blau im Altfranzösischen
- 2.5.4 Zusammenfassung
- 2.6 DIE FARBE GELB
- 2.6.1 Die Farbe Gelb im Lateinischen
- 2.6.2 Die Farbe Gelb im Altfranzösischen
- 2.7 DIE FARBE GRÜN
- 2.7.1 Die Farbe Grün im Lateinischen
- 2.7.2 Zusammenfassung
- 2.7.3 Die Farbe Grün im Altfranzösischen
- 2.8 DIE FARBE GRAU
- 2.8.1 Die Farbe Grau im Lateinischen
- 2.8.2 Die Farbe Grau im Altfranzösischen
- 2.9 DIE FARBE BRAUN
- 2.9.1 Die Farbe Braun im Lateinischen
- 2.9.2 Die Farbe Braun im Altfranzösischen
- 2.10 DIE FARBE VIOLETT
- 2.10.1 Die Farbe Violett im Lateinischen
- 2.10.2 Die Farbe Violett im Altfranzösischen
- 2.11 ALTFRANZÖSISCHE ENTLEHNUNGEN AUS DEM GERMANISCHEN
- 2.12 FARBADJEKTIVE IN DER ALTFRANZÖSISCHEN LITERATUR
- 3. FARBADJEKTIVE IM HEUTIGEN FRANZÖSISCH
- 3.1 DIE BILDUNG VON FARBADJEKTIVEN IM HEUTIGEN FRANZÖSISCH
- 3.2 FARBADJEKTIVE IM HEUTIGEN FRANZÖSISCH
- 3.2.1 Die Farbe Weiß
- 3.2.2 Die Farbe Schwarz
- 3.2.3 Die Farbe Rot
- 3.2.4 Die Farbe Blau
- 3.2.5 Die Farbe Gelb
- 3.2.6 Die Farbe Grün
- 3.2.7 Die Farbe Grau
- 3.2.8 Die Farbe Braun
- 3.2.9 Die Farbe Violett
- 3.2.10 Die Farbe Rosa
- 3.2.11 Die Farbe Orange
- 3.3 FARBADJEKTIVE IN ZEITGENÖSSISCHER LITERATUR
- 3.4 BEISPIEL FÜR EINE IN DER KOSMETIKINDUSTRIE BESONDERS WICHTIGE FARBE: ROT
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachhistorische Entwicklung von Farbbezeichnungen im Lateinischen und Altfranzösischen und vergleicht diese mit der Verwendung von Farbadjektiven im modernen Französisch. Ein Fokus liegt auf der semantischen Entwicklung und der kreativen Neubildung von Farbbegriffen, insbesondere im Kontext der Mode- und Kosmetikindustrie.
- Sprachhistorischer Wandel von Farbbezeichnungen vom Lateinischen zum Altfranzösischen
- Analyse der semantischen Entwicklung von Farbadjektiven
- Vergleich der Farbbezeichnungen in der Literatur verschiedener Epochen
- Kreativität bei der Neubildung von Farbbegriffen im modernen Französisch
- Der Einfluss von Entlehnungen auf die Farblexik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Bedeutung von Farben in unserem täglichen Leben sowie Darstellung der Gliederung meiner Arbeit: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und verdeutlicht die allgegenwärtige Bedeutung von Farben in unserem Alltag, von der Produktbenennung bis hin zur Farbtherapie. Es wird die Relevanz der Farbwahrnehmung und deren Einfluss auf Emotionen und Kaufverhalten hervorgehoben. Der Abschnitt beschreibt auch die methodische Vorgehensweise der Arbeit und die Unterscheidung zwischen Grund- und Sekundärfarbwörtern. Der Fokus liegt auf der sprachhistorischen Entwicklung von Farbbezeichnungen im Lateinischen und Altfranzösischen, gefolgt von einer Analyse der modernen französischen Farblexik, insbesondere in der Literatur und der Kosmetikindustrie.
2. Sprachhistorischer Teil: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Entwicklung der Farbbezeichnungen vom Lateinischen zum Altfranzösischen. Es wird der Übergang vom Lateinischen zum Altfranzösischen als gradueller Prozess beschrieben, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Für jede untersuchte Farbe (Weiß, Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Grün, Grau, Braun, Violett) werden die entsprechenden Bezeichnungen im Lateinischen und Altfranzösischen detailliert vorgestellt und verglichen. Der Abschnitt beleuchtet auch die Rolle germanischer Entlehnungen im Altfranzösischen und die Häufigkeit bestimmter Farbadjektive in der altfranzösischen Literatur. Das Kapitel integriert das Farbbenennungsschema von Berlin und Kay, um die Entwicklung des Farblexikons zu veranschaulichen und das Altfranzösische und Lateinische einzuordnen.
3. Farbadjektive im heutigen Französisch: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bildung und Verwendung von Farbadjektiven im modernen Französisch. Es werden die verschiedenen Möglichkeiten der Farbbezeichnung analysiert, einschließlich der kreativen Neubildungen, die besonders in der Mode- und Kosmetikindustrie zu beobachten sind. Die Analyse umfasst die einzelnen Farben und vergleicht deren moderne Verwendung mit der historischen Entwicklung. Der Abschnitt untersucht auch die Verwendung von Farbadjektiven in zeitgenössischer Literatur, um die aktuelle Bedeutung und Relevanz der einzelnen Farbbezeichnungen im Kontext des modernen Französisch darzulegen und den Einfluss auf die Farblexik zu zeigen. Ein spezielles Beispiel wird mit der Farbe Rot und ihrer Bedeutung in der Kosmetikindustrie gegeben.
Schlüsselwörter
Farblexik, Sprachgeschichte, Latein, Altfranzösisch, Französisch, Farbadjektive, Semantik, Farbsemantik, Mode, Kosmetik, Literatur, Berlin-Kay-Modell, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Sprachhistorische Entwicklung von Farbbezeichnungen im Französischen
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die sprachhistorische Entwicklung von Farbbezeichnungen vom Lateinischen über das Altfranzösische bis zum modernen Französisch. Schwerpunkte sind die semantische Entwicklung, die Neubildung von Farbbegriffen (insbesondere in Mode und Kosmetik) und der Einfluss von Entlehnungen. Die Arbeit analysiert Farbadjektive in Literatur verschiedener Epochen und vergleicht die Verwendung von Farben in unterschiedlichen Kontexten.
Welche Farben werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die Farben Weiß, Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Grün, Grau, Braun und Violett. Für jede Farbe wird die lateinische und altfranzösische Bezeichnung untersucht und mit der modernen französischen Bezeichnung verglichen. Zusätzlich werden Rosa und Orange im modernen Französisch betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt die Gliederung. Kapitel 2 analysiert die sprachhistorische Entwicklung der Farbbezeichnungen vom Lateinischen zum Altfranzösischen. Kapitel 3 behandelt die Farbadjektive im modernen Französisch, inklusive der Neubildungen in Mode und Kosmetik. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine sprachhistorische Methode, die die Entwicklung der Farbbezeichnungen über verschiedene Sprachstufen hinweg analysiert. Vergleiche zwischen den verschiedenen Sprachstufen (Lateinisch, Altfranzösisch, Modernes Französisch) und die Analyse von Literaturtexten (altfranzösisch und modern) sind zentrale Methoden. Das Farbbenennungsschema von Berlin und Kay wird integriert, um die Entwicklung des Farblexikons zu veranschaulichen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von lateinischen und altfranzösischen Texten sowie auf modernen französischen Texten, insbesondere aus der Literatur und der Kosmetikindustrie. Genaueres zu den verwendeten Quellen ist nicht im bereitgestellten HTML-Snippet angegeben.
Welche Bedeutung haben Farben in der Arbeit?
Die Arbeit betont die allgegenwärtige Bedeutung von Farben im Alltag, von der Produktbenennung bis zur Farbtherapie. Der Einfluss der Farbwahrnehmung auf Emotionen und Kaufverhalten wird hervorgehoben. Die Arbeit untersucht die kreative Neubildung von Farbbegriffen, besonders in der Mode- und Kosmetikindustrie, um den Einfluss von kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren auf die Sprachentwicklung zu zeigen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit (Kapitel 4) fasst die Ergebnisse der sprachhistorischen Analyse und des Vergleichs der Farbbezeichnungen in den verschiedenen Sprachstufen zusammen. Es wird ein Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse zur semantischen Entwicklung und Neubildung von Farbbegriffen gegeben. Die genauen Ergebnisse sind aus dem bereitgestellten Auszug nicht ersichtlich.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Farblexik, Sprachgeschichte, Latein, Altfranzösisch, Französisch, Farbadjektive, Semantik, Farbsemantik, Mode, Kosmetik, Literatur, Berlin-Kay-Modell, Sprachwandel.
- Quote paper
- Monika Scholz (Author), 2007, Farbbezeichnungen in ihrer Entwicklung vom Lateinischen zum heutigen Französisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77513