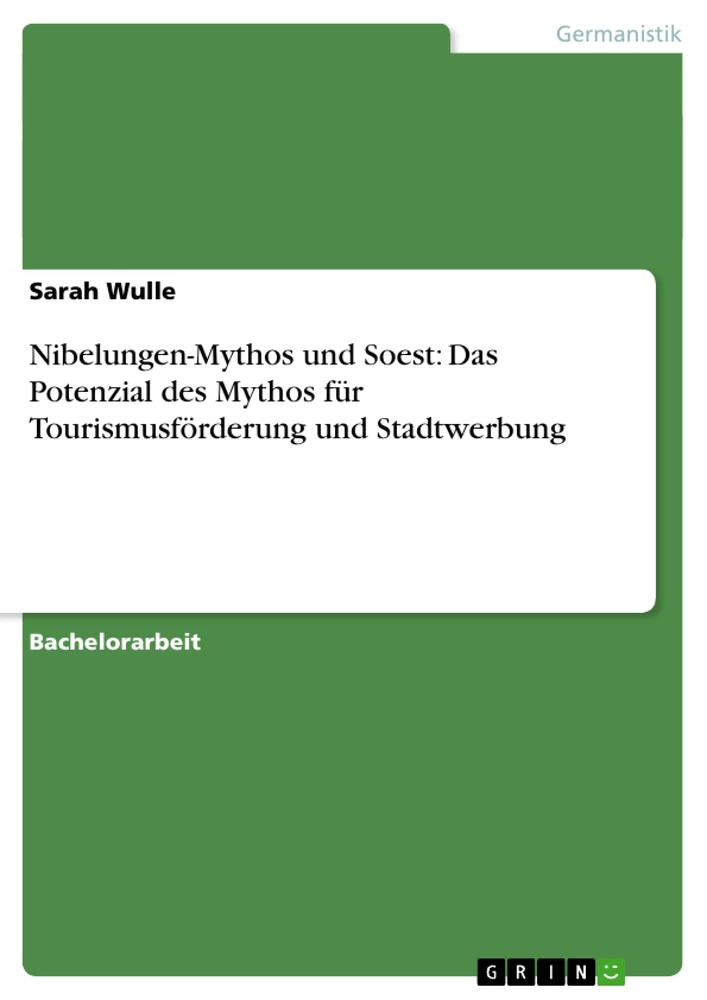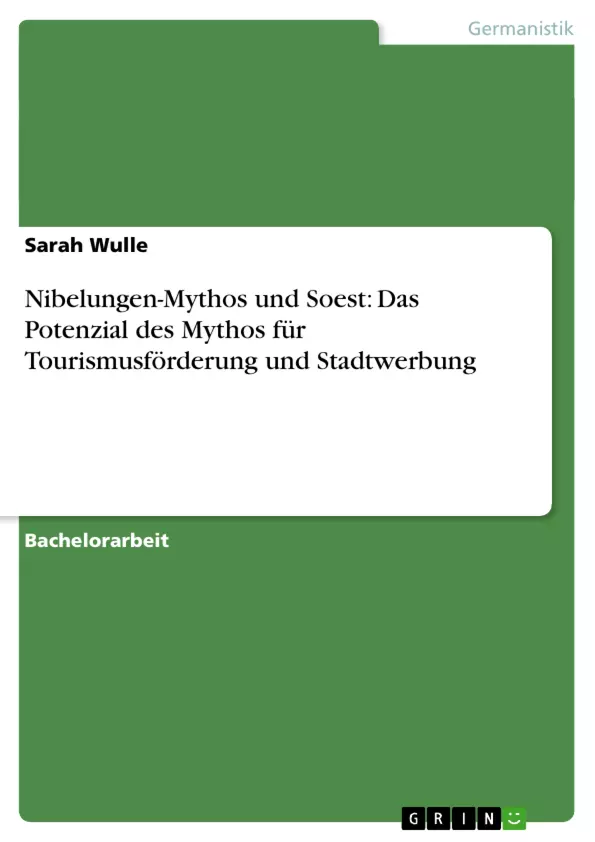Gemeinhin verbindet man mit dem Nibelungenmythos Schauplätze wie Worms, kleinere süddeutsche Orte oder einige Orte des heutigen Ungarn. Seit einiger Zeit schafft es auch die Stadt Xanten, sich erfolgreich als „Nibelungenstadt“ zu positionieren. Bei Worms wie auch bei Xanten wird dieses durch geschickte Tourismusförderung erreicht.
Zum Kreis des s.g. „Nibelungenstoffes“ gehört aber nicht nur das bekannte Nibelungenlied, sondern auch die skandinavische Thidrekssaga. Bei dieser Sagenkompilation spielt die Stadt Soest eine entscheidende Rolle: sie ist der Sitz König Attilas und Schauplatz des grausamen Unterganges der Nibelungen.
Die Stadt Soest war im Mittelalter eine bedeutende Handelsmetropole, weshalb sie nach heutigen Erkenntnissen von den Verfassern der Thidrekssaga, die wahrscheinlich nordische Kaufleute waren, eine so wichtige Stellung in der Sagenkompilation zugesprochen bekam. Heute ist Soest eine Kleinstadt, die ihre Verbindung zum Nibelungenstoff auf den ersten Blick nicht thematisiert. Warum eigentlich? Könnte nicht auch Soest seinen – zumindest literarischen – Anspruch auf den Nibelungenstoff geltend machen und sich einer Aufbereitung widmen? Wie sollte man es anstellen, literarisch korrekt und zugleich unterhaltend den Nibelungenstoff zu thematisieren? Die These, die die Arbeit leiten soll, lautet: Die Stadt Soest kann ihre literarische Verbindung zum Nibelungenstoff gezielt zur Tourismusförderung nutzen.
Vergleichend zur Rezeption des Nibelungenstoffes in Xanten und Worms kann die Soester Rezeption betrachtet werden. Dies ist wichtig, um über die zukünftige Aufbereitung des Sagenstoffes in Soest urteilen zu können. Es soll gezeigt werden, wie sich die Stadt z.B. in Lokalzeitungen oder eigenen Publikationen bisher dem Thema widmete. Gibt es hier schon eine Basis, auf der aufgebaut werden könnte? Lassen sich in der bisherigen, wenig öffentlichen Rezeption gewisse Tendenzen entdecken? Hier sollen sämtliche Soester Rezeptionszeugnisse vorgestellt werden. Dieser Teil der Arbeit mündet in ein Fazit über den derzeitigen Stand der Rezeption des Nibelungenstoffes in Soest.
Das Ziel der Arbeit ist ein Strategisches Tourismuskonzept zur Förderung des Soester Tourismus. Dieses soll die Möglichkeiten aufzeigen, die die Stadt Soest zur Aufbereitung des Nibelungenstoffes hat und neue Impulse für das Soester Stadtmarketing geben.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlegendes
- Einführung
- Rückblick auf das Projekt „Rezeption des Nibelungenstoffes" im Sommersemester 2004
- Kurze Zusammenfassung der Projektarbeit „Die Theorie des Nibelungenunterganges in der Stadt Soest sowie ihre Rezeption und Kommunikation"
- Die Stadt Soest und ihre Verbindung zum Nibelungenstoff
- Überleitung zum Thema dieser Arbeit
- Die Rezeption des Nibelungenstoffes in der Stadt Soest
- Zum Begriff der Rezeption
- Lokale Zeitungsmeldungen
- Berichte in anderen Drucksachen
- Das Faltblatt des Vereins für Geschichte und Heimatpflege Soest e. V.
- Das Faltblatt Heinz Ritters
- Die Soester Zeitschrift
- Mitteilungsblätter des Vereins für Geschichte und Heimatpflege Soest e.V.
- Füllhorn - Magazin für die älteren Bürger der Stadt Soest
- Niflungen-Tagungen und Niflungen-Bote
- Weitere Veranstaltungen
- Straßennamen
- Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Kapitels
- Möglichkeiten der Nutzung des Sagenpotenzials für die Soester Tourismusförderung
- Vorbemerkungen
- Die Bedeutung des Nibelungenliedes als Nationalmythos
- Grundsätzliches zu den Begriffen „Stadtmarketing", „Stadtwerbung“ und „Tourismusförderung"
- Die Stadt Worms und der Nibelungenmythos
- Die Stadt Xanten und der Nibelungenmythos
- Ideen für ein Strategisches Konzept zur Förderung des Soester Tourismus
- Der allgemeine Aufbau eines Strategischen Konzeptes zur Tourismusförderung
- Bestandsaufnahme in Soest
- Ausblick
- Strategiensuche
- Tourismuskonzept
- Bilanz und Anmerkungen
- Zusammenfassung
- Persönliche Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Rezeption des Nibelungenstoffes in der Stadt Soest und analysiert das Potenzial des Mythos für die Tourismusförderung und Stadtwerbung. Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Nibelungenforschung in Soest, insbesondere im Kontext der umstrittenen Thesen von Heinz Ritter.
- Rezeption des Nibelungenstoffes in Soest
- Potenzial des Nibelungenmythos für Tourismusförderung und Stadtwerbung
- Strategisches Tourismuskonzept
- Verbindung des Nibelungenstoffes mit der Stadtgeschichte von Soest
- Kritische Auseinandersetzung mit den Thesen von Heinz Ritter
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik und behandelt den historischen Hintergrund des Nibelungenstoffes in Soest. Es stellt die Verbindung zur Thidrekssaga und den umstrittenen Thesen von Heinz Ritter her. Das zweite Kapitel analysiert die Rezeption des Nibelungenstoffes in der Stadt Soest, indem es verschiedene Medien wie Zeitungsmeldungen, Drucksachen und Veranstaltungen untersucht. Das dritte Kapitel beleuchtet die Möglichkeiten der Nutzung des Nibelungenmythos für die Soester Tourismusförderung, wobei es sich mit Strategien und Konzeptentwicklung auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Nibelungenstoff, Nibelungenmythos, Thidrekssaga, Soest, Tourismusförderung, Stadtwerbung, Heinz Ritter, Rezeption, Stadtgeschichte, Nationalmythos, Strategisches Tourismuskonzept.
- Quote paper
- Master of Science Sarah Wulle (Author), 2004, Nibelungen-Mythos und Soest: Das Potenzial des Mythos für Tourismusförderung und Stadtwerbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77555