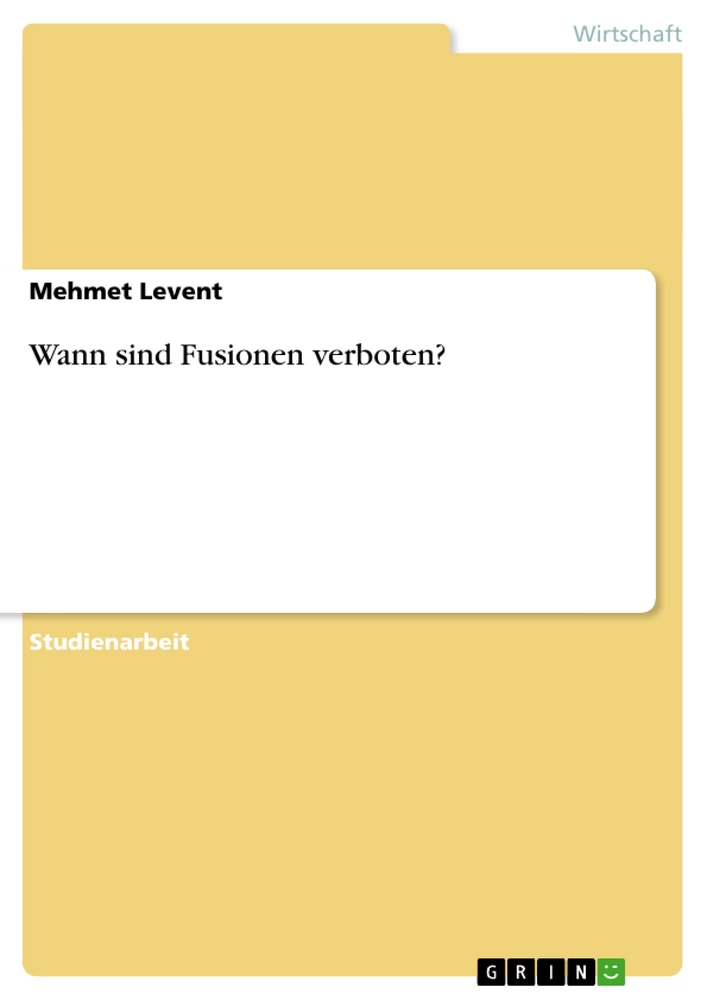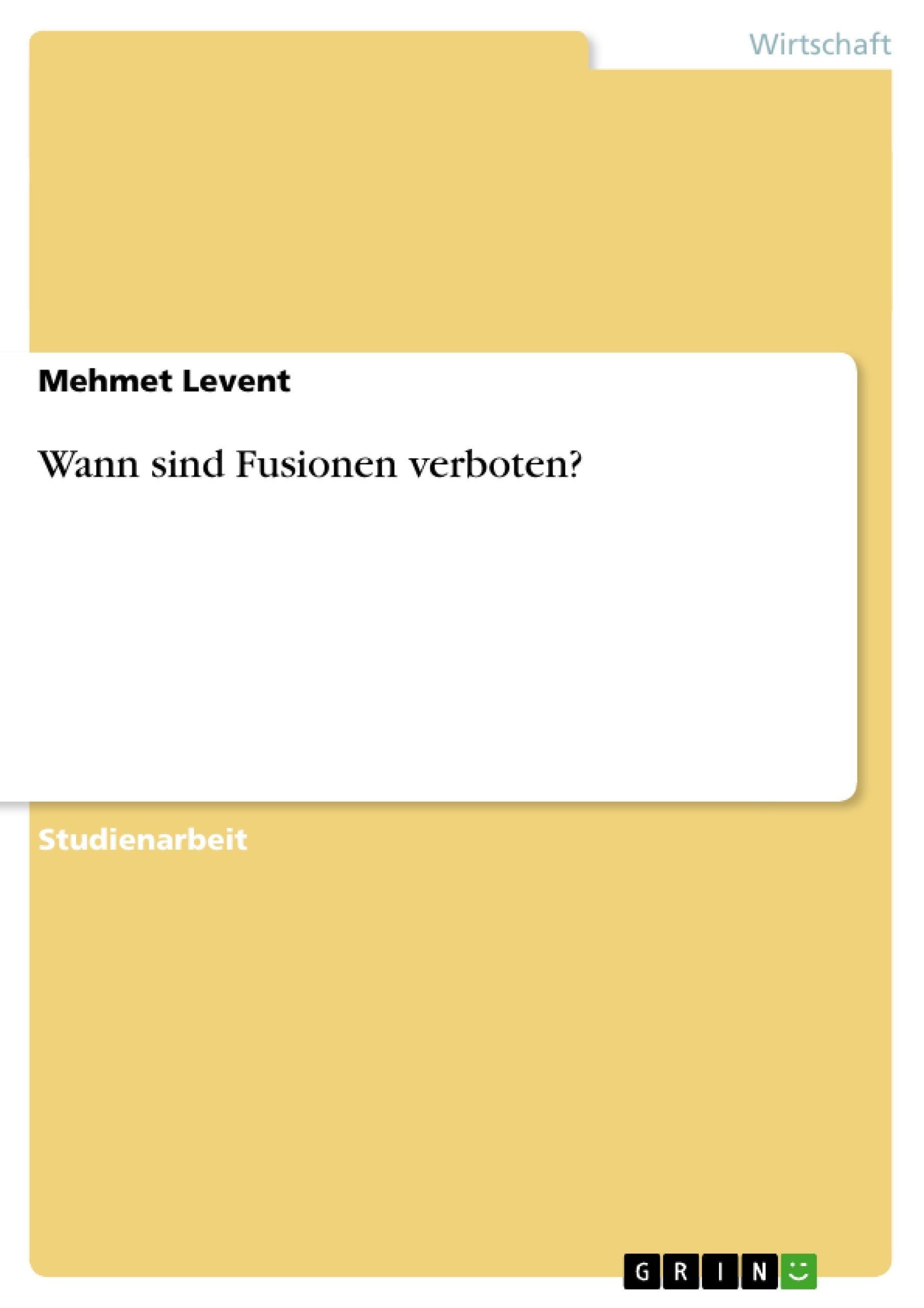Im Zeitalter der Globalisierung und des steigenden Wettbewerbs, haben Zusammenschlüsse der Unternehmen, sei es in Form von Kartellen, Konzernen oder in Form von Fusionen, ständig an Bedeutung gewonnen. Die Unternehmen schließen sich aus diversen Gründen zusammen: um Skaleneffekte und Marktanteile zu erhöhen, um Kosteneinsparungen zu realisieren, um Preispolitik zu betreiben oder um die Wettbewerbssituation für das Unternehmen zu verbessern. Es gibt jedoch auch zwingende Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen. Deshalb existieren Gesetze zur Kontrolle von Zusammenschlüssen nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in den USA, sowie in den meisten anderen Ländern der Welt. Die Untersagungskriterien von Zusammenschlüssen sind dabei länderspezifisch zu unterscheiden. In der vorliegenden Arbeit werden nur die Rahmenbedingungen der deutschen, europäischen und amerikanischen Gesetze zur Fusionskontrolle untersucht. Die Analyse der Gesetze und Rechte anderer Länder sind für die Untersuchung weniger relevant und würden den Umfang der Seminararbeit sprengen. Die Frage der Untersuchung lautet: “Wann sind Fusionen verboten?“. Es gibt viele unterschiedliche Kriterien, bei denen Fusionen untersagt werden können. Diese Merkmale werden während der Untersuchung erläutert und anhand der Gesetze und einem Beispiel aus der Praxis dargestellt. Es ist nicht einfach das Verbot von Fusionen einheitlich zu definieren, da die Entscheidungen zwischen den USA und Europa doch manchmal anders ausfallen können. Dies macht der Generell Electric`s (GE)/Honeywell Fall vom Jahre 2001, auf den in Kapital 5 näher eingegangen wird, besonders deutlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Gang der Arbeit
- Begriffsunterscheidung
- Fusion
- Kontrollerwerb
- Ökonomischer Aspekt der Fusionskontrolle
- Marktabgrenzung
- Sachliche Marktabgrenzung
- Räumliche Marktabgrenzung
- Zeitliche Marktabgrenzung
- Marktbeherrschung
- Rechtlicher Aspekt der Fusionskontrolle
- Deutsche Fusionskontrolle
- Europäische Fusionskontrolle
- FKVO
- EGV
- Amerikanische Fusionskontrolle
- Sherman Act
- Clayton Act
- Praktisches Beispiel: General Electric/Honeywell
- Firmenportrait General Electric (GE)
- Firmenportrait Honeywell
- Zeitlicher Ablauf der geplanten Fusion
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen von Fusionen in Deutschland, Europa und den USA. Das Hauptziel ist es, die Kriterien zu definieren, unter denen Fusionen verboten werden können, und die Unterschiede in der Rechtsprechung zwischen diesen drei Jurisdiktionen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die relevanten Gesetze und veranschaulicht die Anwendung anhand eines Praxisbeispiels.
- Begriffliche Abgrenzung von Fusion und Kontrollerwerb
- Ökonomische Aspekte der Fusionskontrolle (Marktabgrenzung und Marktbeherrschung)
- Rechtliche Aspekte der Fusionskontrolle in Deutschland, Europa und den USA
- Vergleich der Fusionskontrollgesetze und -praktiken in den drei Regionen
- Analyse eines Praxisbeispiels (General Electric/Honeywell)
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht, wann Fusionen verboten sind, wobei der Fokus auf den rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, der EU und den USA liegt. Die Problemstellung wird dargelegt und der Gang der Arbeit skizziert. Der Fall General Electric/Honeywell wird als illustratives Beispiel angekündigt, um die Unterschiede in der Rechtsprechung aufzuzeigen. Das Ziel ist, die komplexen Kriterien für Fusionsverbote zu analysieren und zu verstehen, warum die Entscheidungen in den verschiedenen Jurisdiktionen variieren können.
Begriffsunterscheidung: Dieses Kapitel differenziert zwischen Fusion und Kontrollerwerb. Eine Fusion wird als der Zusammenschluss von mindestens zwei Unternehmen definiert, bei dem diese ihre rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgeben. Die verschiedenen Arten von Fusionen (vertikal, horizontal, anorganisch) werden kurz erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Definition des Begriffs "Fusion" als Grundlage für die weitere Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Ökonomischer Aspekt der Fusionskontrolle: Hier werden die ökonomischen Kriterien der Fusionskontrolle beleuchtet. Die Marktabgrenzung (sachlich, räumlich, zeitlich) wird erklärt, um zu verstehen, wie Märkte definiert werden, um die Auswirkungen von Fusionen zu beurteilen. Der Begriff der Marktbeherrschung wird eingeführt als entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit nach einer Fusion. Dieser Abschnitt legt die ökonomischen Grundlagen für die rechtliche Bewertung von Fusionen.
Rechtlicher Aspekt der Fusionskontrolle: Dieses Kapitel vergleicht die rechtlichen Aspekte der Fusionskontrolle in Deutschland, der EU (mit Fokus auf FKVO und EGV) und den USA (Sherman Act und Clayton Act). Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen und deren Anwendung herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf den Rechtsgrundlagen und den jeweiligen Kriterien, die zur Untersagung von Fusionen führen können. Dies bildet den Kern der Arbeit und zeigt die länderübergreifenden Unterschiede im Umgang mit Fusionen.
Praktisches Beispiel: General Electric/Honeywell: Dieses Kapitel analysiert den Fall General Electric/Honeywell als Beispiel für die unterschiedliche Anwendung der Fusionskontrollgesetze in Europa und den USA. Es werden die Unternehmensprofile und der zeitliche Ablauf der geplanten Fusion dargestellt, um die Argumentationslinien der Behörden und das letztendliche Ergebnis zu beleuchten. Dieser Abschnitt illustriert die in den vorherigen Kapiteln dargestellten theoretischen Konzepte anhand eines konkreten Falles.
Schlüsselwörter
Fusionen, Fusionskontrolle, Wettbewerbsrecht, Marktabgrenzung, Marktbeherrschung, FKVO, EGV, Sherman Act, Clayton Act, General Electric, Honeywell, Zusammenschlüsse, wirtschaftliche Selbstständigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Fusionskontrolle im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen von Fusionen in Deutschland, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Sie analysiert die Kriterien für das Verbot von Fusionen und vergleicht die Rechtsprechung in diesen drei Jurisdiktionen anhand des Praxisbeispiels General Electric/Honeywell.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die begriffliche Abgrenzung von Fusion und Kontrollerwerb; ökonomische Aspekte der Fusionskontrolle (Marktabgrenzung und Marktbeherrschung); rechtliche Aspekte der Fusionskontrolle in Deutschland, Europa und den USA; einen Vergleich der Fusionskontrollgesetze und -praktiken in diesen drei Regionen; und eine Analyse des Praxisbeispiels General Electric/Honeywell.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Begriffsunterscheidung (Fusion vs. Kontrollerwerb), ein Kapitel zu den ökonomischen Aspekten der Fusionskontrolle (Marktabgrenzung, Marktbeherrschung), ein Kapitel zu den rechtlichen Aspekten der Fusionskontrolle in Deutschland, der EU (FKVO, EGV) und den USA (Sherman Act, Clayton Act), ein Kapitel zum Praxisbeispiel General Electric/Honeywell und ein Resümee.
Welche Gesetze werden im Detail behandelt?
Die Arbeit analysiert die relevanten Gesetze zur Fusionskontrolle, darunter die deutsche Fusionskontrolle, die Europäische Fusionskontrollverordnung (FKVO), die EG-Vertrag (EGV), den Sherman Act und den Clayton Act (USA).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die Kriterien für das Verbot von Fusionen zu definieren und die Unterschiede in der Rechtsprechung zwischen Deutschland, der EU und den USA aufzuzeigen. Die Arbeit soll die komplexen Kriterien für Fusionsverbote analysieren und erklären, warum die Entscheidungen in den verschiedenen Jurisdiktionen variieren können.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Die geplante Fusion zwischen General Electric und Honeywell dient als illustratives Praxisbeispiel, um die unterschiedliche Anwendung der Fusionskontrollgesetze in Europa und den USA zu verdeutlichen. Die Arbeit analysiert die Unternehmensprofile, den zeitlichen Ablauf und das Ergebnis des Verfahrens.
Welche ökonomischen Aspekte werden betrachtet?
Die ökonomischen Aspekte umfassen die Marktabgrenzung (sachlich, räumlich, zeitlich) und die Marktbeherrschung. Diese Konzepte sind entscheidend für die Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit nach einer Fusion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Fusionen, Fusionskontrolle, Wettbewerbsrecht, Marktabgrenzung, Marktbeherrschung, FKVO, EGV, Sherman Act, Clayton Act, General Electric, Honeywell, Zusammenschlüsse, wirtschaftliche Selbstständigkeit.
Wie wird der Begriff "Fusion" definiert?
Eine Fusion wird als der Zusammenschluss von mindestens zwei Unternehmen definiert, bei dem diese ihre rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgeben. Die Arbeit erläutert auch verschiedene Arten von Fusionen (vertikal, horizontal, anorganisch).
Wie werden die Unterschiede in der Rechtsprechung der drei Jurisdiktionen dargestellt?
Die Unterschiede in der Rechtsprechung werden durch einen Vergleich der gesetzlichen Regelungen und deren Anwendung in Deutschland, der EU und den USA herausgearbeitet. Das Praxisbeispiel General Electric/Honeywell veranschaulicht diese Unterschiede anhand eines konkreten Falles.
- Arbeit zitieren
- Mehmet Levent (Autor:in), 2004, Wann sind Fusionen verboten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77574