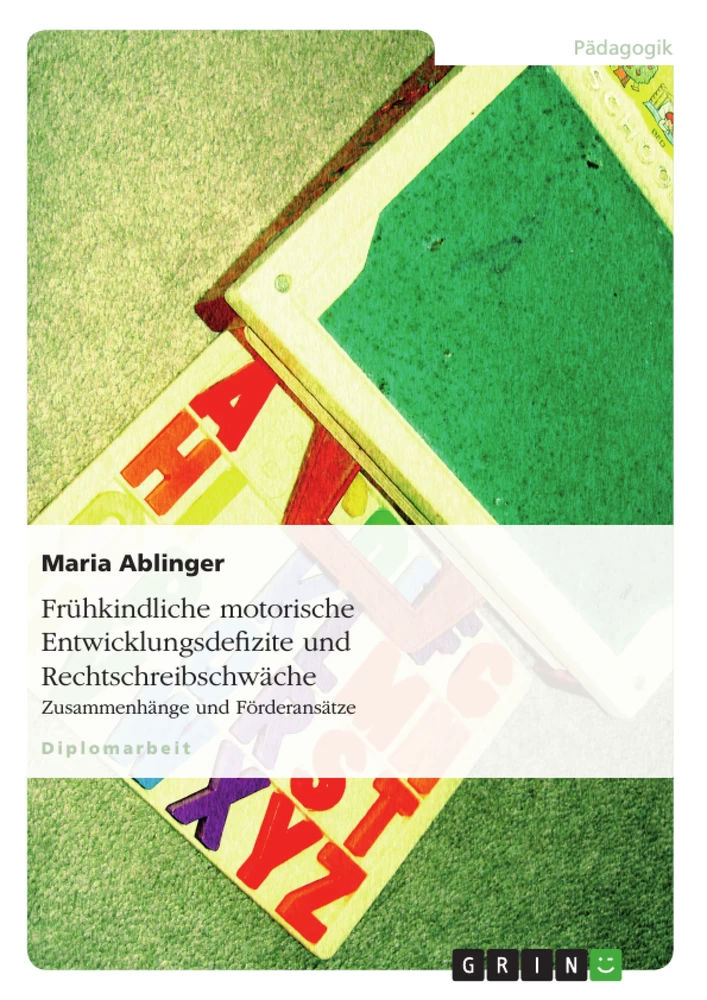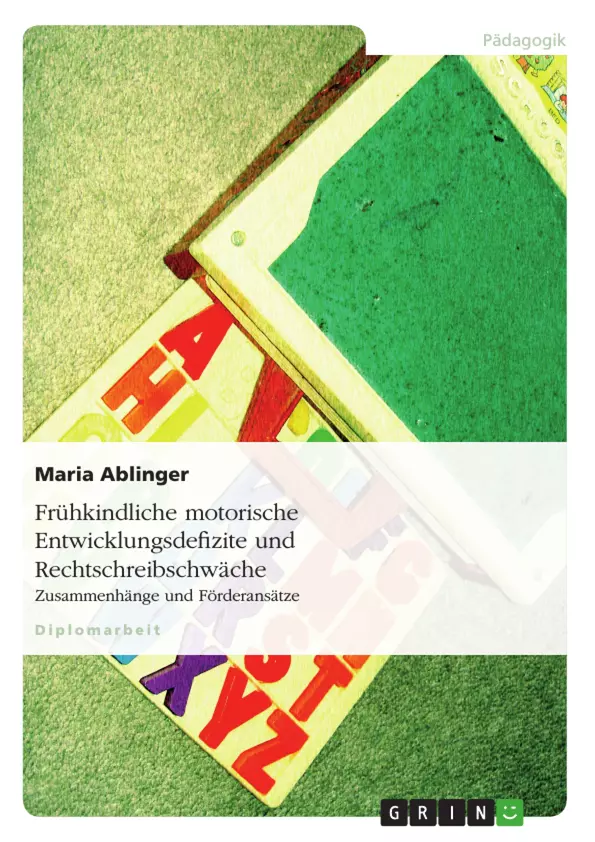Bei Kindern mit Lese- Rechtschreibschwäche werden häufig auch motorische Entwicklungsrückstände beobachtet. Diese Arbeit behandelt die Zusammenhänge zwischen motorischen Defiziten und Schwierigkeiten beim Rechtschreiben. Aufbauend auf die einschlägige Fachliteratur zum Thema werden die wichtigsten Störungen der motorischen Entwicklung beschrieben und mögliche Korrelationen mit Lese-Rechtschreibschwäche aufgezeigt.
Die daraus entwickelten Hypothesen werden in einer empirischen Untersuchung unter Zuhilfenahme eines Rechtschreibtests, eines Elternfragebogens und eines motorischen Tests überprüft. Es zeigt sich, dass Zusammenhänge zwischen Rechtschreibleistung und auffälliger oder verzögerter motorischer Entwicklung sowie motorischen Fähigkeiten bestehen. Kinder mit Rechtschreibschwäche weisen schlechtere Gesamtergebnisse beim motorischen Test auf und sind häufiger nicht gekrabbelt als Kinder ohne Rechtschreibschwäche.
Ausgehend von diesen Ergebnissen werden abschließend Förderansätze im motorischen Bereich beschrieben und deren Einsatz in der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Lese- Rechtschreibschwäche diskutiert.
Schlüsselwörter:
Motorik, Lese- Rechtschreibschwäche, Legasthenie, frühkindliche Reflexe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract deutsch
- Abstract englisch
- Einleitung
- 1. Begriffsklärungen
- 1.1 Motorik
- 1.2 Entwicklungsdefizite
- 1.3 Frühkindliche Reflexe
- 1.4 Lese-Rechtschreibschwäche - Legasthenie
- 2. Lese-Rechtschreibschwäche
- 2.1 Grundlagen des Schriftspracherwerbs
- 2.2 Symptomatik der Lese-Rechtschreibschwäche
- 2.3 Epidemiologie
- 2.4 Ursachen
- 2.5 Diagnostik
- 2.6 Förderung und Therapie
- 3. Die motorische Entwicklung des Kindes
- 3.1 Gehirnentwicklung - Grundlage der Bewegungsentwicklung
- 3.2 Wahrnehmung und sensorische Integration
- 3.3 Die Prinzipien der motorischen Entwicklung
- 3.4 Die wichtigsten Entwicklungsschritte
- 3.5 Frühkindliche Reflexe und Reaktionen
- 3.6 Lebenslange Halte- und Stellreaktionen
- 4. Störungen der motorischen Entwicklung und Auswirkungen auf Lernverhalten und Rechtschreibprobleme
- 4.1 Umschriebene Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen
- 4.2 Entwicklungsverzögerungen und Überspringen von Entwicklungsphasen
- 4.3 Sensorische Integrationsstörungen
- 4.4 Fein- und graphomotorische Defizite
- 4.5 Kopfgelenks-Induzierte-Symmetriestörung - KISS
- 4.6 Persistierende Restreaktionen frühkindlicher Reflexe
- 5. Zusammenfassung und Hypothesenentwicklung
- 6. Empirische Untersuchung
- 6.1 Stichprobe
- 6.2 Angewandte Untersuchungsverfahren
- 6.3 Instrumente
- 6.4 Testgütekriterien
- 6.5 Untersuchungsverlauf
- 6.6 Verfahren der Datenanalyse
- 7. Ergebnisse
- 7.1 Deskriptive Ergebnisbeschreibung
- 7.2 Hypothesenprüfung
- 7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 8. Diskussion
- 8.1 Diskussion der Ergebnisse
- 8.2 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand
- 8.3 Kritische Würdigung der Untersuchung
- 8.4 Ausblick
- 9. Relevanz für die Praktische Arbeit – Förderansätze
- 9.1 Psychomotorik und Motopädagogik
- 9.2 Mototherapie
- 9.3 Reflexhemmende Übungsprogramme
- 9.4 Neurofunktionelle Reorganisation nach Padovan
- 9.5 Sensorische Integrationstherapie
- 9.6 Edu-Kinestetik
- 9.7 Weitere Therapiemöglichkeiten
- Schlusswort
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob und in welcher Weise frühkindliche motorische Entwicklungsdefizite mit Rechtschreibschwäche bei Kindern zusammenhängen. Ziel ist es, die relevanten Zusammenhänge zwischen motorischen Störungen und Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb aufzuzeigen und daraus resultierende Förderansätze zu diskutieren.
- Frühkindliche Reflexe und ihre Auswirkungen auf die motorische Entwicklung
- Entwicklungsverzögerungen und Störungen der motorischen Funktionen
- Zusammenhänge zwischen motorischen Defiziten und Rechtschreibschwäche
- Mögliche Ursachen und Risikofaktoren für Rechtschreibschwäche
- Förderansätze für Kinder mit motorischen Entwicklungsdefiziten und Rechtschreibschwäche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und skizziert den Forschungsstand zum Thema. Im ersten Kapitel werden wichtige Begrifflichkeiten definiert, darunter Motorik, Entwicklungsdefizite, frühkindliche Reflexe und Lese-Rechtschreibschwäche. Das zweite Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Phänomen der Lese-Rechtschreibschwäche, wobei Symptomatik, Epidemiologie, Ursachen, Diagnostik und Fördermöglichkeiten beleuchtet werden. In Kapitel 3 wird die motorische Entwicklung des Kindes in ihren verschiedenen Phasen dargestellt, wobei die Bedeutung der Gehirnentwicklung, der sensorischen Integration und der frühkindlichen Reflexe hervorgehoben wird. Kapitel 4 thematisiert Störungen der motorischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf das Lernverhalten, insbesondere im Hinblick auf Rechtschreibprobleme. Kapitel 5 fasst die bisherige Diskussion zusammen und formuliert Hypothesen, die in der empirischen Untersuchung überprüft werden sollen. Im sechsten Kapitel werden die Methodik und die verwendeten Instrumente der empirischen Untersuchung beschrieben. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 7 präsentiert, wobei sowohl deskriptive Ergebnisse als auch die Hypothesenprüfung dargestellt werden. Kapitel 8 widmet sich der Diskussion der Ergebnisse und setzt diese in den aktuellen Forschungsstand. Abschließend werden in Kapitel 9 verschiedene Förderansätze im motorischen Bereich vorgestellt und deren Einsatz in der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche diskutiert.
Schlüsselwörter
Motorik, Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie, frühkindliche Reflexe, sensorische Integration, Entwicklungsverzögerung, Förderansätze, Schriftspracherwerb.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Motorik und Rechtschreibschwäche?
Ja, die empirische Untersuchung zeigt, dass Kinder mit Rechtschreibschwäche oft auffällige oder verzögerte motorische Entwicklungen aufweisen.
Welche Rolle spielt das Krabbeln in der Entwicklung?
Die Studie ergab, dass Kinder mit Rechtschreibschwäche häufiger die Krabbelphase übersprungen haben als Kinder ohne diese Schwäche.
Was sind persistierende frühkindliche Reflexe?
Das sind Reflexe, die über das Säuglingsalter hinaus bestehen bleiben und willkürliche Bewegungsabläufe sowie das Lernverhalten negativ beeinflussen können.
Was ist das KISS-Syndrom?
KISS steht für Kopfgelenks-Induzierte-Symmetriestörung, eine Fehlstellung im Halswirbelbereich, die Auswirkungen auf die gesamte motorische Entwicklung haben kann.
Welche Förderansätze werden in der Arbeit empfohlen?
Diskutiert werden unter anderem Motopädagogik, Reflexhemmungsprogramme, sensorische Integrationstherapie und die neurofunktionelle Reorganisation nach Padovan.
- Arbeit zitieren
- Mag. Maria Ablinger (Autor:in), 2006, Frühkindliche motorische Entwicklungsdefizite und Rechtschreibschwäche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77796