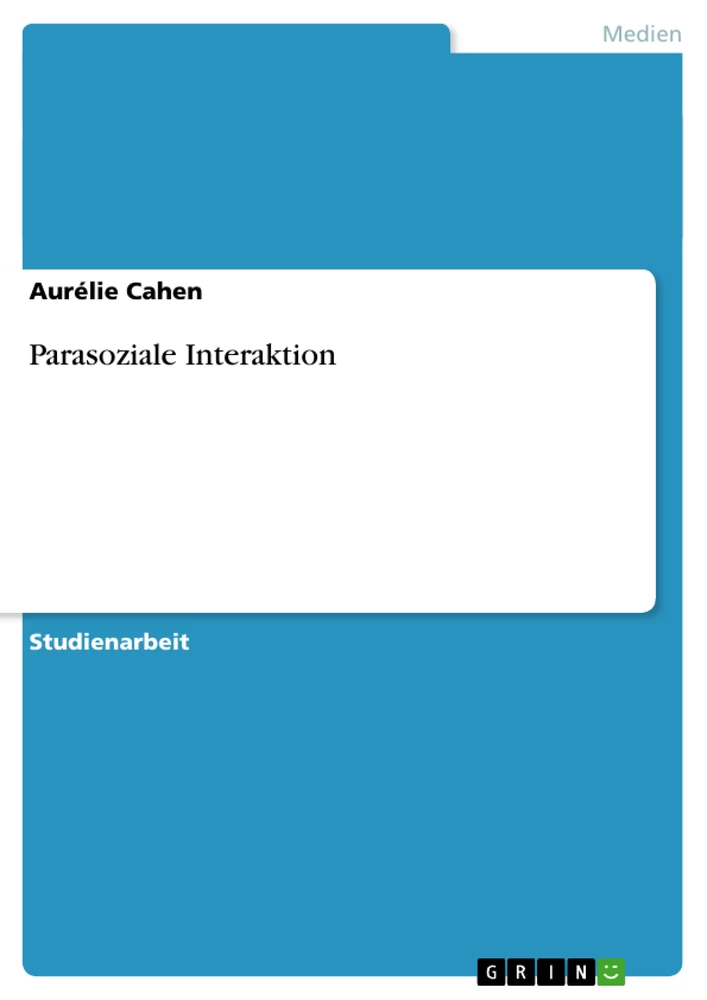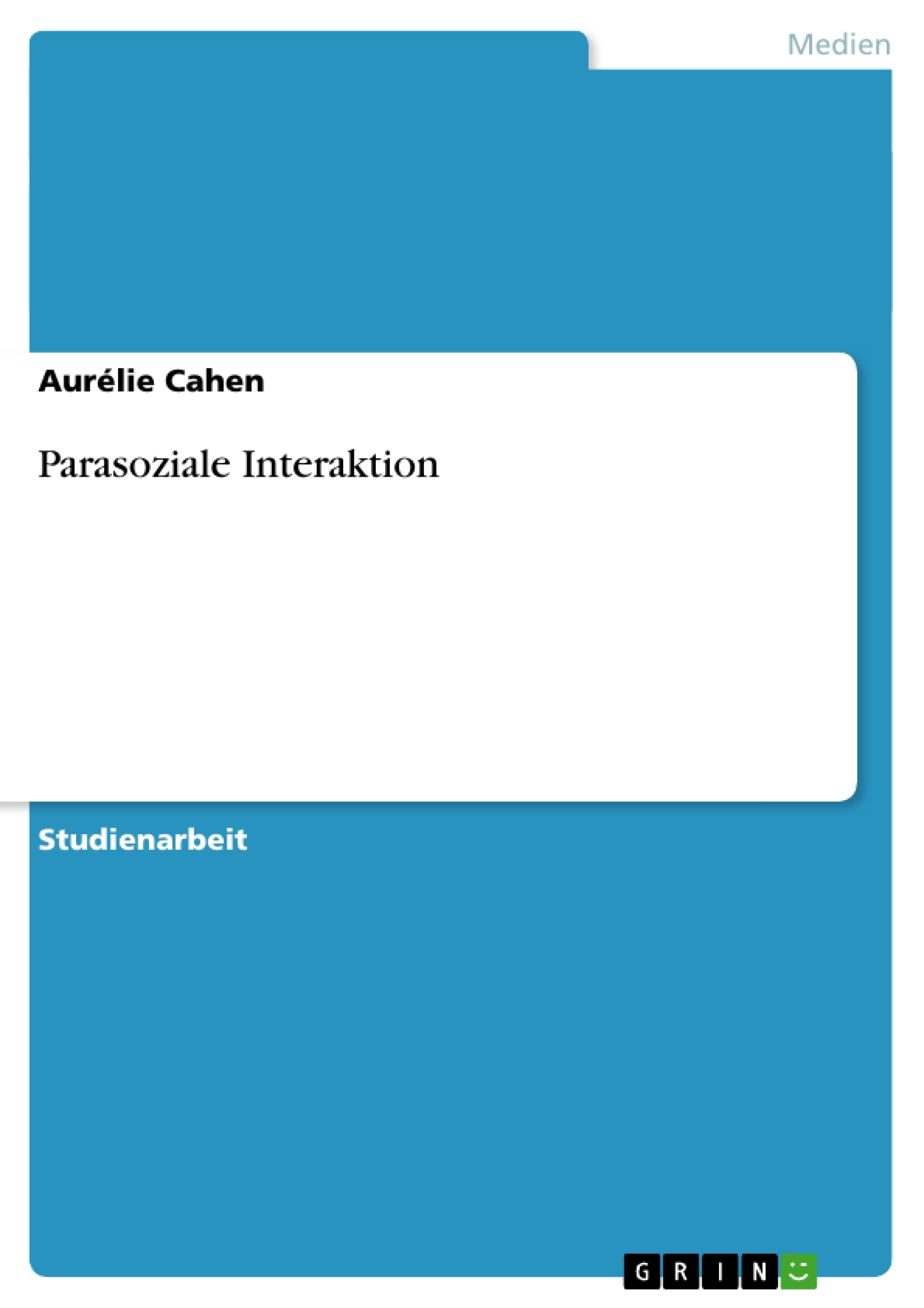Der Begriff "parasoziale Interaktion" wurde von den amerikanischen Psychiatern Donald Horton und Richard R. Wohl geprägt. Horton und Wohl untersuchten in den 50er Jahren den Umgang des Rezipienten mit den sich rasch verbreitenden Massenmedien Radio, Fernsehen und Kino. Wichtig war ihnen dabei vor allem die Frage, welche psychischen Prozesse bei der Rezeption ablaufen. In ihrem 1956 veröffentlichten Aufsatz ,,Mass communication and parasocial interaction: Observation on intimacy at a distance" (Horton/Wohl, 1956), beschreiben sie das Phänomen, das Zuschauer gegenüber den Personen auf dem Bildschirm in ähnlicher Weise reagieren, wie in zwischenmenschlichen Interaktionsprozessen: Sie verhalten sich so, als ob sie von ihnen persönlich angesprochen seien. Diese simulierte Interaktion nennen sie "parasoziale Interaktion". Mit diesem Konzept lehnten Horton und Wohl die damals verbreitete Vorstellung von Zuhörern bzw. Zuschauern als passive Beobachter des Geschehens ab und verwarfen Rezeptionsmodelle, die die Massenmedien in Analogie zu Träumen und Phantasien interpretieren. 1957 folgte eine Arbeit von Horton und Strauss, in welcher die anfängliche Idee weiter entwickelt und präzisiert wurde. Dennoch blieben einige Aspekte des ursprünglichen Konzepts unklar, was leider dazu führte, daß dieses Konzept in der Vergangenheit häufig mißverstanden wurde und lange Zeit ein "Schattendasein" in der Kommunikationswissenschaft führte (Mikos, 1996, S. 97). Die geringe Beachtung, die dieses Konzept in der Kommunikationswissenschaft erfuhr, kann zudem darauf zurückgeführt werden, daß sich die Forschung zur interpersonalen Kommunikation und die Massenkommunikationsforschung zunächst als zwei mehr oder weniger voneinander getrennte Disziplinen mit unterschiedlich theoretischen Hintergründen und Forschungsschwerpunkten entwickelt haben (Frey, 1996, S. 145). Nachdem aber die Massenkommunikationsforschung sich Jahrzehnte vordergründig mit der Frage beschäftigt hatte, ob Medien Einstellungs- und somit auch Verhaltensänderungen bewirken könnten, rückte in den letzten Jahren immer mehr die Frage in den Vordergrund, wie die Zuschauer mit dem Fernsehen umgehen und welche psychischen, sozialen und emotionalen Prozesse bei der Rezeption ablaufen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Parasoziale Interaktion
- 1.1 Die ,,Illusion"
- 1.2. ,,So-tun-als-ob"
- 1.3. ,,sich hineinversetzen"
- 2. Parasoziale Beziehungen
- 2.1. Der,,Medienfreund“
- 2.2. Empirische Ergebnisse
- Schluß
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der parasozialen Interaktion, wie es von Horton und Wohl geprägt wurde, und analysiert die Bedeutung dieser Interaktion in der heutigen Medienlandschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Zuschauer mit Fernsehfiguren interagieren und welche psychischen Prozesse dabei ablaufen.
- Definition und Entstehung von parasozialer Interaktion
- Unterscheidung zwischen interpersonaler und massenmedial vermittelter Kommunikation
- Die Rolle von parasozialer Interaktion in der Rezeption von Fernsehprogrammen
- Die Entwicklung von parasozialen Beziehungen und ihre Bedeutung für das soziale Gefüge
- Kompensation von sozialen Mangelgefühlen durch medial vermittelte Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit widmet sich der Definition des Begriffs „parasoziale Interaktion“. Es wird beleuchtet, wie es zu dieser Interaktion kommen kann und ob eine direkte Adressierung an den Zuschauer notwendig ist. Im zweiten Kapitel stehen parasoziale Beziehungen im Vordergrund. Diese entstehen aus parasozialer Interaktion und haben einen Einfluss auf das soziale Gefüge des Zuschauers. Die Arbeit untersucht, ob das Erleben von medial vermittelten Beziehungen zu Fernsehfiguren soziale Defizite kompensieren kann.
Schlüsselwörter
Parasoziale Interaktion, Massenkommunikation, Fernsehfiguren, Interpersonale Kommunikation, Rezeption, Medienfreund, soziale Beziehungen, Mangelgefühle.
- Citation du texte
- Aurélie Cahen (Auteur), 2002, Parasoziale Interaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7783