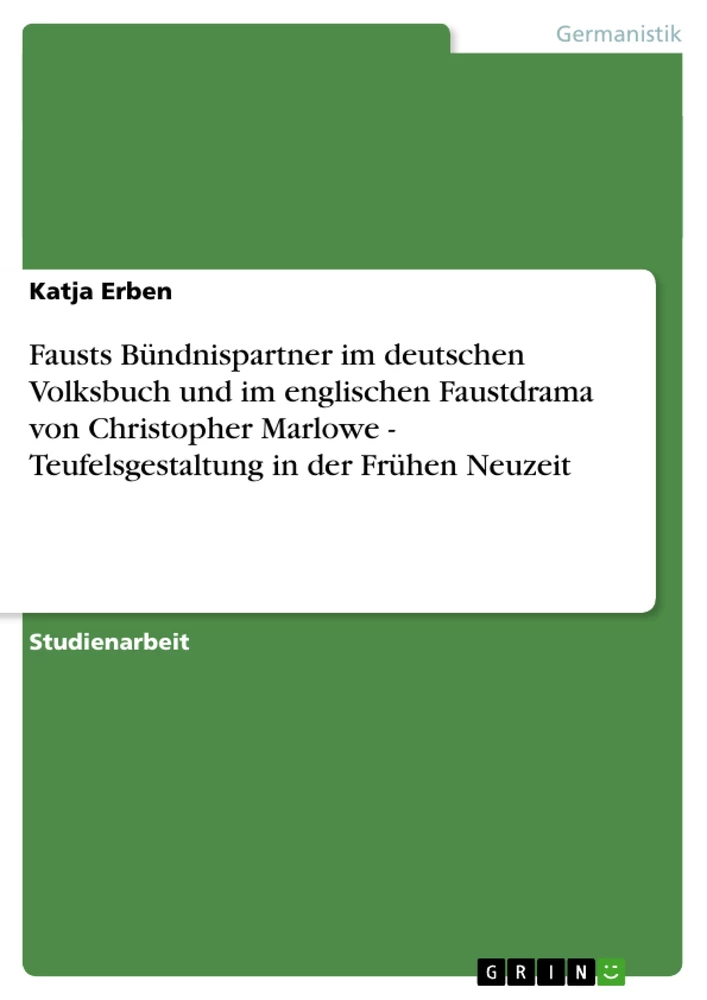Die zwei literarischen Figuren Faust und Mephistopheles sind, unabhängig davon welche der zahlreichen Faustgeschichten man betrachtet, so unlöslich miteinander verquickt , dass es meines Erachtens nach verwundern muss, dass die Faustforschung sich sehr viel interessierter mit dem Schwarzkünstler beschäftigt hat, als mit dem von ihm beschworenen Teufel. Günther Mahal macht in wenigen, äußerst kurzen Absätzen deutlich, warum der eine ohne den anderen nicht funktioniert: „Faust allein – er bliebe ein wenig interessanter Einzelfall […], ein Möchte-gern-Großer, dem zur Umsetzung seiner Pläne, Theorien und Wünsche die Macht fehlt […].“ , wohingegen Mephistopheles ohne Faust „ein Dutzendteufel […] unter der Millionenzahl der infernalischen Truppe, ein Anonymus des widergöttlichen Regiments, einer der namenlosen Teufel […]“ wäre, die keinen Zugriff auf den Menschen haben, wenn der es nicht zulässt, wie es Faust tut.
Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass zumindest die Quantität der Forschung zu Mephistopheles von Faustdichtung zu Faustdichtung zunimmt. Während zum Beispiel über den Geist der „Historia von D. Johann Fausten“ und über den Teufel des Marloweschen Faustdramas nur wenig Material zu finden ist, ist die Fülle an Arbeiten über Goethes Mephisto enorm .
In meiner Arbeit werde ich mich auf eine Untersuchung der Teufelsfigur in der Historia und in der Tragical History of Doctor Faustus beschränken, weil die Auseinandersetzung mit der Historia sowie der ersten dramatischen Adaption des Fauststoffes von Marlowe, die rezeptionsbedingte Grundlage für die Beschäftigung mit Goethes Faust sein muss.
Vor dem Hintergrund einer Analyse der Darstellungsform der Teufelsfigur und des Machtverhältnisses zwischen Faust und Mephostophiles in der Historia von 1587 in Kapitel 3, werde ich im 4. Kapitel Darstellungsform und Macht des Marloweschen Mephistopheles aus dem Faustdrama von 1588/89 herausarbeiten. In einer vergleichenden Abschlussbetrachtung sollen wesentliche Unterschiede in Konzeption, Figurenkonstellation und Funktion der beiden Werke herausgearbeitet werden.
Aufgrund der Figurenpaarkonstellation Faust – Mephistopheles ist es notwendig, neben den Teufelsfiguren auch den Teufelsbündler in die Analyse einzubeziehen, wobei es nicht Ziel dieser Arbeit ist, eine umfassende Interpretation der jeweiligen Faustfigur mitzuliefern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Themeneingrenzung
- Das Teufelsbild in der christlichen Tradition und der Einfluss Luthers
- Die Historia von D. Johann Fausten
- Vorbemerkung
- Der Geist Mephostophiles – Fausts Bündnispartner im Volksbuch
- Die Darstellungsform des Teufelsapparats und ihre Funktion
- Das Machtverhältnis zwischen Faustus und Mephostophiles
- Christopher Marlowe: Die tragische Historie vom Doktor Faustus
- Vorbemerkung
- Mephistopheles im ältesten überlieferten Faustdrama
- Die Darstellungsform des Teufelsapparats und ihre Funktion
- Machtverhältnis zwischen Faust und Mephistopheles
- Vergleichende Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Teufelsfigur in der „Historia von D. Johann Fausten“ und in der „Tragical History of Doctor Faustus“ zu untersuchen. Dabei stehen die Darstellungsform der Teufelsfigur und das Machtverhältnis zwischen Faust und Mephostophiles im Zentrum der Betrachtung. Die Analyse der beiden Werke soll aufzeigen, wie die Teufelsfigur in der Frühen Neuzeit literarisch konstruiert wurde und welche Funktion sie im Kontext der jeweiligen Handlung einnimmt.
- Die historische Entwicklung des Teufelsbildes in der christlichen Tradition
- Die Rolle des Teufels in der „Historia von D. Johann Fausten“
- Die Darstellung des Mephostophiles in Marlowes „Tragical History of Doctor Faustus“
- Der Vergleich der Teufelsfiguren in den beiden Werken
- Die Funktion der Teufelsfigur im Kontext der frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Themeneingrenzung und die Forschungsfrage definiert. Anschließend wird im zweiten Kapitel das Teufelsbild in der christlichen Tradition und der Einfluss Luthers auf die Teufelsvorstellungen der Frühen Neuzeit beleuchtet. Kapitel 3 widmet sich der „Historia von D. Johann Fausten“. In diesem Kapitel werden die Darstellungsform des Teufelsapparats und das Machtverhältnis zwischen Faustus und Mephostophiles analysiert. Kapitel 4 untersucht die Teufelsfigur im ältesten überlieferten Faustdrama von Christopher Marlowe, der „Tragical History of Doctor Faustus“. Auch hier werden die Darstellungsform des Teufelsapparats und das Machtverhältnis zwischen Faust und Mephistopheles im Vordergrund stehen. Die Arbeit endet mit einer vergleichenden Abschlussbetrachtung, in der die wichtigsten Erkenntnisse und Unterschiede der beiden Werke herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Teufelsfigur, Mephostophiles, Faust, Historia von D. Johann Fausten, Tragical History of Doctor Faustus, christliche Tradition, Teufelsbild, Darstellungsform, Machtverhältnis, Frühe Neuzeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Faust und Mephistopheles literarisch unzertrennlich?
Ohne Mephisto wäre Faust nur ein machtloser Träumer; ohne Faust wäre Mephisto nur ein namenloser "Dutzendteufel" ohne Zugriff auf die menschliche Seele.
Was unterscheidet den Teufel im Volksbuch von Marlowes Mephistopheles?
Die Arbeit analysiert Unterschiede in der Konzeption, der Figurenkonstellation und der Funktion der Teufelsfigur zwischen der Historia von 1587 und Marlowes Drama.
Welchen Einfluss hatte Martin Luther auf das Teufelsbild dieser Zeit?
Luthers Vorstellungen vom Teufel als realer, bedrohlicher Macht prägten das christliche Weltbild der Frühen Neuzeit und damit auch die literarischen Faust-Stoffe.
Wie wird das Machtverhältnis zwischen Faust und dem Teufel dargestellt?
Die Untersuchung zeigt, wer in den jeweiligen Werken die Oberhand behält und wie der Teufelspakt die Handlungsfreiheit der Protagonisten einschränkt.
Warum ist die Beschäftigung mit Marlowe wichtig für das Verständnis von Goethes Faust?
Marlowes "Doctor Faustus" war die erste dramatische Adaption des Stoffes und bildet zusammen mit dem Volksbuch die rezeptionsbedingte Grundlage für Goethes späteres Meisterwerk.
Was war die Funktion des "Teufelsapparats" in der Frühen Neuzeit?
Er diente nicht nur der Unterhaltung, sondern hatte oft eine moralisierende Funktion, um vor den Gefahren der schwarzen Magie und der Abkehr von Gott zu warnen.
- Quote paper
- Katja Erben (Author), 2006, Fausts Bündnispartner im deutschen Volksbuch und im englischen Faustdrama von Christopher Marlowe - Teufelsgestaltung in der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78060