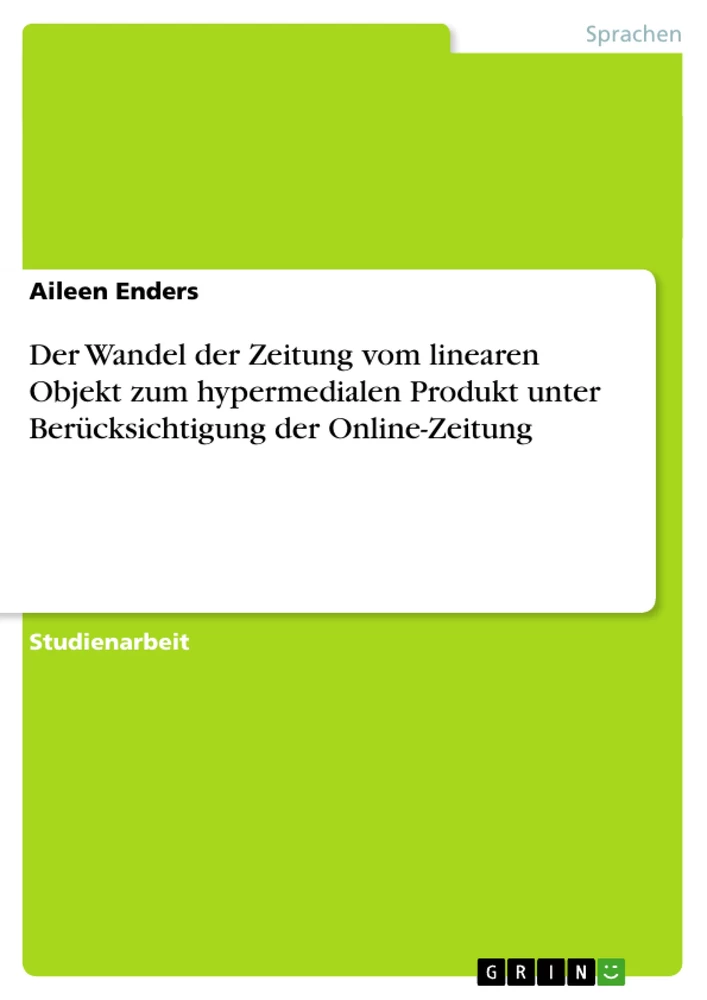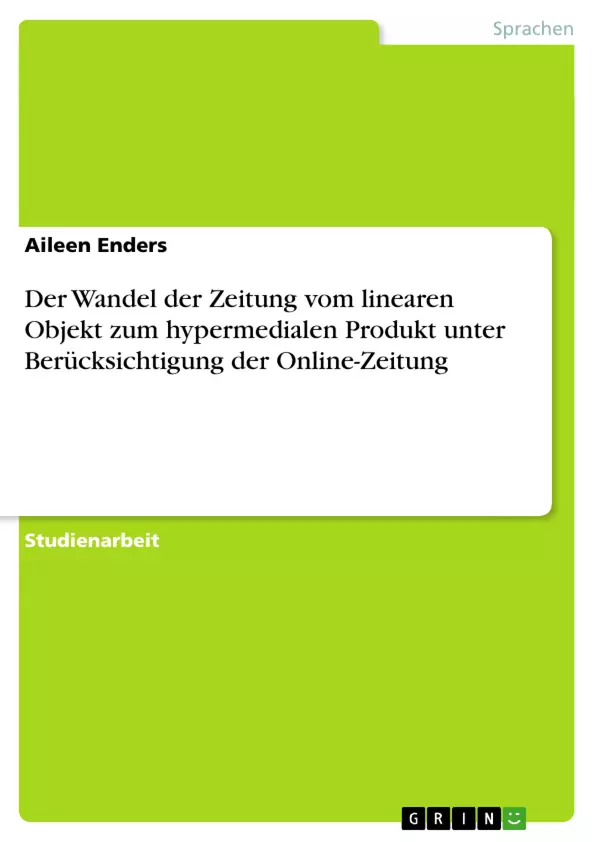Die Zeitung war über jahrhunderte hinweg das Medium Nummer Eins, um alltägliche Informationen zu erlangen. Dabei ist es kein Geheimnis mehr, dass auch sie sich im Laufe der Zeit an die moderne Welt anpassen musste, um weiterhin gefragt zu bleiben. Sie „[…] präsentiert auf immer mehr Raum immer mehr Informationen mit den zusätzlichen Informationskanälen Bild und Grafik, obwohl ihre Leser kontinuierlich weniger Zeit in die Lektüre investieren. Textdesign ist eine Strategie, um dieses Dilemma in der Leser-Blatt-Beziehung aufzulösen. Sie unterstützt die selektive Lektüre und hilft, den Informationsfluss zu kanalisieren“ (Blum (1998): 16).
Bezüglich dieser Wandlung spielen sowohl thematische als auch darstellerische Änderungen eine Rolle, wobei letzteres, das „Design“, die Präsentation der Zeitungen und Zeitschriften im Laufe meiner Arbeit eine besonders wichtige Stellung einnehmen werden.
Doch gerade die Wandlung bezüglich der neuen Darstellung zieht viele Kritiker an, so dass sich die bunte Welt der Zeitungen in zwei Pole gespalten hat: die von der neuen Art der Zeitungsgestaltung Begeisterten, sowie die scharfen Kritiker, die wie Wolfgang Koschnick die Ansicht vertreten:
„Das moderne Zeitungsdesign läuft auf die Reduktion des Inhalts auf Kosten der Verpackung hinaus. […] Durch Reduktion der angebotenen Informationsmenge tritt an die Stelle der Textlastigkeit eine bunte Mischung von leicht verdaulichem Text, bunten Bildern und Grafiken“ (Wolfgang Koschnick: Deutscher Drucker 18,13.5.1993, S. 18).
Diese Ansicht möchte vielen sehr vermessen erscheinen, denn Textdesign ist weitaus mehr, als eine „Verpackung“, die über schlechte Texte oder Informationsverbreitung hinwegtäuschen soll. Inwieweit spielt die Darstellung der Zeitung heute überhaupt eine Rolle, und warum ist die Zeitung überhaupt gezwungen, diesen Veränderungen offen gegenüberzustehen? Und wie stark sind die technisch-medialen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, wie beispielsweise die Möglichkeit die Zeitung „online“ zu lesen, zu bewerten? Stellt diese Möglichkeit des „up to date“ – Bleibens eine Gefahr für die Print-Version dar, oder lässt sie sich lediglich als eine „logische Konsequenz“ (vgl. Bucher (1999): 9), eine Erweiterung des gedruckten Exemplars begreifen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen und Begriffsklärung
- Mehrkanaligkeit
- Numerische Grafiken
- Erklärgrafiken
- Topografiken
- Clusterbildung
- thematische Segmentierung
- funktionale Segmentierung
- perspektivische Segmentierung
- prinzipiengeleitete Segmentierung
- Bedeutungsjournalistische Tendenzen
- selektive Leserschaft
- Ursachen
- Besonderheiten der Online-Zeitung
- Fazit: Online-Zeitung als Verdrängung oder als Erweiterung der Print-Version?
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Veränderungen, die die Zeitung vom linearen Objekt zum hypermedialen Produkt durchläuft, mit besonderem Fokus auf die Online-Zeitung. Sie analysiert die Rolle des Textdesigns in diesem Wandel und beleuchtet die Auswirkungen der neuen Darstellungsformen auf die Leserschaft.
- Entwicklung des Textdesigns in Zeitungen
- Einfluss von Mehrkanaligkeit und Clusterbildung auf die Textgestaltung
- Bedeutung von Online-Zeitungen im Kontext des Medienwandels
- Die Frage nach der Verdrängung oder Erweiterung der Print-Version durch die Online-Zeitung
- Kritik an neuen Textgestaltungsprinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der sich wandelnden Zeitung ein und skizziert die Herausforderungen, die sich durch die zunehmende Informationsflut und die veränderten Lesegewohnheiten ergeben.
Das zweite Kapitel widmet sich der Klärung des Begriffs „Textdesign“ und stellt diesen den kritischen Auffassungen gegenüber, die ihn als bloße „Verpackung“ für schlechte Inhalte ansehen.
Kapitel drei behandelt die verschiedenen Elemente des Textdesigns, wie Mehrkanaligkeit, Clusterbildung und bedeutungsjournalistische Tendenzen, und erläutert, wie diese die Gestaltung und die Rezeption von Zeitungen beeinflussen.
Kapitel vier analysiert die Ursachen für die Veränderungen in der Zeitungsgestaltung und beleuchtet die Rolle der technologischen Entwicklungen und der veränderten Leserschaft.
Kapitel fünf befasst sich mit den Besonderheiten der Online-Zeitung und untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich aus der digitalen Verbreitung von Informationen ergeben.
Schlüsselwörter
Textdesign, Online-Zeitung, Print-Version, Mehrkanaligkeit, Clusterbildung, selektive Leserschaft, Informationsflut, Medienwandel, journalistische Gestaltung, digitale Medien.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Textdesign bei Zeitungen?
Textdesign ist eine Strategie zur Gestaltung von Informationen durch Bilder, Grafiken und Layouts, um die selektive Lektüre der Leser zu unterstützen.
Verdrängt die Online-Zeitung die gedruckte Version?
Die Arbeit diskutiert, ob die Online-Zeitung eine Gefahr darstellt oder eher als logische Konsequenz und Erweiterung des gedruckten Exemplars zu begreifen ist.
Was kritisieren Gegner des modernen Zeitungsdesigns?
Kritiker wie Wolfgang Koschnick bemängeln, dass der Inhalt zugunsten einer bunten "Verpackung" aus leicht verdaulichen Texten und Bildern reduziert wird.
Was bedeutet "Mehrkanaligkeit" im Kontext der Zeitung?
Es beschreibt die Nutzung verschiedener Informationskanäle wie numerische Grafiken, Erklärgrafiken und Topografiken zur Vermittlung von Inhalten.
Warum müssen sich Zeitungen gestalterisch anpassen?
Da Leser immer weniger Zeit in die Lektüre investieren, hilft ein modernes Design, den Informationsfluss zu kanalisieren und die Aufmerksamkeit zu steuern.
- Arbeit zitieren
- Aileen Enders (Autor:in), 2006, Der Wandel der Zeitung vom linearen Objekt zum hypermedialen Produkt unter Berücksichtigung der Online-Zeitung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78079