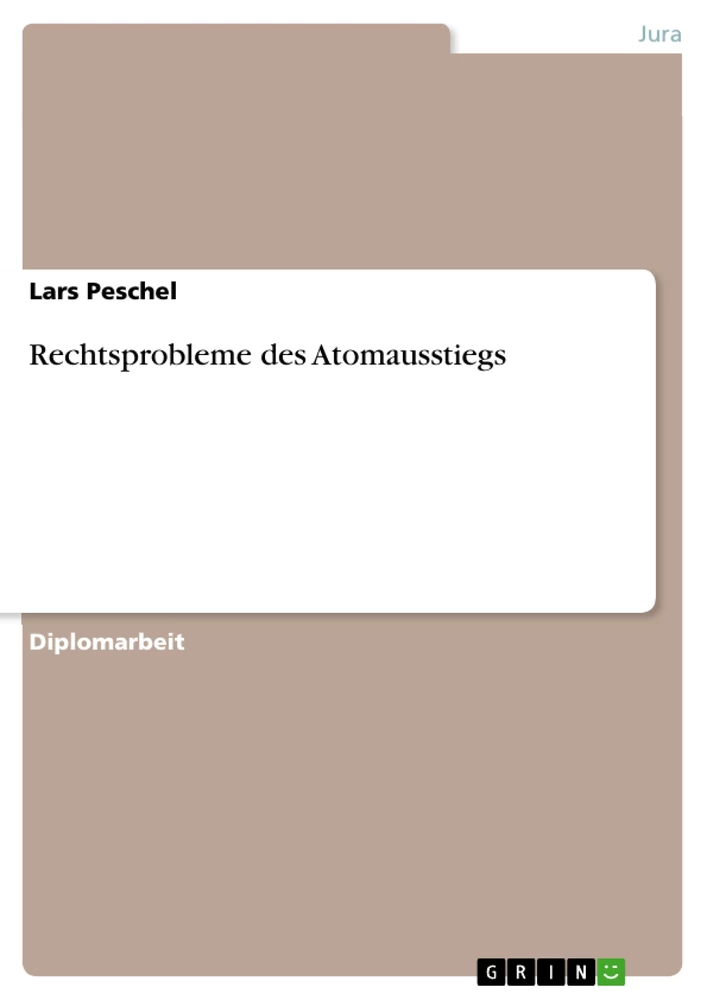Zunächst wurde die Atomenergienutzung durch den Großteil der Politik unterstützt. Da der Staat die flächendeckende Entwicklung der Energieerzeugung durch Atomkraft nicht vollständig selbst finanzieren wollte, regte er eine enge und langfristig angelegte Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft an. Parallel dazu entwickelte sich eine Anti-Atombewegung. Einen entscheidenden Wandel erfuhr die Meinung größerer Bevölkerungsteile nach dem schweren Unfall im amerik. AKW Three Mile Island nahe Harrisburg 1979. Das öffentliche Bewusstsein öffnete sich nun für die Möglichkeiten eines Unfalls in AKWs. Noch einschneidender war schließlich der Reaktorunfall in Tschernobyl 1986, bei dem einer der 4 Kernreaktoren durch eine Explosion zerstört wurde. Damit bekam die strittige Diskussion über die Atomenergie einen neuen Stellenwert in der Gesellschaft, da deutlich wurde, wie groß das Gefährdungspotential dieser Energieform ist u. welche enormen Schadensfolgen möglich sind. Die Befürwortung der Atomenergie sank zunehmend und die Anti-Atombewegung etablierte sich. Mit dem Wechsel zur rot-grünen Bundesregierung 1998 waren die Weichen für einen Ausstieg aus der Atomenergie schließlich gestellt. Erstmals fand sich die kritische und ablehnende Haltung der Bevölkerung auch in der politischen Mehrheit des Bundestages und den Leitlinien der Regierung wieder. Zu dieser Zeit wurden in Deutschland 19 AKWs, die zwischen 1969 und 1989 ans Netz gegangen waren, betrieben. Mittlerweile ist der Atomausstieg beschlossen, das erste AKW 2003 vom Netz gegangen und die rot-grüne Regierung, deren zu Stande kommen sehr wahrscheinlich die einzige politische Möglichkeit für den Beschluss eines Atomausstiegs war, nicht mehr im Amt.
Ziel dieser Arbeit ist es, die juristischen Probleme und Besonderheiten der Atomenergienutzung und des Atomausstiegs zu untersuchen, um die verschiedenen, rechtlich strittigen Fragen im Zusammenhang mit dem Atomausstieg zu klären. In wie weit ist die Beendigung der Atomenergienutzung durch eine Vereinbarung der Bundesregierung mit den Energieversorgungsunternehmen und per Gesetz möglich? Welche Inhalte muss ein solches Gesetz haben, wo liegen seine Grenzen? Kann der Ausstieg so geregelt werden, dass er unumkehrbar ist? Der Ausstieg muss mit der Verfassung vereinbar sein. Er darf insbesondere nicht gegen die Prinzipien des Rechtsstaats oder einzelne Grundrechte verstoßen. Darüber hinaus muss er auch mit dem Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union in Einklang stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Zukunftstechnologie zum Auslaufmodell
- Aufgabenstellung und Vorgehensweise
- Die Nutzung der Atomenergie und die freiheitliche Rechtsordnung
- Atomkraft, Sicherungsmaßnahmen und Grundgesetz
- Die Gefahr der Verfassungsentscheidung für die Nutzung der Atomenergie zu friedlichen Zwecken
- Mögliche Rechtsveränderungen für die Mitarbeiter in AKWs
- Auswirkungen des Sicherungssystems auf die Rechte Dritter
- Ergebnis und Bedeutung
- Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen
- Erste Schritte der Rot-Grünen Bundesregierung zum Atomausstieg
- Inhalt der Vereinbarung
- Rechtsnatur, Rechtsgrundlage und Rechtsfolgen der Vereinbarung
- Rechtsprobleme der Vereinbarung
- Bindung des Initiativrechts der Bundesregierung
- Die Vereinbarung und die Bindungswirkung auf den Bundestag
- Grundrechtsverzicht der Energieversorgungsunternehmen
- Von der Vereinbarung zum Gesetz
- Verfassungsrechtliche Probleme des Atomausstiegs
- Grundsätzliche Zulässigkeit eines Gesetzes zur Beendigung der Atomenergienutzung
- Rechtliche Verpflichtung zur Nutzung der Atomenergie?
- Rückwirkungsverbot des AtG
- Das AtG und die Grundrechte
- Grundrechtsfähigkeit der Betreiber von AKWs
- Willkürverbot des Gesetzgebers
- Schutzbereich der Berufsfreiheit
- Schutzbereich des Eigentums
- Das AtG als verfassungsrechtlich zulässiges Gesetz zum Atomausstieg
- Das AtG als unzulässiges Einzelfallgesetz?
- Das AtG und die horizontale Gewaltenteilung
- Das AtG und die vertikale Gewaltenteilung
- Verletzung der Rechtsschutzgarantie durch das AtG?
- Ergebnis
- Europarechtliche Probleme des Atomausstiegs
- Vereinbarkeit mit dem EURATOM-Vertrag
- Vereinbarkeit mit dem EG-Vertrag
- Das Wiederaufarbeitungsverbot
- Fazit und Ausblick
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Umkehrbarkeit des Atomausstiegs und politischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den juristischen Problemen der Atomenergienutzung und des Atomausstiegs in Deutschland. Ziel ist es, die rechtlichen Streitpunkte im Zusammenhang mit dem Atomausstieg zu untersuchen und zu klären, inwieweit die Beendigung der Atomenergienutzung durch eine Vereinbarung der Bundesregierung mit den Energieversorgungsunternehmen (EVU) und per Gesetz möglich ist. Darüber hinaus werden die Inhalte und Grenzen eines solchen Gesetzes sowie die Umkehrbarkeit des Atomausstiegs beleuchtet.
- Grundrechtsverträglichkeit der Nutzung der Atomenergie
- Rechtliche Rahmenbedingungen für den Atomausstieg
- Verfassungsrechtliche Probleme des Atomausstiegs
- Europarechtliche Aspekte des Atomausstiegs
- Umkehrbarkeit und politische Perspektive des Atomausstiegs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die rechtlichen Aspekte der Atomenergienutzung und des Atomausstiegs in Deutschland. Kapitel 2 analysiert die grundsätzliche Grundrechtsverträglichkeit der Nutzung der Atomenergie und beleuchtet die potenziellen Auswirkungen auf die Grundrechte von Bürgern und Betroffenen. Kapitel 3 fokussiert auf die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen als ersten Schritt zum Atomausstieg. Kapitel 4 befasst sich mit den verfassungsrechtlichen Problemen des Atomausstiegs und analysiert die Vereinbarkeit mit den Prinzipien des Rechtsstaats und der Grundrechte. Kapitel 5 befasst sich mit den europarechtlichen Aspekten des Atomausstiegs und untersucht die Vereinbarkeit mit dem EURATOM-Vertrag und dem EG-Vertrag.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen und Themenfeldern der Atomenergienutzung und des Atomausstiegs in Deutschland. Hierzu zählen die Grundrechte, das Verfassungsrecht, das Europarecht, die Rechtsnatur und die Bindungswirkung von Vereinbarungen, das Initiativrecht der Bundesregierung, die Gewaltenteilung, die Rechtsschutzgarantie, das AtG (Atomgesetz), der EURATOM-Vertrag, der EG-Vertrag, die Wiederaufbereitung von Atommüll, sowie die Umkehrbarkeit und die politische Perspektive des Atomausstiegs.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Atomausstieg in Deutschland verfassungsrechtlich zulässig?
Ja, der Gesetzgeber hat das Recht, die Nutzung der Atomenergie aus Gründen der staatlichen Schutzpflicht für Leben und Gesundheit zu beenden, sofern dies verhältnismäßig geschieht.
Welche Rolle spielt das Eigentumsrecht der AKW-Betreiber?
Die Betreiber können sich auf das Grundrecht am Eigentum berufen. Ein Ausstieg muss daher Übergangsfristen oder Entschädigungsregelungen vorsehen, um verfassungskonform zu sein.
Was war der Kern der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und EVU?
Die Vereinbarung von 2000 regelte die Reststrommengen für jedes Kraftwerk und legte fest, dass keine neuen AKWs mehr gebaut werden dürfen.
Steht der Atomausstieg im Einklang mit EU-Recht?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit mit dem EURATOM-Vertrag. Da die Energiepolitik weitgehend nationale Kompetenz ist, ist ein Ausstieg grundsätzlich mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar.
Kann ein Atomausstieg unumkehrbar geregelt werden?
Rein rechtlich kann ein späterer Bundestag Gesetze wieder ändern. Eine politische und vertragliche Bindung erschwert jedoch eine einfache Rückkehr zur Atomkraft.
- Quote paper
- Lars Peschel (Author), 2007, Rechtsprobleme des Atomausstiegs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78114