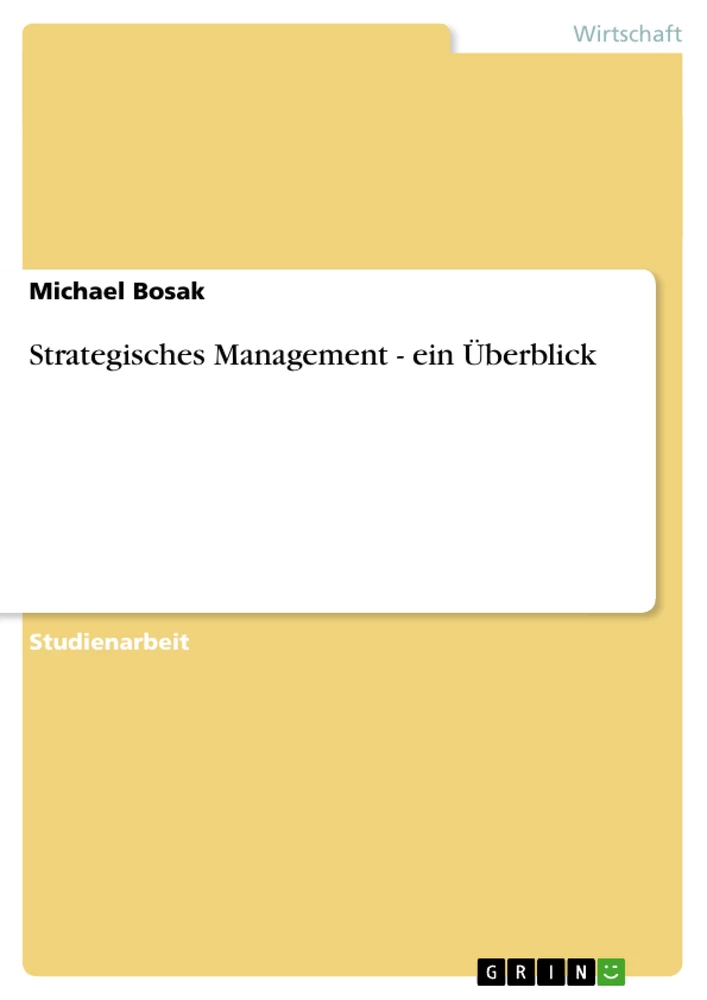Ein kürzlich erschienener Bericht der Financial Times mit dem Titel „Mit Courage das Chaos meistern“ handelt von innerbetrieblichen Führungsschwierigkeiten. Diese sollen auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein.
- übereilte Modernisierungen der Unternehmensstruktur im Zuge der globalisierten Märkte.
- Mitarbeiter seien oft orientierungslos da der Geschäftsbetrieb mehr und mehr in Projekten ohne einheitliche Hierarchien umgewandelt werde. Auch „weil Führungskräfte unangenehme Entscheidungen vom Tisch haben wollen“. Dabei wird der durch die befristete Projektform entstehende Wandel von Mitarbeitern als Bedrohung wahrgenommen.
- Die Stabilität sei zudem durch das Entfernen des mittleren Managements, „das Bindeglied zwischen oben und unten“, gefährdet. Denn Top Manager würden heutzutage wie Politiker reden und obendrein noch ihre Vorbildfunktion verlieren.
Die Frage nach dem „richtigen“ Management scheint zwischen zahlreichen Bemühungen, den Anforderungen der modernen Märkte gerecht zu werden, aktueller zu sein denn je. Gleichzeitig jedoch soll die Rückbesinnung auf altmodische Tugenden, um die Loyalität und das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen, nach Meinung verschiedener Experten der Ausweg aus dem Führungschaos sein.
Weiterhin findet sich vor allem seit den 90er Jahren in der Literatur eine unüberschaubare Fülle an Modellen des strategischen Managements. Jedoch sollen die Möglichkeiten, die komplexen Probleme der Steuerung-, Lenkung- und der Gestaltung des Managements zu entwirren, sehr gering sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Motivation der Studienarbeit
- 1.2. Ziel der Studienarbeit
- 1.3. Methodisches Vorgehen
- 2. Begriffsherleitungen und -definitionen
- 2.1.1. Etymologische Herleitung des Begriffs „Strategisches Management“
- 2.1.2. Strategie
- 2.1.2. Management
- 3. Historische Entwicklung des strategischen Managements
- 3.1. Frühe Strategen
- 3.2. Strategie innerhalb der Wirtschaftswissenschaften
- 4. Phasen des strategischen Denkens
- 4.1. Finanzplanung
- 4.2. Langfristplanung
- 4.3. Strategische Planung
- 4.3.1. Zielbildung und Zielhierarchie
- 4.3.2. Unternehmensumweltanalyse und Unternehmensanalyse
- 4.3.3. Strategiewahl und Strategieverwirklichung
- 5. Strategisches Management
- 5.1. Aufgabenspektrum des strategischen Managements
- 5.2. Entscheidungen innerhalb des strategischen Managements
- 5.2.1. Phasen im strategischen Prozess
- 5.3. Ebenen des strategischen Managements
- 5.3.1. Strategisches Management auf der Geschäftsfeldebene
- 5.3.2. Strategisches Management auf der Unternehmensebene
- 6. Zusammenfassung und aktuelle Tendenzen des strategischen Managements
- 6.2. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit den Anfängen und der Entwicklung des strategischen Managements. Ziel ist es, die verschiedenen Phasen der Managementlehre aufzuzeigen und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der strategischen Führung zu ermöglichen.
- Etymologische Herleitung des Begriffs „Strategisches Management“
- Historische Entwicklung des strategischen Managements
- Phasen des strategischen Denkens
- Aufgabenspektrum des strategischen Managements
- Ebenen des strategischen Managements
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und erläutert die Motivation, das Ziel und die Methodik. Kapitel 2 geht auf die begriffliche Herleitung des strategischen Managements ein, indem es die etymologische Herkunft des Begriffs „Strategisches Management“ sowie die Definitionen von „Strategie“ und „Management“ beleuchtet. In Kapitel 3 wird die historische Entwicklung des strategischen Managements dargestellt, wobei sowohl die Rolle früher Strategen als auch die Bedeutung des strategischen Denkens in den Wirtschaftswissenschaften betrachtet werden.
Kapitel 4 behandelt die Phasen des strategischen Denkens. Es werden die Entwicklungen von der Finanzplanung über die Langfristplanung bis hin zur strategischen Planung mit ihren drei zentralen Aspekten - Zielbildung und Zielhierarchie, Unternehmensumweltanalyse und Unternehmensanalyse sowie Strategiewahl und Strategieverwirklichung - erörtert. Kapitel 5 fokussiert sich auf das strategische Management, indem es das Aufgabenspektrum beleuchtet, Entscheidungen innerhalb des strategischen Managements analysiert und die verschiedenen Phasen des strategischen Prozesses sowie die Ebenen des strategischen Managements auf Geschäftsfeldebene und Unternehmensebene beschreibt.
Schlüsselwörter
Die Studienarbeit befasst sich mit den zentralen Themen des strategischen Managements, insbesondere mit den Begriffen „Strategie“ und „Management“, der historischen Entwicklung des strategischen Denkens, den Phasen der strategischen Planung, dem Aufgabenspektrum des strategischen Managements und den verschiedenen Ebenen des strategischen Managements.
- Citation du texte
- Michael Bosak (Auteur), 2007, Strategisches Management - ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78117