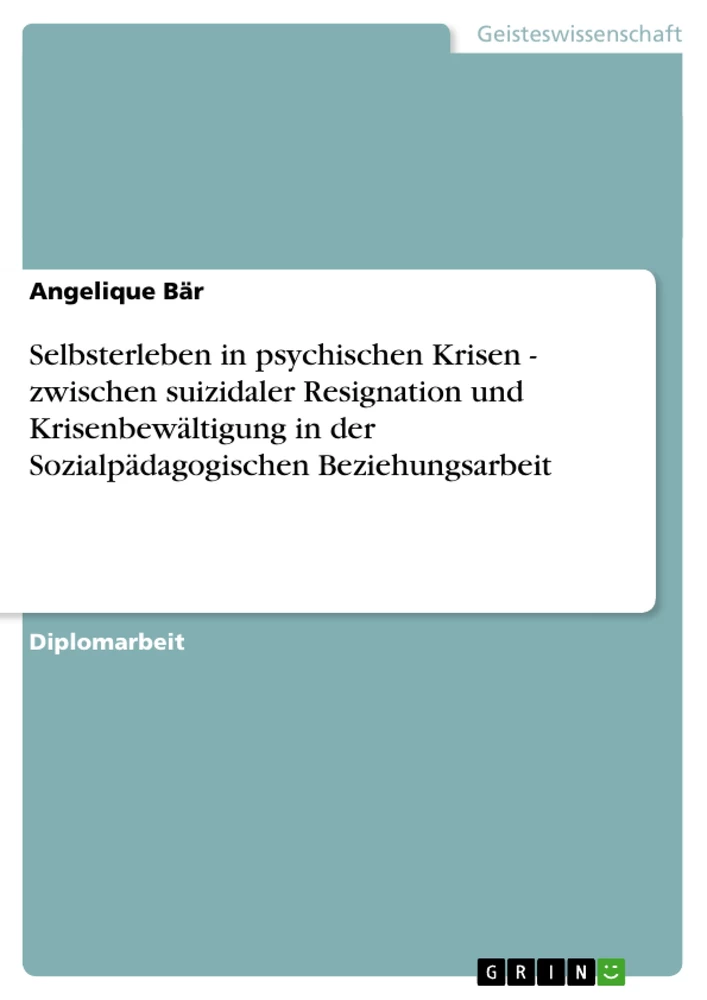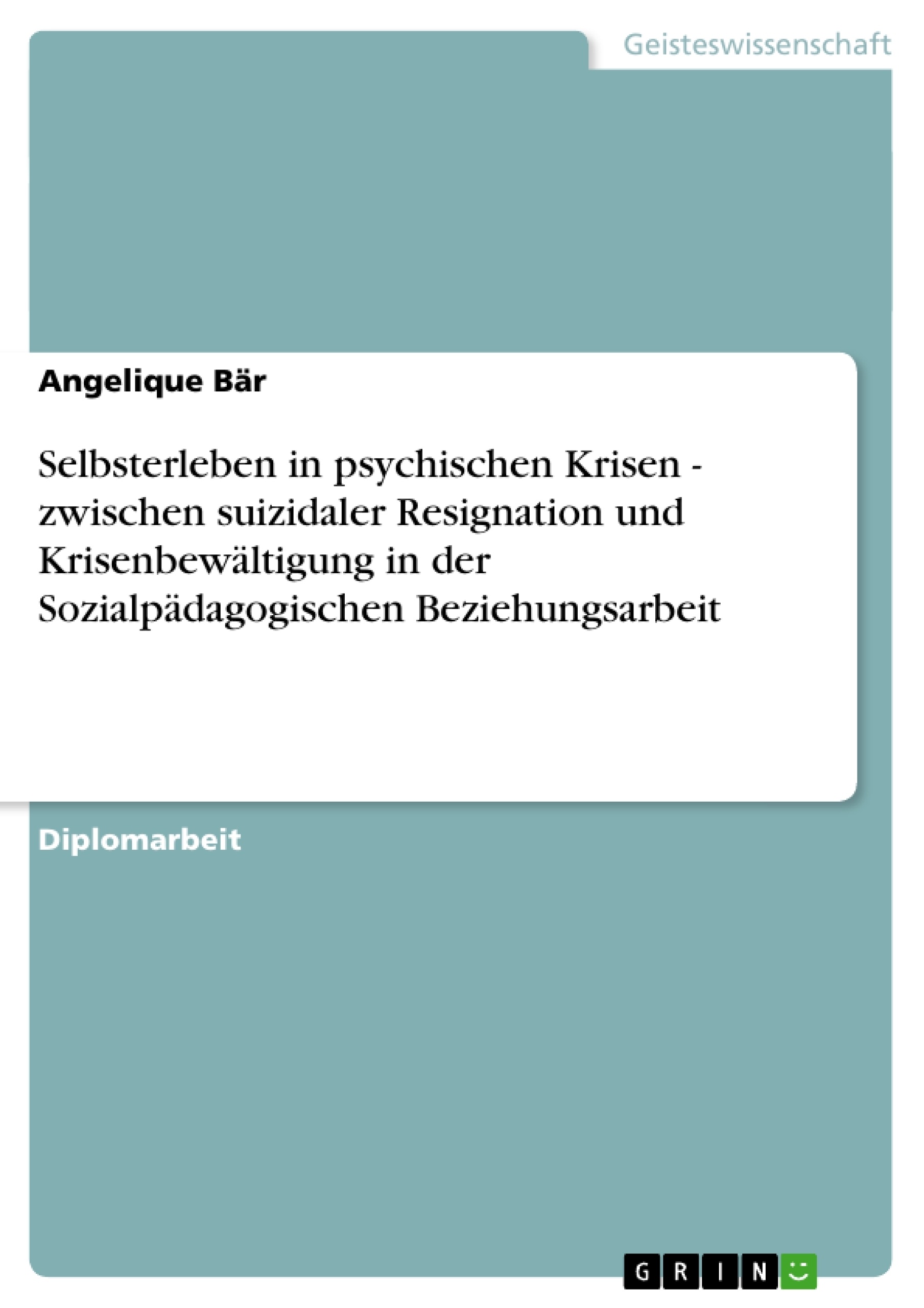Keine Lebenslage oder Situation im menschlichen Leben trägt als einzig unabdingbare Konsequenz den Suizid als Folge in sich . Obgleich - richtet man seinen Blick auf all das Falsche, Negative in der Welt - wir nicht in einer harmonischen, gerechten Welt leben , so ist es doch nicht so, dass sich die Mehrzahl der Menschen aufgrund persönlicher und kollektiver Krisen das Leben nimmt. Wohnt die Tendenz, aufgrund subjektiv erlebter Unerträglichkeit einer Lebenssituation aus dem Leben zu gehen, jedem Menschen inne? Scobel bejaht diese Überlegung.
Man denke nur an Lebensgeschichten verschiedener Menschen, die objektiv durch die „Hölle“ gingen, Grausames erlebt, undenkbar Schreckliches in ihrem Lebenslauf erfahren haben, aber nicht ihren Lebensmut verloren, nicht von einer Ausweglosigkeit ihrer Situation überzeugt waren und „Schluss“ machten. Was sind das für Erlebens – und Verhaltenstendenzen die innerhalb einer Krise auf den Betroffenen wirken? Jeder Mensch macht im Laufe seines Lebens unterschiedliche Krisen durch, sie sind notwendiger Bestandteil des Reifens für den persönlichen Entwicklungsweg als auch den lebenslang andauernden Identitätsprozess.
Man kennt sich aus mit Beschreibungen und „Handlungsanleitungen“ innerhalb einer Krise, oft kann man sich in einem von der Gesellschaft vorgefertigten „Krisentyp“ wiederfinden bzw. zuordnen ( Entwicklungs-, Verlustkrisen; Reifungskrisen; Liebeskummer, Trauer, Niedergeschlagenheit bei Nichteintreten einer gehofften Erwartung etc.), was nicht zuletzt an all den durch die Medien vermittelten gesellschaftstauglichen Vorschlägen im Umgang mit Alltagssorgen liegt. Das Bewusstsein der Allgegenwärtigkeit und Allzumenschlichkeit von Krisensituation hilft sicherlich der Mehrzahl von Menschen in Krisen nicht unterzugehen. Aber gleichzeitig wird ein Muster gezeichnet, ein Muster von „Krisentypen“, Krisenphasen als auch einer Normdauer dieser.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Suizidtheorien in der Psychoanalyse
- Melancholie und Suizidalität nach Freud
- Der Suizid als narzisstische Krise
- Narzissmus – kurze Begriffsklärung
- Das narzisstische Regulationssystem (nach Henseler)
- Suizidalität – letzte Flucht aus dem unerträglichen Leben
- Mögliche psychosoziale Einflussgrößen für Suizidalität in der Kindheit
- Mögliche biografische Sozialisationsbedingungen, die eine Entwicklung späterer suizidaler Verhaltens- und Reaktionsweisen begünstigen können
- Erfahrungen von falscher Liebe in der Kindheit
- Erfahrungen ungünstig-übertriebener Liebe in der Kindheit
- Identitätsbewusstsein und Selbsterleben in der Kindheit
- Selbsterleben in der Zweierbeziehung - der Liebesbeziehung
- Der Partner als Spiegel für die eigene Identität
- Exkurs: Symbiotische Sehnsucht aufgrund ungelöster, frühkindlicher Trennungserfahrungen
- Symbiotische Liebesbeziehungen
- Das schmerzhafte Selbsterleben
- Der Verlust des Selbstwertgefühls aufgrund eines gestörten Dialoges mit der sozialen Welt?
- Das Selbstwertgefühl zwischen Liebesbeziehung und sozialer Werte
- Die Trennung der Liebenden (des geliebten Objekts)
- Trennung als katastrophales Verlusterlebnis narzisstisch labiler Menschen
- Der Tod im Selbst als Folge der Liebestrennung
- Suizidalität als Folge einer Trennung
- Trennung als Auslöser einer suizidalen Trauer
- Suizidale Trauer
- Pathologisierendes Diagnostizieren von suizidalen Erlebniswelten und Suizidhandlungen oder: der von Betroffenen gebrauchte Umgang vs. der praktizierte Umgang mit Suizidalität
- Das Selbsterleben von Suizidenten in der Begegnung mit Anderen
- Anwendbarkeit und Brauchbarkeit von Suizidalitätstheorien in Hinblick auf den ihr innewohnenden Verstehensansatz für suizidale Erlebnisweisen
- Zwischen Diagnostizieren und Verstehen
- Das ,,Beziehungsangebot“ im Rahmen der Krisenintervention bei Menschen in suizidalen Lebenskrisen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, das Selbsterleben von Menschen in psychischen Krisen, insbesondere im Zusammenhang mit Suizidalität, aus einer sozialpädagogischen Perspektive zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die Bedeutung von Beziehungsarbeit und die Herausforderungen bei der Begegnung mit suizidalen Menschen gelegt. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie sich das Selbsterleben in suizidalen Krisen entwickelt und wie es durch die soziale Umgebung und Beziehungserfahrungen geprägt ist.
- Suizidtheorien in der Psychoanalyse, insbesondere die Rolle von Narzissmus und Krisenbewältigung
- Die Bedeutung von frühkindlichen Erfahrungen und Sozialisationsprozessen für die Entwicklung suizidaler Verhaltensweisen
- Das Selbsterleben in Liebesbeziehungen und die Rolle des Partners als Spiegel der eigenen Identität
- Die Auswirkungen von Trennung und Verlust auf das Selbstwertgefühl und die Entstehung von Suizidalität
- Der Umgang mit suizidalen Menschen in der Sozialpädagogik und die Notwendigkeit eines einfühlsamen und verständnisvollen Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Selbsterlebens in suizidalen Krisen ein und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext sozialpädagogischer Beziehungsarbeit. Sie stellt die Notwendigkeit eines verständnisvollen Umgangs mit suizidalen Menschen heraus und unterstreicht die Bedeutung der individuellen Betrachtungsweise. Das erste Kapitel befasst sich mit verschiedenen Suizidtheorien innerhalb der Psychoanalyse. Es beleuchtet insbesondere die Rolle von Narzissmus und Krisenbewältigung sowie die Bedeutung frühkindlicher Prägungen. Das zweite Kapitel untersucht mögliche psychosoziale Einflussfaktoren und biografische Sozialisationsbedingungen, die die Entwicklung suizidaler Verhaltensweisen begünstigen können. Hier werden insbesondere die Themen „falsche“ und „übertriebene“ Liebe in der Kindheit sowie die Herausforderungen im Umgang mit Trennungen und Verlusten betrachtet. Das dritte Kapitel widmet sich dem Selbsterleben in Zweierbeziehungen und der Rolle des Partners als Spiegel der eigenen Identität. Es thematisiert die Symbiotische Sehnsucht aufgrund ungelöster Trennungserfahrungen und die Auswirkungen von symbiotischen Liebesbeziehungen. Das vierte Kapitel analysiert das schmerzhafte Selbsterleben in Krisensituationen und die damit verbundenen Herausforderungen für das Selbstwertgefühl. Das fünfte Kapitel behandelt die Trennung von Liebespartnern als ein katastrophales Verlusterlebnis und die damit verbundenen Auswirkungen auf narzisstisch labile Menschen. Das sechste Kapitel erörtert die Rolle von Trennung als Auslöser für suizidale Trauer und die spezifischen Herausforderungen, die mit dieser Form von Trauer einhergehen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit umfassen: Selbsterleben, Suizidalität, psychische Krisen, sozialpädagogische Beziehungsarbeit, Narzissmus, Krisenbewältigung, frühkindliche Erfahrungen, Sozialisation, Liebesbeziehungen, Trennung, Verlust, Selbstwertgefühl, Trauer, Umgang mit Suizidenten, Diagnostizieren, Verstehen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen Themen und versucht, ein tieferes Verständnis für die individuellen Erfahrungen von Menschen in suizidalen Krisen zu entwickeln. Die sozialpädagogische Perspektive steht dabei im Vordergrund und fokussiert auf die Notwendigkeit eines einfühlsamen und verständnisvollen Ansatzes im Umgang mit suizidalen Menschen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Suizidalität in der Psychoanalyse erklärt?
Theorien wie die von Freud (Melancholie) oder Henseler (narzisstische Krise) sehen Suizidalität oft als Folge einer unerträglichen psychischen Spannung oder eines Zusammenbruchs des Selbstwertgefühls.
Welche Rolle spielen Kindheitserfahrungen bei Suizidgefahr?
Erfahrungen von falscher oder übertriebener Liebe sowie instabile Identitätsentwicklung in der Kindheit können die Anfälligkeit für spätere suizidale Krisen erhöhen.
Warum ist Trennung oft ein Auslöser für Suizidalität?
Für narzisstisch labile Menschen kann der Verlust des Partners als katastrophaler Verlust der eigenen Identität erlebt werden ("Tod im Selbst").
Was bedeutet "Beziehungsangebot" in der Krisenintervention?
In der sozialpädagogischen Arbeit ist das aktive Angebot einer stabilen, verstehenden Beziehung entscheidend, um Betroffenen aus der suizidalen Resignation zu helfen.
Was ist der Unterschied zwischen Diagnostizieren und Verstehen?
Während das Diagnostizieren oft pathologisiert, zielt das Verstehen darauf ab, die subjektive Erlebniswelt des Suizidenten und seine Notlage ernst zu nehmen.
- Quote paper
- Angelique Bär (Author), 2007, Selbsterleben in psychischen Krisen - zwischen suizidaler Resignation und Krisenbewältigung in der Sozialpädagogischen Beziehungsarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78158