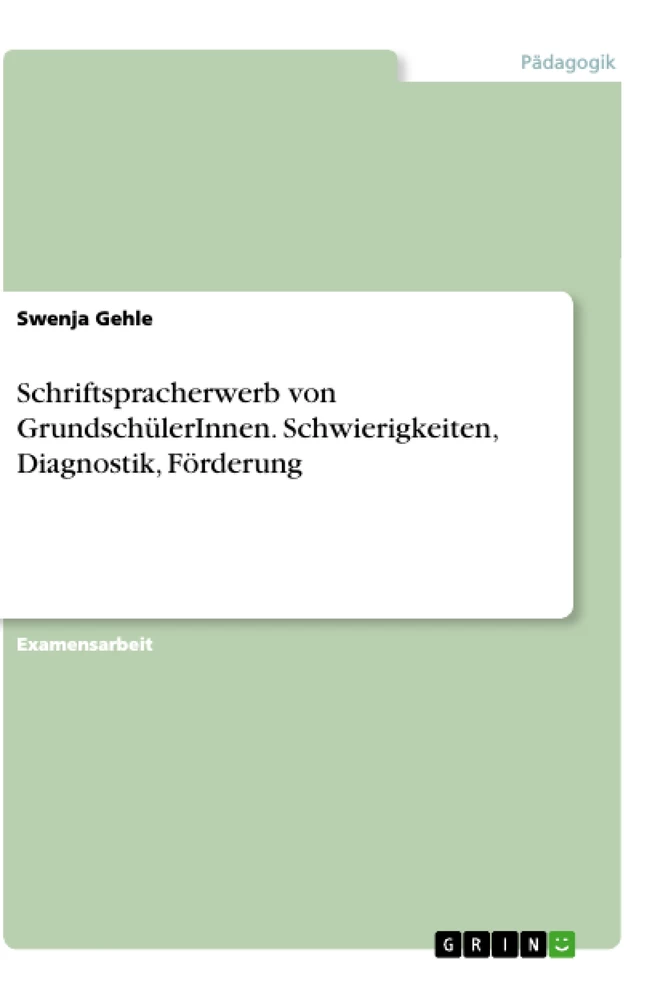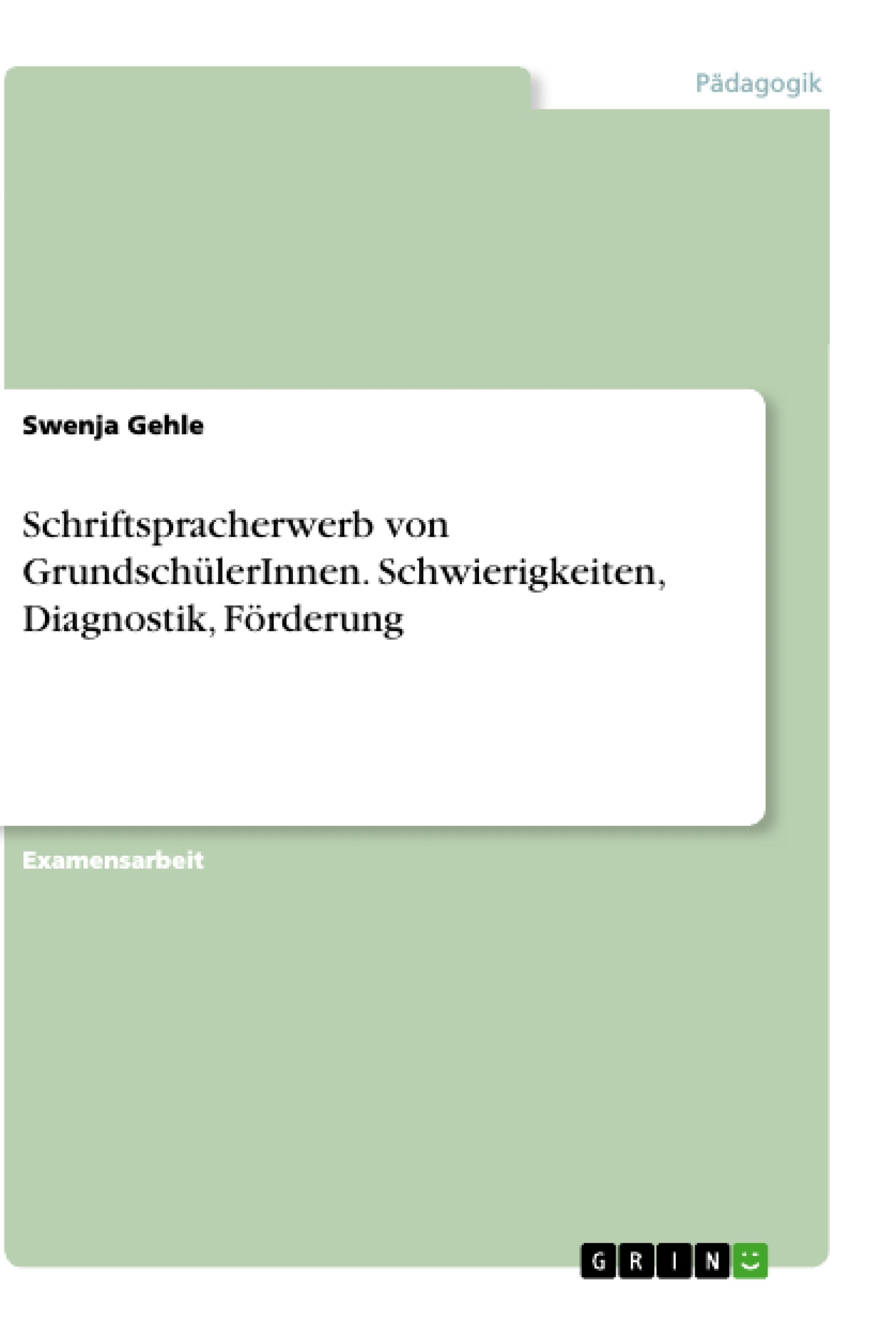Welche Bedeutung haben das Schreiben und auch das Lesen für unsere heutige Gesellschaft? Die hessische Kultusministerin Karin Wolff nimmt dazu folgendermaßen Stellung: „Wer nicht genug lesen und schreiben kann, wird nicht nur im Schulfach Deutsch, sondern in allen anderen Fächern Probleme bekommen. In unserer so genannten Kommunikations- und Wissensgesellschaft ist das Grundvoraussetzung eines erfolgreichen Lebens nach der Schule“1. Denkt man an die eigene Schulzeit zurück, so lässt sich nur allzu leicht bestätigen, dass in fast allen Fächern Lese- und Schreibkompetenzen gefordert werden.
In meiner Examensarbeit befasse ich mich mit dem Thema „Schriftspracherwerb von GrundschülerInnen: Schwierigkeiten – Diagnostik – Förderung“. Es geht demnach vor allem darum, wie die Kinder zur Schrift gelangen, aber auch welche Schwierigkeiten dabei auftreten können und wie man die Kinder trotzdem auffangen und auf ihrem Weg zum erfolgreichen Schreiben und auch Lesen begleiten kann.
Zunächst soll dabei ein Blick auf verschiedene Entwicklungsmodelle zum Schriftspracherwerb geworfen werden. Ein erster Einblick in diese Modelle macht deutlich, dass beim Schreiblernprozess auch der Leselernprozess eine Rolle spielt. Deshalb soll in den ausgewählten Stufenmodellen auch dieser Kompetenzbereich beleuchtet werden.
Hinreichend bekannt ist, dass nicht wenige SchülerInnen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Somit werde ich mich in einem Kapitel der Frage widmen, woran man diese erkennen kann, aber auch auf welche Ursachen sich diese möglicherweise zurückführen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretische Grundpositionen zum Schriftspracherwerb
- Schriftsprache
- Phonem
- Graphem
- Morphem
- Modelle des Schriftspracherwerbs
- Renate Valtin: Das Stufenmodell der Schreibentwicklung
- Entwicklungsmodell zum Lesen
- Uta Frith: Das Sechs-Stufenmodell
- Klaus B. Günther: Ergänzungen zum Sechs-Stufenmodell
- Hans Brügelmann: ein Entwicklungsmodell mit vier „Stufen“
- Handschrift
- Rechtschreibung
- Lesen
- Zusammenfassung
- Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
- Legasthenie oder Lese-Rechtschreibschwäche?
- Merkmale von Schwierigkeiten im Lese- und Rechtschreibprozess
- Ursachen und Risikofaktoren
- Visuelle und auditive Wahrnehmung
- Sprache
- Strategiedefizite
- Soziale Faktoren
- Zusammenfassung
- Verfahren zur Diagnose von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
- Rundgang durch Hörhausen
- OLFA - Oldenburger Fehleranalyse
- Diagnostische Bilderlisten
- Zusammenfassung
- Durchführung und Auswertung der diagnostischen Bilderlisten
- Vorbemerkungen
- Durchführung
- Auswertung
- allgemeine Auffälligkeiten
- Häufigkeit und Art der Fehler
- Auswertung ausgewählter Arbeitsblätter
- Fazit
- Schulische Fördermaßnahmen
- Förderung der phonologischen Bewusstheit
- Förderung bei bestimmten Fehlerarten
- Förderung eigener Schreibversuche
- lernstrategische Hilfsmittel
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Schriftspracherwerb von GrundschülerInnen und beleuchtet die damit verbundenen Schwierigkeiten, die Diagnostik dieser Schwierigkeiten sowie die Förderungsmöglichkeiten. Dabei werden verschiedene Modelle des Schriftspracherwerbs vorgestellt und die Bedeutung des Lese- und Schreiblernprozesses hervorgehoben.
- Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs
- Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb (z.B. Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche)
- Diagnostik von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
- Schulische Fördermaßnahmen
- Zusammenhang zwischen Schriftspracherwerb und Leseentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition grundlegender Begriffe wie Schriftsprache, Phonem, Graphem und Morphem. Anschließend werden verschiedene Modelle des Schriftspracherwerbs vorgestellt, darunter das Stufenmodell von Renate Valtin, das Sechs-Stufenmodell von Uta Frith und das Entwicklungsmodell von Hans Brügelmann.
Das nächste Kapitel behandelt Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. Es wird auf Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche eingegangen, die Merkmale dieser Schwierigkeiten werden beschrieben und mögliche Ursachen und Risikofaktoren analysiert.
Im folgenden Kapitel werden verschiedene Verfahren zur Diagnose von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb vorgestellt, wie z.B. "Rundgang durch Hörhausen" und "OLFA - Oldenburger Fehleranalyse". Des Weiteren werden diagnostische Bilderlisten vorgestellt und eine Auswertung durchgeführt, die einen Rückbezug zu den vorherigen Kapiteln herstellt.
Das letzte Kapitel befasst sich mit schulischen Fördermaßnahmen, die bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb helfen können. Es werden verschiedene Ansätze zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, der Bewältigung spezifischer Fehlerarten und zur Unterstützung eigener Schreibversuche vorgestellt.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie, Diagnostik, Förderung, phonologische Bewusstheit, Entwicklungsmodelle, Stufenmodell, Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb, schulische Fördermaßnahmen.
- Citar trabajo
- Swenja Gehle (Autor), 2006, Schriftspracherwerb von GrundschülerInnen. Schwierigkeiten, Diagnostik, Förderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78313