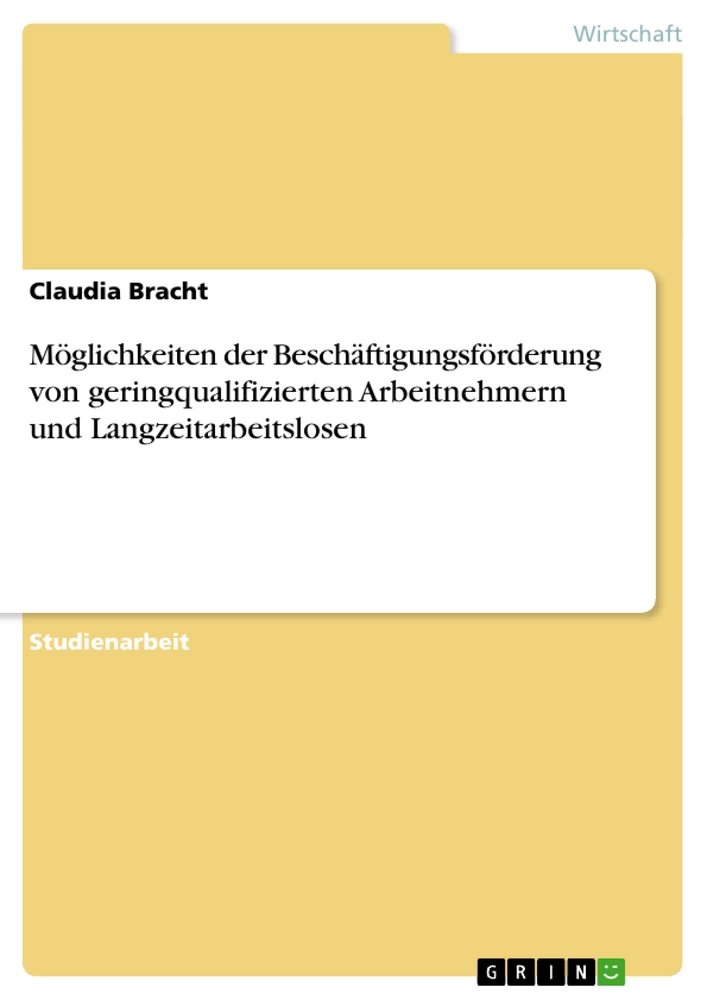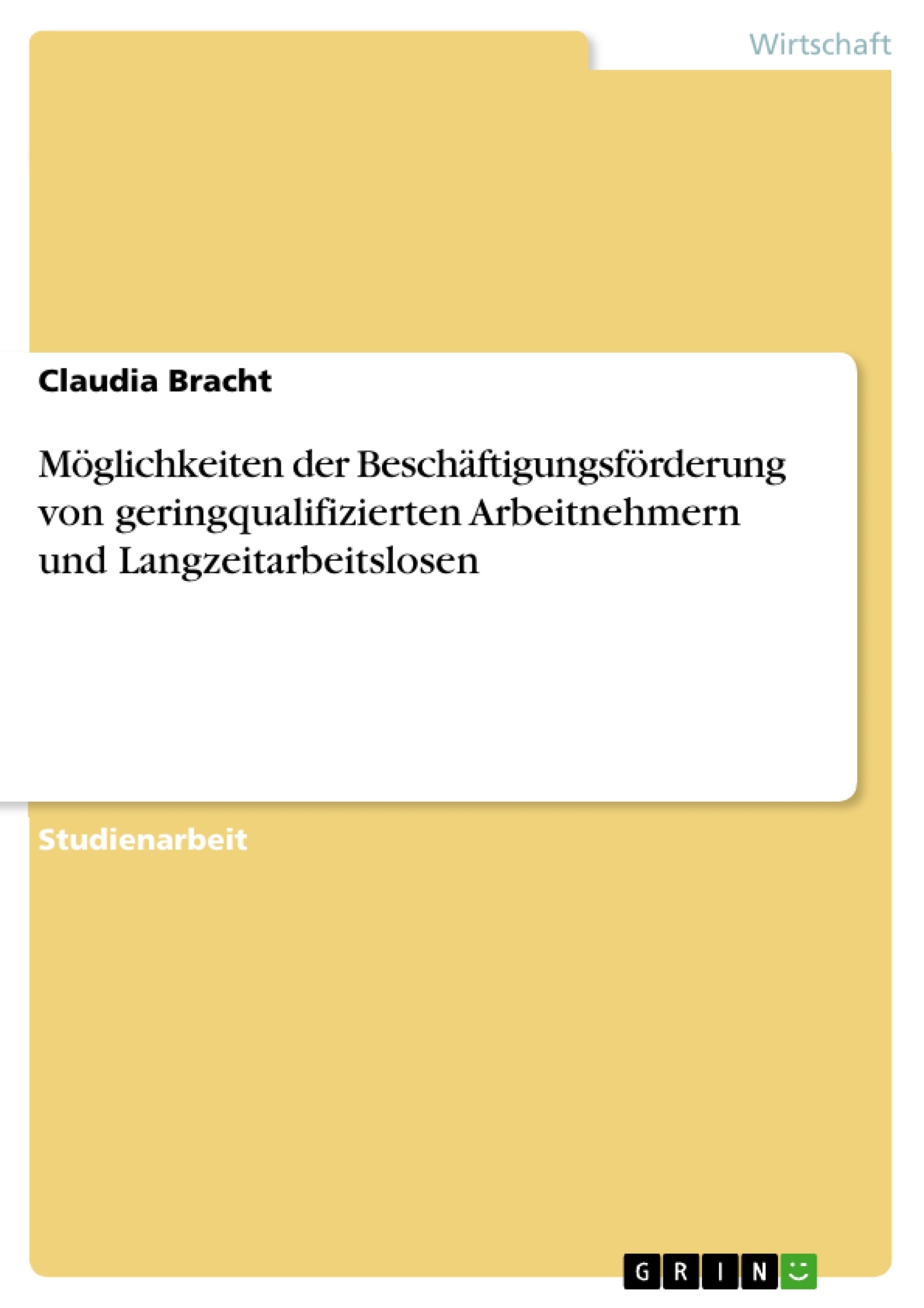Das vielleicht meist diskutierte politische und gesellschaftliche Problem in Deutschland, ist die seit 25 Jahren ansteigende Massenarbeitslosigkeit. Dabei ist gerade die Zahl der Beschäftigungsmöglichkeiten für geringqualifizierte Arbeitnehmer drastisch gesunken. Von den heute rund 4 Millionen Arbeitslosen besteht nach Angaben des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) ca. die Hälfte aus Langzeitarbeitslosen und „schwer Vermittelbaren“. Darunter fallen hauptsächlich gering qualifizierte, alleinerziehende und ältere Menschen. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, werden seit einiger Zeit verschiedene Modelle von Niedriglohnsubvention diskutiert. Die Idee ist, durch eine „negative Einkommensteuer“ die Löhne im Niedriglohnsektor zu subventionieren und somit Beschäftigungsanreize und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Bundesregierung hat sich, dieses Thema betreffend, erst Anfang diesen Jahres auf die bundesweite Einführung des Mainzer Modells verständigt.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, verschiedenen Modelle der Beschäftigungsförderung für die betrachtete ‚Problemgruppe’, ihre notwendigen Rahmenbedingungen sowie die durch sie erzielten Erfolge vorzustellen. Die zentrale Frage ist, ob die vorgestellten Modelle im Allgemeinen und die deutschen Modelle im Besonderen ein erfolgversprechendes Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei geringqualifizierten Arbeitnehmern und Langzeitarbeitslosen in Deutschland sind.
Dazu soll zunächst eine theoretische Erläuterung der Einkommenstransfers erfolgen. Anschließend werden die Ursachen der Arbeitslosigkeit von geringqualifizierten Arbeitnehmern und Langzeitarbeitslosen in Deutschland betrachtet und Chancen neuer Beschäftigungsmöglichkeiten analysiert. Im Folgenden wird auf die in der Praxis erprobten deutschen Modelle eingegangen. Zum einen auf die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerzuschüsse im Rahmen der Hilfe zur Arbeit (§ 18 BSHG) und zum anderen auf die Durchführung zweier Modelle die im Rahmen des Sonderprogramms „Chancen und Anreize zur Aufnahme sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten“ durchgeführt wurden. Das Mainzer-Modell und das SGI Modell der Saar Gemeinschaftsinitiative. Als theoretischer Alternativvorschlag soll der Ansatz von Prof. Dr. Fritz Scharpf betrachtet werden Um die Effizienz der deutschen Modelle besser beurteilen zu können, folgt daran anschließend noch ein Ländervergleich mit Dänemark und den USA.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Erläuterungen
- Sozialhilfefalle
- Negative Einkommenssteuer
- Lohnsubventionen
- Ursachen der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungspotentiale
- AG- und AN-Zuschüsse im Rahmen der Hilfe zur Arbeit
- Niedriglohnbeschäftigung nach Prof. Dr. Fritz Scharpf
- CAST
- Mainzer Modell
- SGI Modell
- Ländervergleich
- USA
- Dänemark
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Modellen der Beschäftigungsförderung für geringqualifizierte Arbeitnehmer und Langzeitarbeitslose. Ziel ist es, die Funktionsweise dieser Modelle, ihre Rahmenbedingungen und ihre Erfolge zu beleuchten. Die zentrale Fragestellung lautet, ob die vorgestellten Modelle, insbesondere die deutschen, ein erfolgversprechendes Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in dieser Zielgruppe darstellen.
- Theoretische Erläuterung von Lohnsubventionen, negativer Einkommenssteuer und der Sozialhilfefalle
- Analyse der Ursachen der Arbeitslosigkeit von geringqualifizierten Arbeitnehmern und Langzeitarbeitslosen in Deutschland
- Vorstellung und Bewertung von deutschen Modellen der Beschäftigungsförderung, wie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerzuschüsse im Rahmen der Hilfe zur Arbeit sowie das Mainzer Modell und das SGI Modell
- Einbezug des Ansatzes von Prof. Dr. Fritz Scharpf als theoretisches Alternativmodell
- Ländervergleich mit Dänemark und den USA, um die Effizienz der deutschen Modelle zu beurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland dar und hebt die Bedeutung der Beschäftigungsförderung für geringqualifizierte Arbeitnehmer und Langzeitarbeitslose hervor. Anschließend werden in Kapitel 2 die Begriffe Lohnsubvention, negative Einkommenssteuer und Sozialhilfefalle definiert und erläutert. Kapitel 3 analysiert die Ursachen der Arbeitslosigkeit in der betrachteten Zielgruppe, während Kapitel 4 die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerzuschüsse im Rahmen der Hilfe zur Arbeit detailliert behandelt. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Niedriglohnbeschäftigung nach Prof. Dr. Fritz Scharpf, während Kapitel 6 die CAST-Modelle, das Mainzer Modell und das SGI Modell, vorstellt. Kapitel 7 bietet einen Ländervergleich mit Dänemark und den USA, um die Effizienz der deutschen Modelle zu beurteilen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsförderung, geringqualifizierte Arbeitnehmer, Langzeitarbeitslose, Niedriglohnsubventionen, negative Einkommenssteuer, Sozialhilfefalle, Hilfe zur Arbeit, Mainzer Modell, SGI Modell, CAST, Prof. Dr. Fritz Scharpf, Ländervergleich, Dänemark, USA.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Mainzer Modell?
Das Mainzer Modell war ein deutsches Projekt zur Lohnsubventionierung, das durch Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen Anreize für Niedriglohnbeschäftigung schaffen sollte.
Was versteht man unter der "Sozialhilfefalle"?
Sie beschreibt die Situation, in der die Aufnahme einer Arbeit finanziell kaum attraktiver ist als der Bezug von Sozialleistungen, da das Einkommen auf die Hilfe angerechnet wird.
Was ist eine "negative Einkommensteuer"?
Ein theoretisches Modell, bei dem Menschen mit sehr geringem Einkommen keine Steuern zahlen, sondern stattdessen staatliche Transferzahlungen erhalten.
Wer gehört zur Zielgruppe der Beschäftigungsförderung?
Die Modelle richten sich primär an Geringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und ältere Arbeitssuchende.
Wie unterscheiden sich die Modelle in Dänemark und den USA?
Die Arbeit vergleicht die dänische "Flexicurity" und das US-amerikanische System der Steuergutschriften (EITC) mit den deutschen Ansätzen.
Was schlägt Prof. Dr. Fritz Scharpf vor?
Scharpf plädiert für eine gezielte Subventionierung von Dienstleistungsarbeit im Niedriglohnsektor, um neue Arbeitsplätze für Geringqualifizierte zu generieren.
- Arbeit zitieren
- Claudia Bracht (Autor:in), 2002, Möglichkeiten der Beschäftigungsförderung von geringqualifizierten Arbeitnehmern und Langzeitarbeitslosen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7833