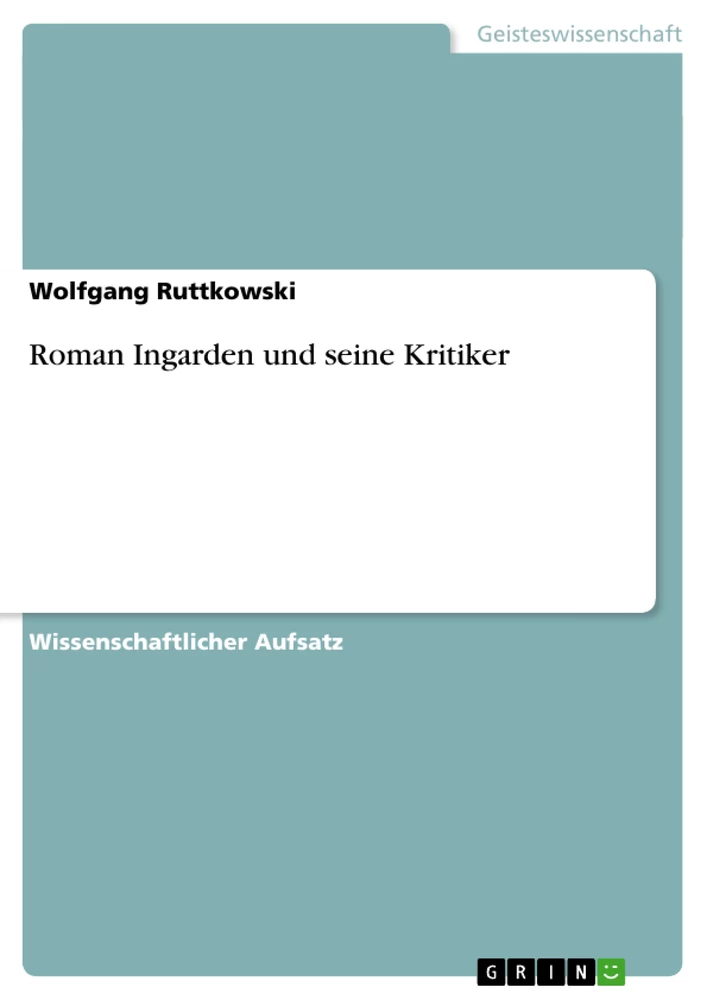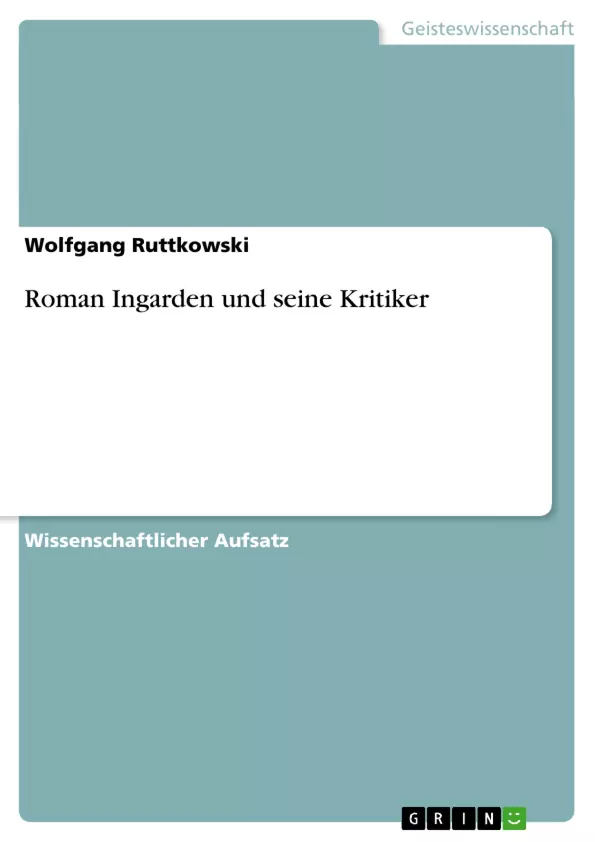Roman Ingarden (1893-1970) gilt unter Ästhetikern als der bedeutendste Literaturtheoretiker des letzten Jahrhunderts, ist jedoch bei Germanisten fast nur als Name bekannt. Wer sich mit seinem Schichtenmodell für Literatur auseinandersetzen will, muss dieses mit dem Nicolai Hartmanns (1882-1950) vergleichen. Dieses ist dem Ingardens an ontologischer Durchdachtheit überlegen, an Detail-Reichtum jedoch unterlegen.
Wie fast alle originellen Entwürfe ist auch Ingardens Literaturmodell in entscheidenden Punkten kritisiert worden (u.a. von Käte Hamburger, Detlef Leistner, Stefan Morawski, Hans Joachim Pieper und René Wellek, von der marxistischen Literaturkritik ebenso wie von der sprachanalytischen Schule). Von den Angriffen kann man viel über Wesen und Wirkungsweise von Literatur lernen. Sie stehen in Zusammenhang mit Ingardens “Anti-Psychologismus”, seiner Unterscheidungsweise von Kunstgegenstand und ästhetischem Gegenstand, seiner Behandlung des Wertproblems von Kunst (besonders seiner relativ konservativen Auffassung von der Objektivität ästhetischer Werte, die zu seiner Theorie der ästhetischen Erfahrung in Widerspruch steht), seiner Beschreibung einer tragenden “Schicht der Wertlaute” und noch mehr einer “Schicht der schematisierten Ansichten” im Sprachkunstwerk, seinem Schichtenbegriff überhaupt sowie seiner gelegentlichen Ungenauigkeit in der Anwendung seiner Terminologie.
(Zuerst als Vortrag vor dem Jap. Germanistenverband, Hokkaido Daigaku, 21.9.1995)
Inhaltsverzeichnis
- Ingardens Einschätzung durch und Einfluss auf andere Kritiker
- Gründe für die Unbekanntheit Ingardens bei den Germanisten
- Der Schichtenbegriff und die Schichtung des Kunstwerks bei Ingarden und Hartmann:
- Verschiedene Auffassungen der tragenden Schicht
- Ingardens 3. Schicht der "schematisierten Ansichten"
- Schematisierte Ansichten in der Material-Schicht
- Schematisierte Ansichten in der Schicht der Gegenstände
- Schematisierte Ansichten in den Hintergrundsschichten
- Die ontologischen Strukturgesetze des Sprachkunstwerks
- Ingardens Anti-"Psychologismus"
- Ingarden, die Rezeptionsästhetik und die Literatursoziologie
- Ingardens Werte-Theorie:
- Morawskis Kritik
- Eine marxistische Kritik Ingardens
- Ingardens Auseinandersetzung mit Käte Hamburger
- Einordnung von Ingardens Bemühungen in sein eigenes System der Ästhetik
- Zusammenfassende Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Werk befasst sich mit dem Werk und der Rezeption des Literaturtheoretikers Roman Ingarden, der insbesondere für sein Schichtenmodell des literarischen Kunstwerks bekannt ist. Der Autor beleuchtet die Einzigartigkeit und den Einfluss von Ingardens Werk auf andere Kritiker und untersucht die Gründe für Ingardens relative Unbekanntheit in der deutschen Germanistik.
- Die Bedeutung von Ingardens Werk für die Ästhetik und Literaturtheorie
- Kritikpunkte an Ingardens Werk und deren Bedeutung für das Verständnis der Literatur
- Der Vergleich von Ingardens Schichtenmodell mit dem Nicolai Hartmanns
- Die Rezeption von Ingardens Werk im Kontext des Strukturalismus und der Literatursoziologie
- Die ontologische Struktur des Sprachkunstwerks und Ingardens "Anti-Psychologismus"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Ingardens Werk durch die Brille anderer Kritiker und zeigt seine zentrale Bedeutung für die Entwicklung der Ästhetik und Literaturtheorie. Das zweite Kapitel geht der Frage nach, warum Ingardens Werk trotz seiner Bedeutung im akademischen Diskurs in der deutschen Germanistik nur wenig bekannt ist. Im dritten Kapitel wird Ingardens Schichtenmodell des Kunstwerks ausführlich dargestellt und mit dem Modell des Philosophen Nicolai Hartmann verglichen. Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Auffassungen der "tragenden Schicht" und die "schematisierten Ansichten" in Ingardens Modell. Kapitel 4 befasst sich mit den ontologischen Strukturgesetzen des Sprachkunstwerks, während Kapitel 5 Ingardens "Anti-Psychologismus" behandelt. Kapitel 6 setzt sich mit der Rezeption von Ingardens Werk im Kontext der Rezeptionsästhetik und der Literatursoziologie auseinander. In Kapitel 7 wird Ingardens Werte-Theorie und Morawskis Kritik daran beleuchtet. Kapitel 8 behandelt eine marxistische Kritik an Ingardens Werk. Kapitel 9 geht auf die Auseinandersetzung Ingardens mit Käte Hamburger ein. Kapitel 10 ordnet Ingardens Bemühungen in sein eigenes System der Ästhetik ein. Das elfte Kapitel bietet eine zusammenfassende Kritik an Ingardens Werk.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Buches sind die Ästhetik und Literaturtheorie. Der Fokus liegt auf dem Werk von Roman Ingarden, insbesondere seinem Schichtenmodell des literarischen Kunstwerks. Weitere wichtige Begriffe sind Nicolai Hartmann, Schichtenästhetik, Schichtenpoetik, Schichtentheorie, Sprachkunstwerk und Ontologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Schichtenmodell von Roman Ingarden?
Ingarden beschreibt das literarische Kunstwerk als ein Gebilde aus vier Schichten: Wortlaute, Bedeutungseinheiten, schematisierte Ansichten und dargestellte Gegenständlichkeiten.
Was versteht Ingarden unter „schematisierten Ansichten“?
Es sind die Aspekte eines Gegenstandes, die im Text nur angedeutet werden und die der Leser in seiner Phantasie „ausfüllen“ muss (Konkretisation).
Warum ist Ingarden in der Germanistik weniger bekannt als Hartmann?
Obwohl Ingardens Modell detailreicher ist, gilt Nicolai Hartmanns Entwurf oft als ontologisch durchdachter. Ingarden blieb für viele Germanisten eher ein Name am Rande.
Was bedeutet Ingardens „Anti-Psychologismus“?
Ingarden betont, dass das Kunstwerk ein objektives Gebilde ist, das unabhängig von den psychischen Erlebnissen des Autors oder Lesers existiert.
Welche Rolle spielt der Wert eines Kunstwerks bei Ingarden?
Ingarden unterscheidet zwischen dem Kunstgegenstand (das Werk an sich) und dem ästhetischen Gegenstand (das vom Leser erfahrene Werk), was zu komplexen Debatten über die Objektivität von Werten führt.
- Quote paper
- Dr. Wolfgang Ruttkowski (Author), 1995, Roman Ingarden und seine Kritiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7849