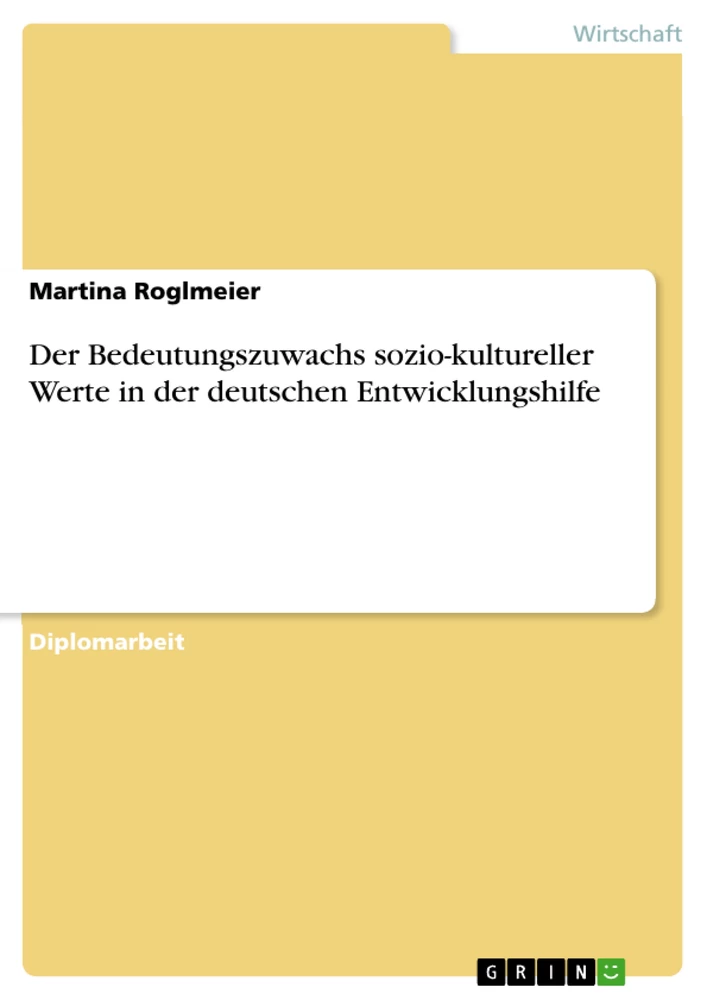Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Stellenwert soziokultureller Aspekte in der Entwicklungshilfe, der über die letzten fünfundzwanzig Jahre stark an Bedeutung zugenommen hat. Während die Kulturen der Entwicklungsländer noch bis in die 70er/80er Jahre hinein oftmals als „entwicklungshemmend“ erachtet wurden, hat sich mittlerweile die Einstellung diesbezüglich drastisch gewandelt: Kultur wird nun als elementarer Bestandteil der Lebensauffassung eines Menschen ernst genommen und respektiert. Kultur schafft Identität, gibt Sinn und Halt, ein Fakt, auf den auch in der Entwicklung eines Landes Rücksicht genommen werden muss. Trotz dieses übereinstimmenden Einstellungswandels in der entwicklungspolitischen Grundhaltung, bestehen nach wie vor große Schwierigkeiten bezüglich der Umsetzung von kultursensibler Entwicklungsarbeit in der Praxis.
Der Prozess im theoretischen Diskurs, der dazu führte soziokulturellen Werten mehr Bedeutung zuzumessen, bildet den ersten Abschnitt dieser Arbeit. Der zweite Teil widmet sich dem Schwerpunkt dieser Arbeit und erläutert, welche Umstände dazu führen, dass kulturelle Aspekte in der Praxis der Entwicklungshilfe oft nicht genügend berücksichtigt werden. Hier soll insbesondere die große Kluft verdeutlicht werden, die zwischen den allgemeingültigen theoretischen Konzepten und den spezifischen kulturellen Anforderungen in der Realität der Entwicklungsprojekte besteht. Der nachfolgende Abschnitt veranschaulicht anhand zweier Projekte nochmals am konkreten Beispiel die Realität in der Entwicklungshilfe und die Komplexität der kulturellen Rahmenbedingungen, mit denen ein Entwicklungshelfer vor Ort konfrontiert ist. Abschließend werden mögliche Ansatzpunkte und Trends aufgezeigt, wie der Thematik „Kultur und Entwicklung“ in unterschiedlicher Weise begegnet werden kann.
Ziel der Arbeit ist es, die Sensibilität dafür zu schärfen, dass man ein Land nicht entwickeln kann, man kann es lediglich so unterstützen, dass es sich auf seinen eigene Art entwickeln kann. Nach wie vor besteht eine große Dynamik im entwicklungspolitischen Diskurs zu dieser Thematik. Die vorliegende Arbeit zeigt den Status Quo in der Auseinandersetzung mit „Kultur und Entwicklung“ auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: „Wie die Wilden“
- 2 Soziokulturelle Werte in der Entwicklungstheorie
- 2.1 Begriffsabgrenzung: Kultur im entwicklungspolitischen Verständnis
- 2.2 Der Umgang mit Kultur in der Geschichte der Entwicklungstheorien
- 2.2.1 Kolonialzeit
- 2.2.2 Imperialismustheorien
- 2.2.3 Modernisierungstheorien
- 2.2.4 Dependenztheorien
- 2.2.5 Die 70er: Grundbedürfnisstrategie
- 2.2.6 Die 80er
- 2.2.7 Die 90er
- 2.3 Zusammenfassende Betrachtung: Westliche vs. einheimische Kultur
- 2.4 Aktuelle entwicklungstheoretische Ansätze zur Kulturthematik
- 2.4.1 Das Partizipationskonzept
- 2.4.2 Das Genderkonzept (Gleichberechtigungskonzept)
- 3 Soziokulturelle Werte in der praktischen Entwicklungshilfe
- 3.1 Überblick über die Strukturen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
- 3.1.1 Staatliche Organisationen
- 3.1.2 Nichtregierungsorganisationen (NRO)
- 3.2 Soziokulturelle Aspekte in der Projektarbeit
- 3.2.1 Antragsstellung und -prüfung
- 3.2.2 Projektplanung
- 3.2.3 Projektdurchführung
- 3.2.4 Projektkontrolle
- 3.3 Exemplarische Analyse interkultureller Konfliktpunkte
- 3.3.1 Weltanschauung: Java, Westafrikanische Stämme, Nepalesische Bergvölker
- 3.3.2 Managementauffassung: Subsahara-Afrika, „Auslandschinesen“
- 4 Praxisbeispiele
- 4.1 „Circle of Life“: Bildung für Kinder und Jugendliche auf den Philippinen
- 4.2 Beratung von Schneidereien im Auftrag des Senior Experten Service
- 5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Stellenwert soziokultureller Aspekte in der deutschen Entwicklungshilfe über die letzten 25 Jahre. Das Ziel ist es, die Bedeutung von Kultur in der Entwicklungshilfe zu verdeutlichen und die Herausforderungen ihrer Berücksichtigung in der Praxis aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert den Wandel der Einstellung gegenüber Kultur in der Entwicklungstheorie und beleuchtet die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.
- Wandel des Verständnisses von Kultur in der Entwicklungstheorie
- Herausforderungen der kultursensiblen Entwicklungsarbeit in der Praxis
- Analyse konkreter Entwicklungsprojekte und interkultureller Konfliktpunkte
- Mögliche Ansatzpunkte und Trends für eine kultursensible Entwicklungszusammenarbeit
- Die Kluft zwischen theoretischen Konzepten und der Realität von Entwicklungsprojekten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: „Wie die Wilden“: Dieses einführende Kapitel beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: den Wandel der Betrachtungsweise soziokultureller Werte in der Entwicklungshilfe. Es skizziert die Problematik, dass obwohl die Bedeutung von Kultur anerkannt ist, deren Berücksichtigung in der Praxis nach wie vor große Herausforderungen mit sich bringt. Das Kapitel bereitet den Leser auf die folgenden Kapitel vor, indem es den Fokus auf die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis legt.
2 Soziokulturelle Werte in der Entwicklungstheorie: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Verständnisses von Kultur innerhalb der Entwicklungstheorien. Es beginnt mit einer Begriffsabgrenzung von „Kultur“ im entwicklungspolitischen Kontext. Anschließend wird der historische Umgang mit kulturellen Aspekten in verschiedenen Entwicklungstheorien (Kolonialismus, Imperialismus, Modernisierung, Dependenztheorien, Grundbedürfnisstrategie) untersucht und kritisch bewertet. Der Schwerpunkt liegt auf der Veränderung der Sichtweise von „Entwicklungshemmung“ hin zur Anerkennung von Kultur als essentiellem Bestandteil von Entwicklung. Das Kapitel mündet in die Darstellung aktueller Ansätze wie Partizipation und Gender-Mainstreaming.
3 Soziokulturelle Werte in der praktischen Entwicklungshilfe: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Umsetzung soziokultureller Aspekte in der Praxis der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Es analysiert die Strukturen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (staatliche Organisationen und NROs) und beleuchtet den Einfluss soziokultureller Faktoren auf alle Phasen eines Entwicklungsprojekts (Antragsstellung, Planung, Durchführung, Kontrolle). Der Abschnitt über interkulturelle Konfliktpunkte verdeutlicht die Komplexität kultureller Rahmenbedingungen anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Weltregionen.
4 Praxisbeispiele: Dieser Abschnitt veranschaulicht die theoretischen Überlegungen anhand von Fallstudien. Er präsentiert zwei konkrete Beispiele aus der Entwicklungshilfe, um die Komplexität und die Herausforderungen der Berücksichtigung kultureller Aspekte in der Praxis zu illustrieren. Die Fallstudien dienen als exemplarische Veranschaulichung der im vorherigen Kapitel diskutierten Probleme und Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Entwicklungshilfe, Kultur, soziokulturelle Faktoren, Partizipation, Entwicklungsprojekt, interkulturelle Kommunikation, kultursensible Entwicklungszusammenarbeit, theoretische Konzepte, Praxis, Konfliktpunkte, Fallstudien, Gender, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziokulturelle Werte in der Entwicklungshilfe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Stellenwert soziokultureller Aspekte in der deutschen Entwicklungshilfe der letzten 25 Jahre. Sie analysiert den Wandel der Einstellung gegenüber Kultur in der Entwicklungstheorie und beleuchtet die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Bedeutung von Kultur in der Entwicklungshilfe verdeutlichen und die Herausforderungen ihrer Berücksichtigung in der Praxis aufzeigen. Sie untersucht den Wandel des Verständnisses von Kultur in der Entwicklungstheorie und analysiert konkrete Entwicklungsprojekte und interkulturelle Konfliktpunkte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Verständnisses von Kultur in der Entwicklungstheorie, die Herausforderungen kultursensibler Entwicklungsarbeit, die Analyse konkreter Entwicklungsprojekte und interkultureller Konfliktpunkte, mögliche Ansatzpunkte und Trends für eine kultursensible Entwicklungszusammenarbeit und die Kluft zwischen theoretischen Konzepten und der Realität von Entwicklungsprojekten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die den Wandel der Betrachtungsweise soziokultureller Werte in der Entwicklungshilfe beschreibt; ein Kapitel über soziokulturelle Werte in der Entwicklungstheorie, welches den historischen Umgang mit kulturellen Aspekten in verschiedenen Entwicklungstheorien untersucht; ein Kapitel über soziokulturelle Werte in der praktischen Entwicklungshilfe, welches die Strukturen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und den Einfluss soziokultureller Faktoren auf Entwicklungsprojekte analysiert; ein Kapitel mit Praxisbeispielen, welches die theoretischen Überlegungen anhand von Fallstudien veranschaulicht; und einen Ausblick.
Welche Entwicklungstheorien werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Entwicklungstheorien, darunter Kolonialismus-, Imperialismus-, Modernisierungstheorien, Dependenztheorien und die Grundbedürfnisstrategie. Sie analysiert kritisch den Umgang mit kulturellen Aspekten innerhalb dieser Theorien.
Welche Aspekte der praktischen Entwicklungshilfe werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Strukturen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (staatliche Organisationen und NROs) und den Einfluss soziokultureller Faktoren auf alle Phasen eines Entwicklungsprojekts (Antragsstellung, Planung, Durchführung, Kontrolle). Sie analysiert exemplarisch interkulturelle Konfliktpunkte anhand von Beispielen aus verschiedenen Weltregionen.
Welche Praxisbeispiele werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert zwei Fallstudien: „Circle of Life“: Bildung für Kinder und Jugendliche auf den Philippinen und die Beratung von Schneidereien im Auftrag des Senior Experten Service. Diese dienen der Veranschaulichung der Herausforderungen der Berücksichtigung kultureller Aspekte in der Praxis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entwicklungshilfe, Kultur, soziokulturelle Faktoren, Partizipation, Entwicklungsprojekt, interkulturelle Kommunikation, kultursensible Entwicklungszusammenarbeit, theoretische Konzepte, Praxis, Konfliktpunkte, Fallstudien, Gender, Nachhaltigkeit.
Welche Konzepte werden im Kontext der aktuellen Entwicklungstheorien hervorgehoben?
Die Arbeit hebt aktuelle Ansätze wie Partizipation und Gender-Mainstreaming hervor, die die Bedeutung kultureller Aspekte in der Entwicklungsarbeit betonen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die konkrete Schlussfolgerung der Arbeit ist nicht explizit in der Vorschau enthalten. Die Zusammenfassung deutet jedoch auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis der kultursensiblen Entwicklungszusammenarbeit hin.)
- Arbeit zitieren
- Martina Roglmeier (Autor:in), 2007, Der Bedeutungszuwachs sozio-kultureller Werte in der deutschen Entwicklungshilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78504