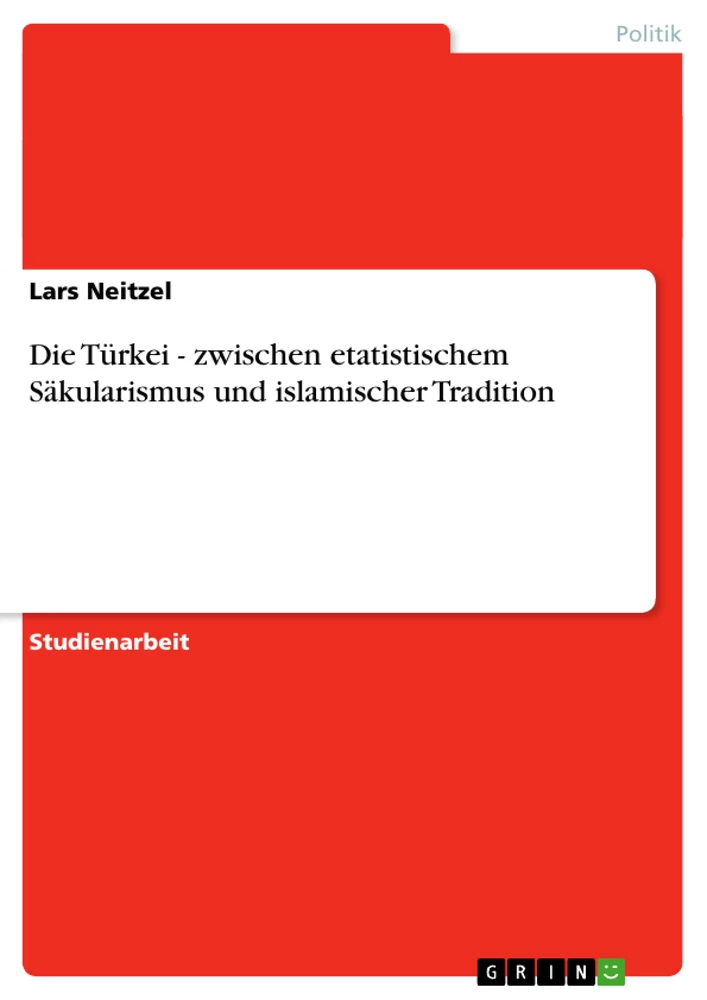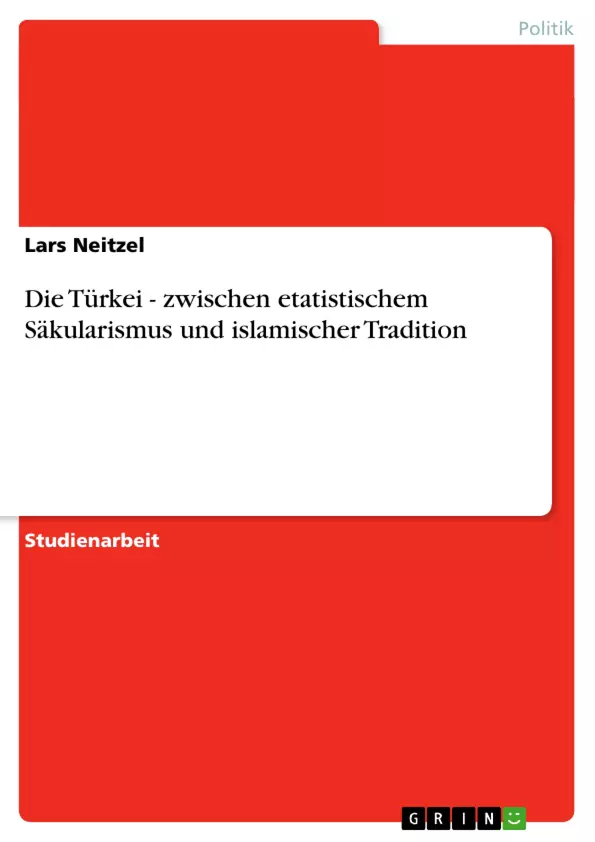„Weg frei für Gespräche mit Türkei über EU-Beitritt“ (Bolesch 2005 a: 1). So lautete am 04.10.2005 die Überschrift eines Artikel auf der Titelseite der „Süddeutsche Zeitung“. Zwar bezeichnet jener Artikel die Umstände, unter denen es zur Aufnahme jener Beitrittsverhandlungen gekommen ist, als „chaotisch“ und doch ist dem derzeitigen türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan mit der gemäßigt – islamistischen Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) die Aufnahme von Gesprächen gelungen. Seit dem Erreichen der absoluten Mehrheit im Jahre 2002 brachte Erdogan Reformen auf den Weg, die einerseits eine Voraussetzung für die Aufnahme in die Europäische Union (EU) darstellen, „die aber gleichzeitig einen radikalen Bruch mit den kemalistischen Traditionen bedeuten“ (Agai 2004: 18).
Wie dieser Bruch im Einzelnen aussieht, wird diese Arbeit klären. So werden als Maßstab zur Bewertung vor allem zwei Parameter genutzt werden. Hierbei handelt es sich zum einen um den etatistischen Säkularismus und zum anderen um die islamische Tradition. So versteht man unter etatistischem Säkularismus im Rahmen der kemalistischen Ideologie einen Staat, der Einfluss auf die Kernbereiche der Wirtschaft nimmt und der sich von der Kirche strikt abgrenzt, während islamische Tradition die Umsetzung von religiösen Prinzipien und Normen unter Berufung auf den Islam meint. Zu unterscheiden ist die islamische Tradition vom Islamismus, der dagegen eine kompromisslose, islamische Ideologie vertritt (Elger (Hrsg.) 2003: 101 ff.). Dagegen sind Etatismus und die Trennung von Staat und Kirche zwei von sechs durch den Staatsgründer Kemal etablierten Prinzipien, so dass im Rahmen dieser Untersuchung auch die anderen vier Prinzipien, auf die in der Folge eingegangen werden wird, berücksichtigt werden müssen. Die Auflösung des scheinbaren Widerspruchs zwischen Säkularismus und islamischer Tradition, die Rolle des Kemalismus, eine Untersuchung der wichtigsten Akteure und eine Projektion auf die aktuelle Situation wird Thema dieser Arbeit sein.
Es gilt zu klären, ob trotz des Säkularismus der Islam Einfluss auf die staatliche Orientierung nimmt; also ob die Türkei ein traditioneller, islamischer Staat oder eher ein westlich zugeneigter, aufgeklärter Beitrittskandidat ist. Weiterhin wird aufzuschlüsseln sein, ob die Prinzipien des eben bereits erwähnten Kemalismus, verknüpft mit dem Islam, überhaupt eine so feste Bindung an den Westen zulassen und welche Akteure hier im Einzelnen das politische System der Türkei und dessen Prozesse beeinflussen. Ebenso wichtig ist es auszuzeigen, wie wahrscheinlich die dauerhafte Einhaltung der Kopenhagener Kriterien, die seit 1993 u.a. eine stabile rechtsstaatliche Grundlage, die Wahrung der Menschenrechte und ein Schutz von Minderheiten verlangen, ist.
Die Türkei ist mit derzeit ca. 70 Millionen Einwohnern das größte Mittelmeerland, mit einem Teil seines Territoriums auf europäischer und einem anderen Teil auf dem asiatischen Kontinent und besitzt somit eine Brückenfunktion zwischen den Kontinenten mit einer außergewöhnlichen, strategischen Bedeutung. Als einziges vorwiegend islamisches Land trennt es Staat und Kirche. Im Laufe des geschichtlichen Überblicks (2.1) wird erläutert werden, wie es zum einen zu dieser Brückenfunktion und zum anderen zur Trennung von Staat und Kirche kam. Im zweiten Teil des Hauptteils geht die Arbeit dann auf innenpolitische Restriktionen ein. Gemeint sind damit Faktoren und Akteure, die Einfluss auf das politische System der Türkei nehmen. Genauer betrachtet werden, sollen hier vor allem die Parteien im politischen System (2.2.1.), der Islam und der Kemalismus (2.2.2.), die Rolle des Militärs (2.2.3.), sowie die Rolle der Minderheiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Geschichtlicher Überblick
- 2.1.1. Das Ende des Osmanischen Reichs und die Gründung der kemalistischen Republik Türkei
- 2.1.2. Die Türkei nach 1945
- 2.2. Innenpolitische Restriktionen
- 2.2.1. Die Parteien im politischen System
- 2.2.2. Islam und Kemalismus
- 2.2.3. Die Rolle des Militärs
- 2.2.4. Die Rolle der Minderheiten
- 2.1. Geschichtlicher Überblick
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Türkei angesichts des etatistischen Säkularismus und der islamischen Tradition einen möglichen Beitritt in die Europäische Union (EU) realisieren kann. Dabei werden insbesondere die Veränderungen seit dem Aufstieg der AKP und die Reformen unter Erdogan betrachtet.
- Der etatistische Säkularismus als Grundlage der kemalistischen Ideologie
- Die Rolle des Islams in der türkischen Gesellschaft und Politik
- Die Bedeutung des Kemalismus für die türkische Identität und die politische Ordnung
- Die Reformen unter Erdogan und ihre Auswirkungen auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung
- Die Einhaltung der Kopenhagener Kriterien und die Herausforderungen für einen möglichen EU-Beitritt
Zusammenfassung der Kapitel
2.1. Geschichtlicher Überblick
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Republik Türkei im Kontext des Niedergangs des Osmanischen Reiches und der Rolle Mustafa Kemals. Es wird erläutert, wie die Türkei zum einen eine Brückenfunktion zwischen den Kontinenten einnimmt und zum anderen die Trennung von Staat und Kirche erreicht hat.
2.2. Innenpolitische Restriktionen
Dieses Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Akteuren und Faktoren, die das politische System der Türkei beeinflussen. Es werden insbesondere die Parteienlandschaft, die Interaktion von Islam und Kemalismus, die Rolle des Militärs und der Einfluss von Minderheiten analysiert.
Schlüsselwörter
Etatistischer Säkularismus, islamische Tradition, Kemalismus, AKP, Erdogan, EU-Beitritt, Kopenhagener Kriterien, Türkei, Geschichte, Politik, Minderheiten, Militär.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet etatistischer Säkularismus in der Türkei?
Es beschreibt das kemalistische Prinzip eines Staates, der die Wirtschaft lenkt und eine strikte Trennung von Staat und Religion (Laizismus) durchsetzt.
Wer ist Mustafa Kemal Atatürk?
Er war der Gründer der modernen Republik Türkei und etablierte die sechs Prinzipien des Kemalismus, um das Land nach westlichem Vorbild zu modernisieren.
Welche Rolle spielt die AKP unter Erdogan?
Die AKP (Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei) leitete Reformen ein, die einerseits den EU-Beitritt vorbereiten sollten, andererseits aber einen Bruch mit kemalistischen Traditionen darstellten.
Was sind die Kopenhagener Kriterien?
Es sind Voraussetzungen für den EU-Beitritt, darunter stabile rechtsstaatliche Institutionen, die Wahrung der Menschenrechte und der Schutz von Minderheiten.
Ist die Türkei ein laizistischer oder islamischer Staat?
Die Arbeit untersucht genau dieses Spannungsfeld zwischen der verfassungsrechtlich verankerten Trennung von Staat und Kirche und der tief verwurzelten islamischen Tradition.
- Citation du texte
- Dipl. Pol. Lars Neitzel (Auteur), 2005, Die Türkei - zwischen etatistischem Säkularismus und islamischer Tradition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78509