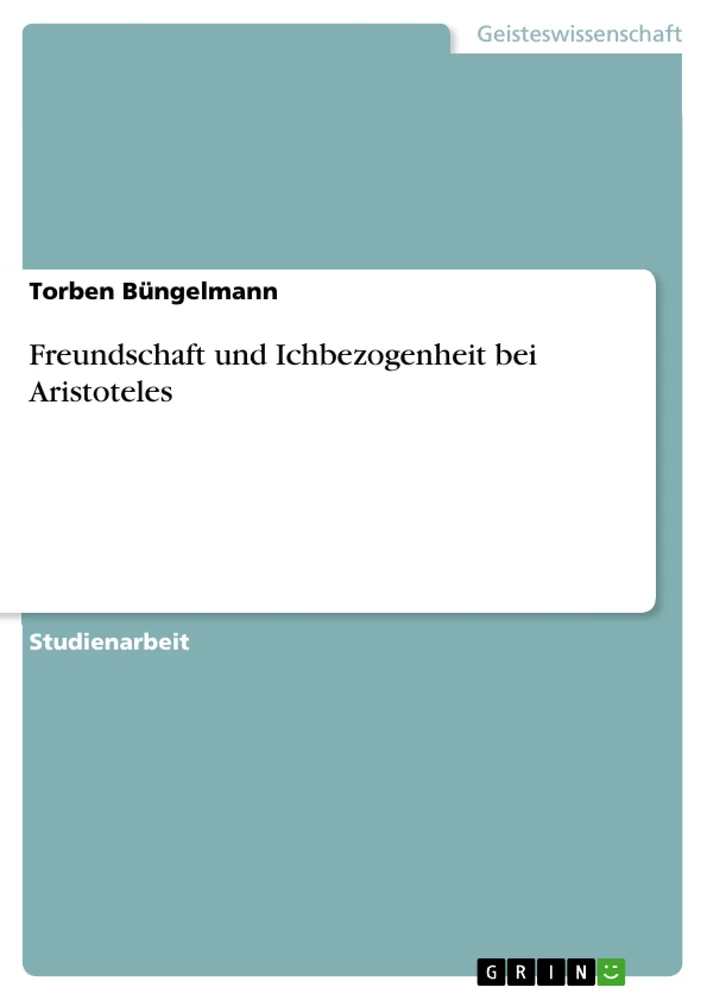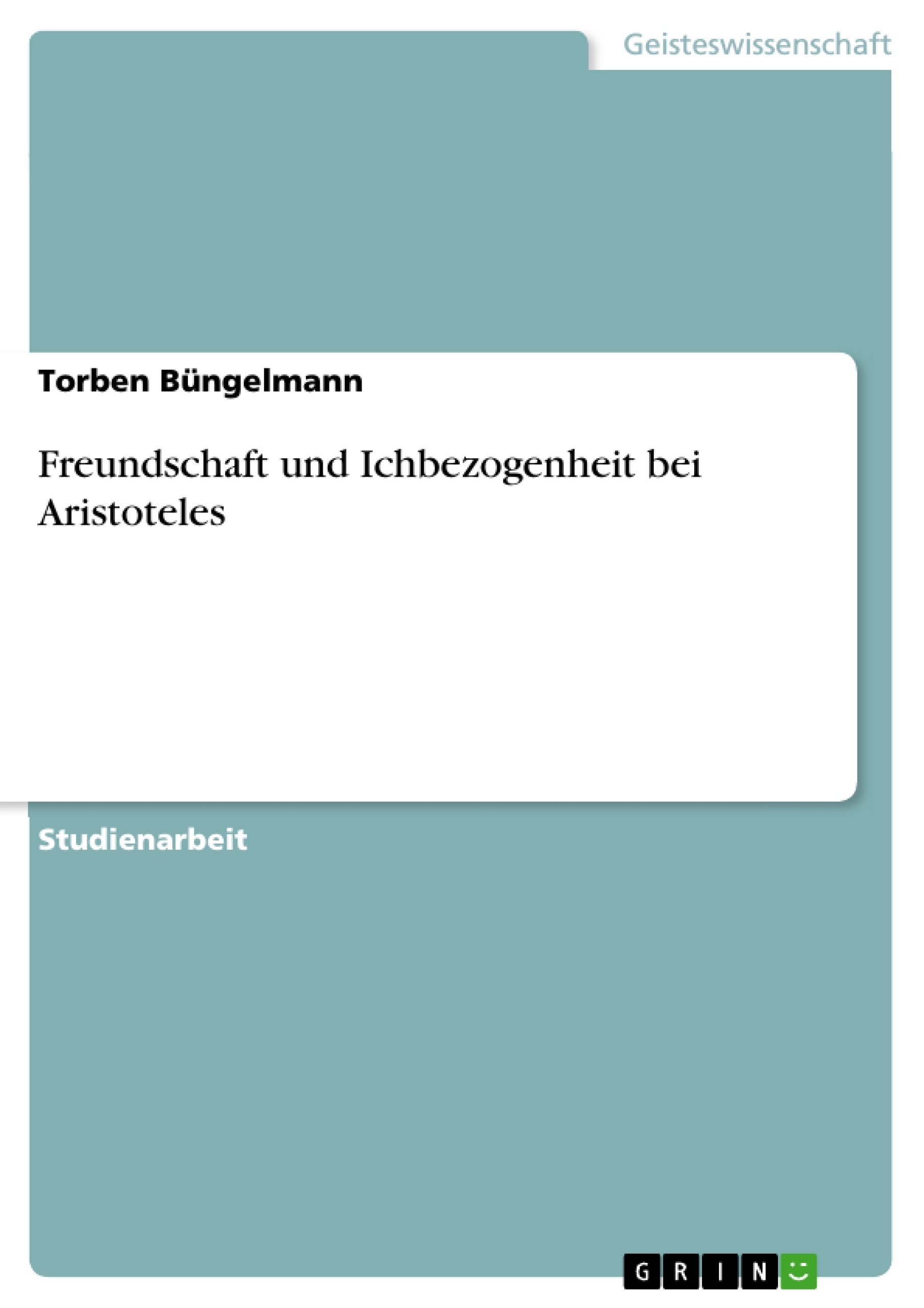Aristoteles unterscheidet in der Nikomachischen Ethik (Buch 8 und 9) drei Arten von Freundschaft, die Nutzfreundschaft, die Lustfreundschaft und schließlich als die höchste Form die zweckfreie Freundschaft der Tugendhaften. Wer diese Art vollkommener Beziehung erreichen möchte, der muss von ethisch vorzüglichem Wesen sein, und das schließt ein, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Es geht also in der Freundschaft immer auch um das Verhältnis zu einem selbst, um Ichbezogenheit. Damit kommt die Untersuchung in dieser Arbeit in ihre Spur. Die Arbeit thematisiert das prima facie widersprüchliche Verhältnis von Eigenliebe und Ichbezogenheit auf der einen und vollkommener Freundschaft auf der anderen Seite. Dieser nur scheinbare Widerspruch wird von Aristoteles dadurch aufgehoben, dass der Freund als ein zweites Ich konzipiert wird, und die Beziehung zum Freund spiegelt so das Verhältnis zu sich selbst wieder. Aristoteles möchte zeigen, dass Selbstliebe, richtig verstanden, d.h. ohne die fundamentale Differenz von Ich und Du zu leugnen, eine Bedingung für wirkliche Freundschaft ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die drei Arten der Freundschaft
- Die Freundschaft um des Nutzens willen
- Die Freundschaft um der Lust willen
- Die Freundschaft der Guten
- Der Freund als zweites Ich
- Die Einheit der Seele
- Der Wunsch nach dem Guten
- Das Beisammensein
- Die Selbstliebe
- Bestimmung der Selbstliebe
- Selbstliebe und tugendhaftes Handeln
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Ichbezogenheit als wesentliches Strukturmerkmal menschlichen Verhaltens in der Freundschaft und darüber hinaus. Das zentrale Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Ichbezogenheit und Freundschaft aufzuzeigen und zu demonstrieren, dass Ichbezogenheit nicht im Widerspruch zu tugendhaftem und allgemein gutem Handeln steht, sondern vielmehr dessen Grundlage bildet. Die Arbeit folgt dabei dem Aufbau von Aristoteles' Darstellung in der Nikomachischen Ethik.
- Die verschiedenen Arten der Freundschaft nach Aristoteles
- Der Freund als „zweites Ich“ und die Einheit der Seele
- Die Rolle des Wunsches nach dem Guten in der Freundschaft
- Die Bedeutung der Selbstliebe für tugendhaftes Handeln
- Die Vereinbarkeit von Ichbezogenheit und Freundschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht Aristoteles' Ausführungen zur Freundschaft in der Nikomachischen Ethik, insbesondere den Aspekt der Ichbezogenheit als konstitutives Element menschlichen Verhaltens in freundschaftlichen Beziehungen. Es wird die Frage nach der Vereinbarkeit von Ichbezogenheit und Freundschaft behandelt und argumentiert, dass Ichbezogenheit nicht im Widerspruch zu tugendhaftem Handeln steht, sondern dessen Grundlage bildet. Die Argumentation folgt dem Aufbau von Aristoteles' Darstellung.
Die drei Arten der Freundschaft: Aristoteles differenziert zwischen drei Arten von Freundschaft: der Freundschaft um des Nutzens willen, der Freundschaft um der Lust willen und der Freundschaft der Guten. Die Freundschaft um des Nutzens willen basiert auf gegenseitigem Vorteil, während die Freundschaft um der Lust willen auf gemeinsamen Genuss beruht. Die höchste Form, die Freundschaft der Guten, basiert auf gegenseitigem Respekt und dem Wunsch nach dem Guten des anderen. Aristoteles betont die instrumentale Natur der ersten beiden Formen und hebt die vollkommene Freundschaft der Tugendhaften als die höchste Form hervor. Die vorläufige Definition der Freundschaft beinhaltet gegenseitiges Wohlwollen und den Wunsch nach dem Guten des anderen.
Der Freund als zweites Ich: Dieses Kapitel erörtert die Ichbezogenheit als formales Merkmal der Freundschaft. Das Verhältnis zum Freund wird als Spiegelung des Verhältnisses zu sich selbst verstanden. Dies dient der Auflösung der scheinbaren Widersprüchlichkeit zwischen Freundschaft und Ichbezogenheit. Der Fokus liegt auf den strukturellen Eigenschaften des tugendhaften Menschen im Kontrast zum „Minderwertigen“. Durch die Betrachtung des Freundes als „zweites Ich“ werden wesentliche Einsichten in die Bedingungen einer gelungenen Freundschaft formuliert.
Die Selbstliebe: Dieses Kapitel behandelt die Selbstliebe als den zweiten, realen Aspekt der Ichbezogenheit. Ausgehend von der Verankerung eines glücklichen Lebens im Verhältnis des Menschen zu sich selbst, wird argumentiert, dass Selbstliebe eine natürliche Eigenschaft und letztlich die Bedingung für Tugendhaftigkeit ist. Durch Vernunft und gezielte Lenkung wird Selbstliebe als Grundlage tugendhaften Handelns dargestellt.
Schlüsselwörter
Freundschaft, Ichbezogenheit, Aristoteles, Nikomachische Ethik, Tugend, Selbstliebe, Glückseligkeit, menschliches Handeln, Wohlwollen, Nutzen, Lust, ethische Hochstehende, Minderwertige, vollkommene Freundschaft.
Häufig gestellte Fragen zu „Aristoteles' Freundschaftstheorie: Ichbezogenheit und tugendhaftes Handeln“
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Ichbezogenheit als zentrales Strukturmerkmal menschlichen Verhaltens im Kontext von Freundschaft und beleuchtet deren Vereinbarkeit mit tugendhaftem Handeln. Sie argumentiert, dass Ichbezogenheit nicht im Widerspruch zu gutem Handeln steht, sondern dessen Grundlage bildet.
Welche Struktur folgt die Arbeit?
Die Arbeit orientiert sich am Aufbau von Aristoteles' Darstellung der Freundschaft in der Nikomachischen Ethik.
Welche Arten von Freundschaft unterscheidet Aristoteles?
Aristoteles unterscheidet drei Arten: die Freundschaft um des Nutzens willen (basierend auf gegenseitigem Vorteil), die Freundschaft um der Lust willen (basierend auf gemeinsamem Genuss) und die höchste Form, die Freundschaft der Guten (basierend auf gegenseitigem Respekt und dem Wunsch nach dem Guten des anderen).
Wie wird der Freund als „zweites Ich“ verstanden?
Der Freund wird als Spiegelung des Verhältnisses zu sich selbst betrachtet. Diese Perspektive dient der Auflösung des scheinbaren Widerspruchs zwischen Freundschaft und Ichbezogenheit. Die Betrachtung des Freundes als „zweites Ich“ ermöglicht wesentliche Einsichten in gelungene Freundschaften.
Welche Rolle spielt die Selbstliebe?
Die Selbstliebe wird als zweiter, realer Aspekt der Ichbezogenheit verstanden. Sie wird als natürliche Eigenschaft und Bedingung für Tugendhaftigkeit dargestellt. Durch Vernunft und gezielte Lenkung bildet Selbstliebe die Grundlage tugendhaften Handelns.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Freundschaft, Ichbezogenheit, Aristoteles, Nikomachische Ethik, Tugend, Selbstliebe, Glückseligkeit, menschliches Handeln, Wohlwollen, Nutzen, Lust, ethische Hochstehende, Minderwertige und vollkommene Freundschaft.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den drei Arten der Freundschaft, zum Freund als „zweites Ich“, zur Selbstliebe und ein Resümee.
Was ist das Hauptargument der Arbeit?
Das Hauptargument ist, dass Ichbezogenheit kein Hindernis für tugendhaftes Handeln und wahre Freundschaft darstellt, sondern vielmehr deren Grundlage bildet.
Wie wird die scheinbare Widersprüchlichkeit von Ichbezogenheit und Freundschaft aufgelöst?
Die Arbeit löst den scheinbaren Widerspruch auf, indem sie die Freundschaft als ein Verhältnis darstellt, in dem die Ichbezogenheit des Einzelnen nicht als egoistisch, sondern als Grundlage für gegenseitiges Wohlwollen und den Wunsch nach dem Guten des anderen verstanden wird. Der Freund wird als „zweites Ich“ gesehen, was die Einheit der Seele und den Wunsch nach dem Guten verdeutlicht.
- Quote paper
- Torben Büngelmann (Author), 2004, Freundschaft und Ichbezogenheit bei Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78665