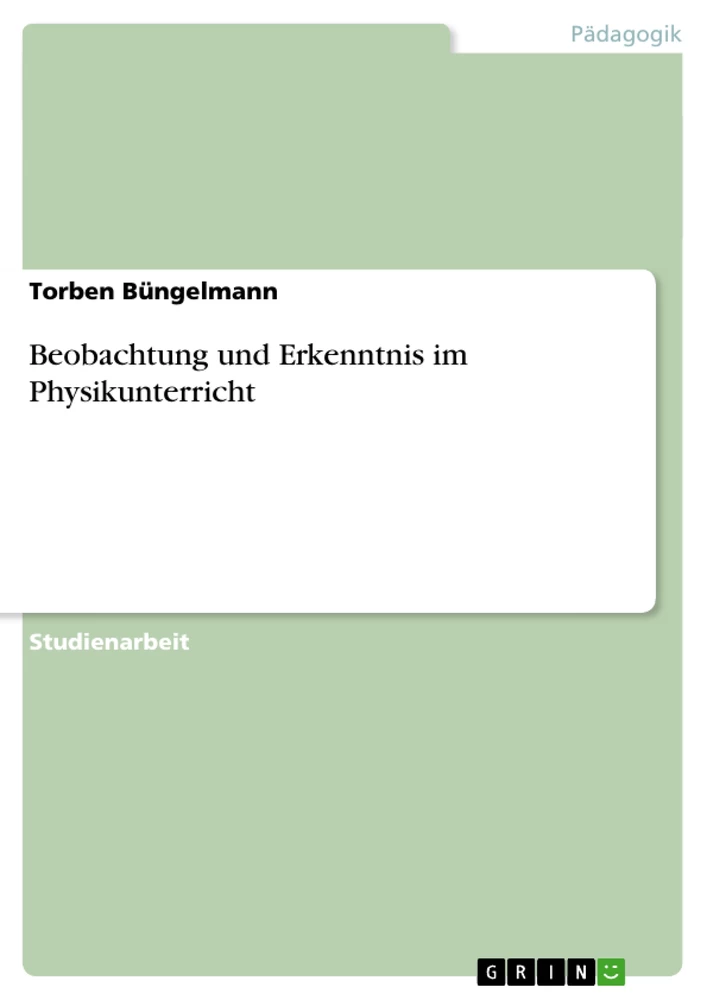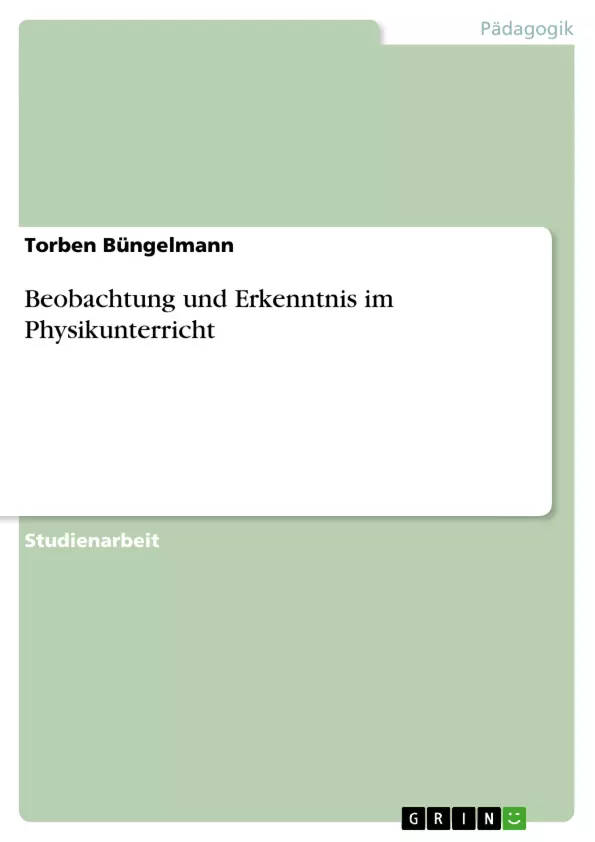Die Arbeit fragt grundsätzlich, aus einer philosophischen Perspektive heraus nach den Möglichkeiten und Bedingungen am Experiment gewonnener Erkenntnis im Physikunterricht. Dazu werden zunächst erkenntnistheoretische Standpunkte von Platon, des Empirismus und des kritischen Rationalismus (Popper) vorgestellt, die dann didaktisch aufgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Auf der didaktischen Metaebene
- Das Referat: Konzeption und Ablauf
- Zwecksetzung des Referates
- Ablauf
- Erkenntnistheorie: Von Platon bis Popper
- Das Problem mit Experimenten / Beobachtungen
- Erkenntnis und Vorkenntnis
- Experimente im Unterricht
- Historische Annäherung
- Platon: Zwei Welten des Seins
- Renaissance: Rationalismus und Empirismus
- Moderne Standpunkte der Erkenntnistheorie
- Naiver Empirismus
- Kritischer Rationalismus
- Das Problem mit Experimenten / Beobachtungen
- Didaktische Aufbereitung: Was man davon lernt
- Vorab: Sinn und Zweck von Erkenntnistheorie
- Ableitungen für das Unterrichtsgeschehen
- Platon: Sehen und Einsehen
- Naiver Empirismus: Physikalische Bodenhaftung
- Kritischer Rationalismus: Wissen, was man will
- Blick in die Empirie: Die Fachdidaktik-Literatur
- Drei Autoren
- Bewertung: Gute Übereinstimmung
- Resumee: Gute Chancen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat verfolgt das Ziel, grundlegendes Wissen über die Wissenschafts-, insbesondere aber die Erkenntnistheorie zu vermitteln und daraus Kriterien für erfolgreiches physikalisches Lernen im Unterricht zu gewinnen. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer des Referates durch praktische Selbsttätigkeit und didaktisch angeleitete Reflexion für die Schwierigkeiten sensibilisiert werden, die jedes physikalische Lernen begleiten.
- Die Herausforderungen der Erkenntnisgewinnung in der Physik
- Die Rolle von Experimenten im Physikunterricht
- Verschiedene erkenntnistheoretische Standpunkte und ihre Bedeutung für die Didaktik
- Die Anwendung von Erkenntnistheorie in der Praxis des Physikunterrichts
- Die Grenzen des physikalischen Wissens und die Bedeutung von kritischer Reflexion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschreibt die Zwecksetzung des Referats und den Ablauf der Stunde. Es wird erläutert, wie die Teilnehmer in einem praktischen Teil ein physikalisches Phänomen erforschen sollen, um die Schwierigkeiten der Erkenntnisgewinnung am eigenen Leib zu erfahren.
Kapitel zwei beleuchtet die Erkenntnistheorie und greift den scheinbaren Widerspruch auf, dass Experimente einerseits als Prüfverfahren für Theorien dienen, im Unterricht aber zur Gewinnung von Erkenntnis eingesetzt werden. Es werden drei wesentliche erkenntnistheoretische Argumentationen historisch erschlossen und in die beiden Grundpositionen des „(naiven) Empirismus“ und des „kritischen Rationalismus“ überführt.
Kapitel drei widmet sich der didaktischen Aufbereitung der Erkenntnisse aus der Erkenntnistheorie. Es werden Ableitungen für das Unterrichtsgeschehen und die sinnvolle Anwendung von Experimenten im Physikunterricht aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Erkenntnistheorie, Physikdidaktik, Experiment, Beobachtung, Theorie, Empirismus, Rationalismus, Unterricht, Wissen, Erkenntnisgewinnung, Metaebene, Didaktik
Häufig gestellte Fragen
Welche erkenntnistheoretischen Positionen werden im Text behandelt?
Es werden die Standpunkte von Platon, der Empirismus und der kritische Rationalismus nach Karl Popper vorgestellt.
Welche Rolle spielen Experimente im Physikunterricht?
Experimente dienen im Unterricht oft der Erkenntnisgewinnung, was im Text kritisch im Hinblick auf wissenschaftliche Prüfverfahren hinterfragt wird.
Was ist das Ziel des Referats?
Das Ziel ist die Vermittlung von Wissen über Erkenntnistheorie, um Kriterien für erfolgreiches Lernen in der Physikdidaktik zu gewinnen.
Was versteht man unter "naivem Empirismus" in diesem Kontext?
Der naive Empirismus wird als didaktische Position beschrieben, die eine starke physikalische Bodenhaftung durch Beobachtung betont.
Wie wird der kritische Rationalismus didaktisch genutzt?
Er hilft dabei, die Grenzen des Wissens zu verstehen und die Rolle von Theorien bei der Beobachtung kritisch zu reflektieren.
- Arbeit zitieren
- Torben Büngelmann (Autor:in), 2006, Beobachtung und Erkenntnis im Physikunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78669