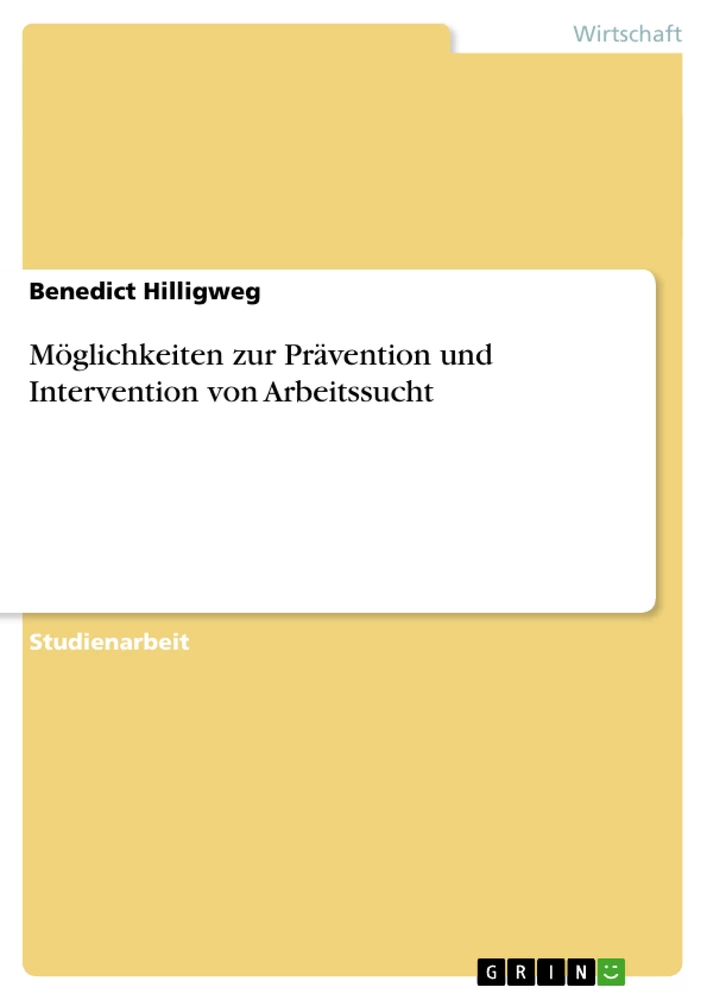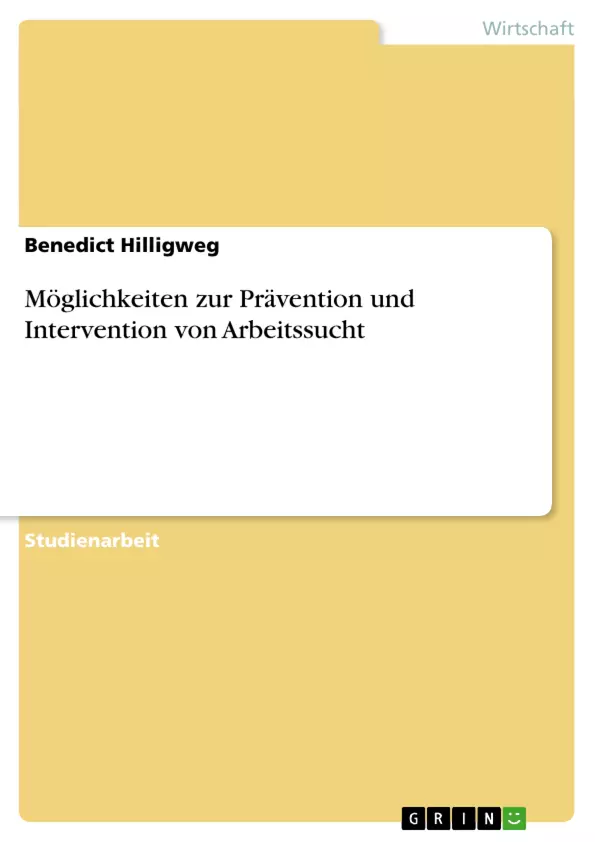Immer mehr Menschen leiden unter Problemen in Zusammenhang mit ihrer Arbeit,
wofür der immer größer werdende Druck von außen aber auch von innen, immer
mehr, immer schneller und immer perfekter zu arbeiten, ursächlich ist. Das
Problem der ’Arbeitssucht’ wird dabei gern als Produkt unserer
leistungsorientierten Gesellschaft gesehen, jedoch hat bereits Gustav Flaubert im
Jahre 1852 seine „frenetische, pervertierte Liebe“ zur Arbeit beschrieben.
Entgegen der Meinung einiger US-amerikanischer Forscher, die Arbeitssucht als
etwas positives verstehen, finden sich im deutschsprachigen Raum zunehmend
wissenschaftliche Bestätigungen dafür, dass es kaum erstrebenswert ist,
arbeitssüchtig zu werden. Die Auswirkungen süchtigen Arbeitens sind
vielschichtig und verheerend – nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern auch
für sein näheres und weiteres Umfeld, und nicht zuletzt wohl auch für die
Gesellschaft insgesamt. In der vorliegenden Arbeit gilt es deshalb zu klären, welche Maßnahmen ein Unternehmen treffen kann, um präventiv gegen Arbeitssucht vorzugehen bzw. intervenierend einzugreifen. Dazu sollen im nachfolgenden Gliederungspunkt zunächst die für den weiteren Verlauf relevanten konzeptionellen Grundlagen dargelegt werden. Im daran anknüpfenden Abschnitt sollen exemplarisch mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen gezeigt werden. Bei dieser Darstellung sollen Maßnahmen aus den verschiedenen Bereichen Personalauswahl, Personalerhaltung sowie Personalentwicklung vorgestellt werden. Im abschließenden Gliederungspunkt endet die Arbeit mit einer Ergebniszusammenfassung und einem kurzen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptionelle Grundlagen
- Begriffliche Grundlagen
- Hintergründe und Ursachen von Arbeitssucht
- Phasen der Arbeitssucht und Typologisierung von Arbeitssüchtigen
- Individuelle und organisationale Folgen arbeitssüchtigen Verhaltens
- Prävention und Intervention bei Arbeitssucht
- Arbeitssuchtprävention durch geeignete Personalauswahlstrategien
- Prävention und Intervention durch bessere Arbeitszeitgestaltung
- Verbesserung der Arbeitsplatzbeziehungen
- Stressreduzierende Gestaltung des Arbeitsumfeldes
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Möglichkeiten der Prävention und Intervention von Arbeitssucht in Unternehmen. Ziel ist es, Maßnahmen aufzuzeigen, die Unternehmen ergreifen können, um arbeitssüchtiges Verhalten zu verhindern oder zu bekämpfen. Der Fokus liegt auf Strategien aus den Bereichen Personalauswahl, Personalentwicklung und Arbeitsgestaltung.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Arbeitssucht"
- Ursachen und Entstehung arbeitssüchtigen Verhaltens
- Folgen von Arbeitssucht für Individuum und Organisation
- Präventionsmaßnahmen im Bereich der Personalauswahl
- Interventionsmöglichkeiten durch Arbeitszeitgestaltung und Verbesserung des Arbeitsumfeldes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das steigende Problem der Arbeitssucht in unserer leistungsorientierten Gesellschaft und führt in die Thematik ein. Sie verweist auf den Forschungsstand und die Notwendigkeit von präventiven und interventiven Maßnahmen in Unternehmen. Die Arbeit kündigt die Struktur und den Ablauf der folgenden Kapitel an.
Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Arbeitssucht und grenzt ihn von anderen Begriffen ab. Es beleuchtet die Ursachen und Entstehung von Arbeitssucht, analysiert die Phasen der Suchtentwicklung und erörtert die individuellen und organisationalen Folgen arbeitssüchtigen Verhaltens. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung eines fundierten Verständnisses des Phänomens Arbeitssucht, welches als Grundlage für die folgenden Kapitel zur Prävention und Intervention dient. Es werden verschiedene theoretische Ansätze und Forschungsbefunde vorgestellt und kritisch diskutiert, um ein umfassendes Bild der Problematik zu zeichnen.
Prävention und Intervention bei Arbeitssucht: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Strategien zur Prävention und Intervention von Arbeitssucht. Es werden exemplarisch Maßnahmen aus den Bereichen Personalauswahl, Arbeitszeitgestaltung, Verbesserung der Arbeitsplatzbeziehungen und stressreduzierende Gestaltung des Arbeitsumfeldes vorgestellt und detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung von Maßnahmen in Unternehmen. Die Darstellung der Maßnahmen wird mit entsprechenden Beispielen und Erläuterungen ergänzt, um ihre Anwendung und Wirksamkeit zu verdeutlichen. Die einzelnen Strategien werden kritisch hinterfragt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert.
Schlüsselwörter
Arbeitssucht, Prävention, Intervention, Personalauswahl, Arbeitszeitgestaltung, Stressmanagement, Arbeitsbeziehungen, Unternehmen, Suchtverhalten, Prozesssucht, Folgen von Arbeitssucht.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Prävention und Intervention bei Arbeitssucht
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument behandelt die Prävention und Intervention von Arbeitssucht in Unternehmen. Es untersucht Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um arbeitssüchtiges Verhalten zu verhindern oder zu bekämpfen, mit Fokus auf Personalauswahl, Personalentwicklung und Arbeitsgestaltung.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument umfasst die Definition und Abgrenzung von Arbeitssucht, die Ursachen und Entstehung arbeitssüchtigen Verhaltens, die Folgen für Individuum und Organisation, Präventionsmaßnahmen in der Personalauswahl und Interventionsmöglichkeiten durch Arbeitszeitgestaltung und Verbesserung des Arbeitsumfeldes.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den konzeptionellen Grundlagen (inkl. Begriffsklärung, Ursachen, Phasen und Folgen von Arbeitssucht), ein Kapitel zu Prävention und Intervention (mit Maßnahmen zu Personalauswahl, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsbeziehungen und Stressreduktion) und eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Wie wird Arbeitssucht im Dokument definiert und abgegrenzt?
Die genaue Definition und Abgrenzung von Arbeitssucht wird im Kapitel „Konzeptionelle Grundlagen“ detailliert erläutert. Es werden verschiedene theoretische Ansätze und Forschungsbefunde vorgestellt und kritisch diskutiert, um ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu schaffen.
Welche Ursachen und Folgen von Arbeitssucht werden behandelt?
Das Dokument beleuchtet die Ursachen und Entstehung von Arbeitssucht im Kapitel „Konzeptionelle Grundlagen“. Die individuellen und organisationalen Folgen arbeitssüchtigen Verhaltens werden ebenfalls in diesem Kapitel analysiert.
Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden vorgestellt?
Das Kapitel „Prävention und Intervention bei Arbeitssucht“ präsentiert Strategien aus den Bereichen Personalauswahl, Arbeitszeitgestaltung, Verbesserung der Arbeitsplatzbeziehungen und stressreduzierende Gestaltung des Arbeitsumfeldes. Die Maßnahmen werden detailliert beschrieben und mit Beispielen erläutert.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Ziel des Dokuments ist es, Maßnahmen aufzuzeigen, die Unternehmen ergreifen können, um arbeitssüchtiges Verhalten zu verhindern oder zu bekämpfen. Der Fokus liegt auf Strategien aus den Bereichen Personalauswahl, Personalentwicklung und Arbeitsgestaltung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Arbeitssucht, Prävention, Intervention, Personalauswahl, Arbeitszeitgestaltung, Stressmanagement, Arbeitsbeziehungen, Unternehmen, Suchtverhalten, Prozesssucht, Folgen von Arbeitssucht.
- Quote paper
- Benedict Hilligweg (Author), 2007, Möglichkeiten zur Prävention und Intervention von Arbeitssucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78729